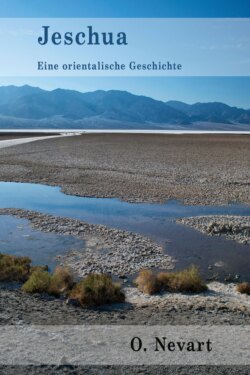Читать книгу Jeschua - O. Nevart - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 8
ОглавлениеLange vor Sonnenaufgang wachte Jeschua auf und als er sich gewaschen hatte, ging er in den Küchenbereich. Seine Mutter war bereits mit dem Zubereiten des Frühstücks beschäftigt. „Guten Morgen, Mama,“ grüßte Jeschua sie. „Guten Morgen, mein Sohn,“ sagte Maria und „ich konnte nicht richtig schlafen. „Ich weiß, Mama, ich konnte es in meinem Schlaf spüren.“
„Die Reise, auf die Du jetzt gehst, wird sie gefährlich sein?“ „Ich weiß es nicht, Mama. Die Wege der Gottheit sind immer voller wundersamer Wendungen.“
„Und sie sind uns vorherbestimmt,“ sagte Maria. „Amen!“ Sagte Jeschua. Sie umarmten sich zum Abschied, sie sahen sich fest in die Augen und Jeschua ging zum Haus der Weisen, wo Johannes ebenfalls eintraf.
Die Morgenluft war kühl und nur wenig später würde die Sonnenscheibe sichtbar werden. Ein tiefblauroter Streifen im Osten kündigte den neuen Tag an. Zwei der Weisen erschienen, hinter ihnen Knechte, die die Pferde, Decken, Ersatzkleidung und Proviant brachten. „Friede sei mit Euch, Jeschua und Johannes,“ sagten die Weisen und „haltet Euch an die Wege und gebt gut aufeinander Acht.“ „Ja, Herr,“ sagten sie. Johannes entschied, dass Jeschua hinter ihm sitzen solle und sie die Pferde unterwegs regelmäßig wechseln würden, um sie nicht zu überfordern. „Wir haben keine Zeit für Reitunterricht,“ sagte er.
Jeschua lernte von Johannes, sich seinen Umhang so zu wickeln, dass er beim Reiten nicht störte und er gab ihm die wichtigsten Anweisungen für den richtigen Sitz. Beim ersten Versuch konnte Jeschua den Rücken des Pferdes nicht erreichen, und so halfen die Knechte. Doch bereits beim Anreiten fiel er vom Pferd, denn er hatte nicht mit der kraftvollen Bewegung des Tieres gerechnet. Jeschua musste sich drei Handbreit hinter Johannes auf die höchste Stelle über den Hinterläufen des Pferdes setzen und seine Beine auf einer Seite belassen. Er konnte sich, falls nötig, an Johannes Gürtel festhalten und mit der anderen aufstützen. Beim zweiten Versuch gelangen die Absichten besser. Im langsamen Schritt ritten sie in Richtung Tiberias, das Packpferd trottete gemütlich hinter ihnen her. Nach einer Weile wechselte Johannes in einen langsamen Trab, doch nicht, ohne Jeschua über den Tempowechsel vorgewarnt zu haben. Und so kamen sie gut voran. Die Pferde wurden im Laufe des Rittes mehrfach gewechselt. Die Passanten, an denen sie unterwegs vorbeiritten, waren mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, so wie Jeschua und Johannes auch. Jeschua brauchte alle seine Konzentration und Kraft, damit er sich im Gleichgewicht halten konnte. Johannes achtete mehr auf die Wege, kleinere Hindernisse, aber vor allem auf entgegenkommende oder sie überholende Reiter, denen er zuweilen ausweichen musste.
Der Abstieg nach Tiberias dauerte längere Zeit. Sie mussten vom Pferd absteigen und diesen Abschnitt ihrer Reise zu Fuß gehen, denn die Serpentinen waren schmal und es herrschte reger Verkehr in Richtung Tiberias und aus Tiberias hinaus. Jeschua kannte das galiläische Meer von gelegentlichen Besuchen beim Bruder seines Patenonkels in seiner Kindheit, Johannes sah es an diesem Tag aber zum ersten Mal und er war beeindruckt von der Größe des Sees und dessen tiefblauer Farbe. Beide Männer hatten Tiberias vorher noch nicht gesehen, sie wussten aber, Fürst Herodes Antipas hatte diese Stadt vor einigen Jahren zu seinem neuen Herrschaftssitz bestimmt. Schon aus der Ferne konnten sie sehen, dass Tiberias größer als Nazaret war. Sie sahen eine Stadtmauer, die die Stadt wie einen Halbkreis umschloss, denn die Ostseite war zum See hin offen. Im Hafen lagen mehrere Schiffe. Sie nahmen an, dass das sichtbar größte Gebäude der Fürstenpalast sein musste. Bei den Farben der Häuser dominierten Ockertöne und das gebrannte Rot der Dachziegel, sie konnten aber auch hellere Strukturen erkennen. Vor dem Stadttor angekommen erkundigten sie sich nach Unterstand für die Pferde, und sie fanden schließlich einen Stall, der Ihnen ein für sie erschwingliches Angebot machte. Viele Einwohner von Tiberias und Besucher, die es sich finanziell leisten konnten, gingen jedoch mit ihren Reit oder Packtieren in die Stadt, dort waren die Stallungen teurer als außerhalb der Stadtmauern.
Die Wachmänner in Dörfern wie Nazaret oder NaÏn, waren meist brave Männer aus den Dörfern selbst oder aus deren Umgebung. Sie waren oft nur unzureichend an den zumeist schlecht gefertigten Waffen ausgebildet, die sie trugen. In den Dörfern waren diese Umstände völlig ausreichend. In Tiberias wurden Reisende jedoch von römischen Legionären in Empfang genommen, die speziell im Wachdienst und für den Dienst an den Stadttoren ausgebildet waren. Über Jahrhunderte hatten die Römer diesen Dienst perfektioniert. Kein Außenstehender verstand ihre Handlungen, oder konnte daraus ein System entschlüsseln. Viele hatten das versucht und waren daran gescheitert. An einem Tag schien es, die Wachsoldaten seien gelangweilt oder die Hitze hätte ihnen zugesetzt, sodass viele Besucher oder Abreisende unbehelligt blieben. Am nächsten Tag führten sich genau die gleichen Soldaten trotz gleicher Hitze aber wie die Furien auf, und nahezu jeder Mensch und jede Kreatur wurde auf Herz und Nieren untersucht. Wenn den Soldaten eine Person oder eine Sache verdächtig erschien, wurde den betroffenen Personen der Zugang verweigert. Es konnte sogar geschehen, dass diese Personen von den Soldaten auf der Stelle verhaftet wurden. Große Städte zogen schließlich nicht nur die ehrlichen Menschen an, denn in ihnen befanden sich oft große Werte, daher war die Anwendung dieser Praktiken zum Schutz der Städte verständlich. In Rom, oder in großen Städten auf dem italienischen Festland, wurden Wachsoldaten, die sich von Besuchern für den Einlass bestechen ließen, und die dabei überführt wurden, zu drakonischen Strafen verurteilt. Gleiches galt für Wachsoldaten, die den Wachdienst ausnutzten, um ihren Sold aufzubessern, indem sie von Besuchern für den Zugang zur Stadt Geld erpressten. Rom war das Licht der Welt und nichts sollte diesen Eindruck bei den Menschen, die aus allen Ländern der Welt kamen, trüben. Vollständig verschwand diese Praxis zwar nie, aber für die überwiegende Zahl der Menschen, die nach Rom kamen oder aus Rom abreisten, war sie praktisch nicht spürbar. Aber Rom war von den Provinzen weit entfernt und Bestechung der Wachsoldaten war in den Provinzen Gang und gäbe, genauso wie Erpressung von Besuchern durch die Wachsoldaten. Es sei denn, ein zumeist neu angekommener, oft junger und übereifriger Kommandant der Wachsoldaten überwachte und bestrafte diese Praxis. Die Wachsoldaten fürchteten diese Neuankömmlinge aber nicht sehr. Denn, so sicher wie die Sonne im Osten auf und im Westen untergeht, so sicher war es, dass die neuen Kommandanten sich nach wenigen Tagen mit den örtlichen Gesetzmäßigkeiten anfreundeten.
Und so gingen Jeschua und Johannes zum Stadttor und sie sprachen einen der Wachsoldaten in ihrer Unerfahrenheit mit diesen Dingen direkt an: „Herr,“ sagte Jeschua, „wir möchten Legat Claudius Babillus sprechen. Wie können wir ihn finden?“ Kein Aramäer sprach einen römischen Wachsoldaten ohne Not ungefragt an, daher wusste dieser im gleichen Augenblick, dass die beiden Aramäer, die vor ihm standen, unerfahrenes Landvolk waren. Aber der unergründliche Wille der römischen Götter hatte entschieden, dass die Wachsoldaten zu dieser Stunde zu Scherzen aufgelegt waren, was Jeschua nicht wissen konnte. Und der Römer fragte mit der ihm größtmöglichen Freundlichkeit: „Nun, edle Herren, was ist Euer Begehr?“ Ein anderer Wachsoldat, der die Szene sah, kam zu ihnen und Jeschua sagte: „Wir möchten mit Legat Claudius Babillus in einer persönlichen Angelegenheit sprechen.“ Der erste Wachsoldat sah seinen Kameraden an: „Die edlen Herren wollen Legat Claudius Babillus in einer persönlichen Angelegenheit sprechen,“ wiederholte der erste Wachsoldat sichtlich amüsiert. Johannes ahnte, dass sie einen Fehler begangen hatten. Er berührte Jeschua an einem Arm. Dann zog Jeschua den versiegelten Papyrus aus seinem Umhang hervor, den Bezalel und Claudius ihnen gegeben hatten und zeigte es dem Wachsoldaten. Johannes tat es ihm gleich „Wir erhielten diese Schreiben von Legat Claudius Babillus persönlich. Er versicherte uns, dass wir damit jederzeit zu den höchsten Stellen in Tiberias vorgelassen werden.“ Die Wachsoldaten entrollten die Papyri, sahen die Siegel von Claudius und eines Rechtsgelehrten und auf der Stelle veränderte sich der Tonfall ihrer Stimmen. „Geht zum Palast des Fürsten, dort werdet Ihr Legat Claudius Babillus antreffen. Ihr dürft passieren,“ sagte der erste Wachsoldat und er gab Jeschua und Johannes die Papyri zurück. Die Wachsoldaten sahen sich an. „Ei, da wären wir ja beinahe in einen Schlamassel, geraten,“ sagte der zweite Wachsoldat.
Und die gute Laune der römischen Götter wandelte sich genauso schnell, wie sie gekommen war. Am meisten verärgerte die Wachsoldaten aber die entgangenen Einnahmen, die sie in ihren Gedanken von den beiden Aramäern erwartet hatten. Die Jeschua und Johannes nachfolgenden Reisenden wurden daher den strengsten Kontrollen unterzogen, was die eben noch verlorenen Einnahmen der Wachsoldaten mehr als kompensierte und schnell bildete sich eine Warteschlange vor dem Stadttor.
Nachdem sie einige Schritte gegangen waren, fragte Johannes: „Wer waren die Amoriter, Jeschua?“ Und Jeschua sagte ihm: „Bevor das Volk Israel in das gelobt Land gehen konnte, mussten sie das Volk der Amoriter besiegen, die sehr stark waren und so fürchteten sich viele im Volk Israel, obwohl die Gottheit doch an ihrer Seite stand. So verzögerte sich der Einzug des Volkes Israel in das gelobte Land um vierzig Jahre, denn die Gottheit bestimmte, dass keiner aus der Generation der Ängstlichen das gelobte Land sehen solle, außer Kaleb und Josua.“ Johannes verstand nun die Worte der Weisen in Nazaret.
Sie erkundigten sich mehrmals bei Passanten nach dem Weg zum Fürstenpalast. Viele Menschen, die sie sahen, trugen fremdländische Kleidung und hatten fremdländisches Aussehen. Da waren Römer, Menschen aus Syria, Mazedonien, Galatien, Ägypten, Mauretanien. Ein Stimmengewirr unterschiedlicher Dialekte und Sprachen umgab Johannes und Jeschua. „Ist es nicht erstaunlich,“ fragte Johannes, „wie alle diese Menschen hier miteinander leben? Obwohl man doch meinen könnte, sie müssten einander feindlich gesonnen sein.“ „Wir alle haben die gleichen Wurzeln, Johannes,“ sagte Jeschua. „Und doch besteht die Schöpfung der Gottheit aus Vielfalt. Kein Stein gleicht einem anderen und doch ist er Stein. Die Menschen hier, Johannes, besinnen sich auf ihr gemeinsames Interesse, das Geschäftemachen. Ihre Herkunft und ihr Aussehen sind dafür nicht von Belang.“ Darüber wollte Johannes später nachdenken, denn sie hatten ihr Ziel erreicht. Aus einer der kleineren Straßen kamen sie zu einem großen, offenen Platz, an dessen Ende der Eingang zum Palast war.
Anders, als in den Straßen, war der Boden des Platzes mit großen, grauweißen Steinplatten bedeckt, der das Sonnenlicht reflektierte und sie blendete. An seinen Rändern standen hohe Säulen im griechisch-römischen Stil, dazwischen Statuen von verschiedenen römischen und griechischen Gottheiten, auch mehrere kleinere Tempel und ein großes, aramäisches Gebetshaus. Der Platz war nicht so bevölkert, wie die Straßen, auf denen sie gekommen waren. Nur auf einer Seite, vor einem der Eingänge mit niedrigen Türen, warteten einige aramäisch aussehende und gekleidete Menschen. Vor diesem Eingang stand ein Aramäer hinter einem Schreibpult. Ein Wartender trat vor, sagte etwas zu dem Aramäer, der etwas aufschrieb. Dann ging der Wartende durch den kleineren Eingang, kurz danach kamen zwei Aramäer aus dem kleineren Eingang und entfernten sich vom Palast.
Jeschua und Johannes gingen zum größten Eingang, vor dem mehrere Legionäre Wachestanden, die aber anders gekleidet waren, als die Wachsoldaten am Stadttor. Jeschua ging zu einem der Männer, von dem er annahm, dass er der Älteste von ihnen war. Und er sagte: „Herr, die Soldaten am Stadttor sagten uns, hier würden wir Legat Claudius Babillus antreffen.“ Jeschua reichte ihm den Papyrus. Der Legionär besah zuerst den Papyrus und musterte dann die Ankömmlinge kurz, denn ihre Erscheinung erschien ihm nicht zu dem Schreiben zu passen, das vom Legaten und einem aramäischen Rechtsgelehrten persönlich versiegelt war. Höhergestellte Römer und Aramäer, mit feinerer Kleidung, als Jeschuas und Johannes, führten üblicherweise derartige Schreiben mit sich. Doch der Legionär erkannte die Echtheit der Siegel: „Ihr seid zum ersten Mal hier?“ Fragte er in ihrer Sprache. „Ja, Herr,“ sagten sie. „Wartet hier,“ sagte der Legionär und er ging in den Palast. Wenig später kehrte er mit einem Mann zurück, den Jeschua und Johannes als einen Sklaven erkannten, denn er trug den Umhang etwas anders zugeschnitten als üblich. Johannes musste dem Legionär seine Waffen übergeben. „Du erhältst sie bei Verlassen des Palastes zurück,“ sagte der Legionär. Dieser gab Jeschua auch den Papyrus zurück und der Sklave bat sie ihm zu folgen.
Weder Jeschua noch Johannes hatten in ihrem bisherigen Leben das Haus eines reichen Aramäers oder Römers betreten oder gar einen Fürstenpalast. So waren sie sehr beeindruckt von der Größe der Flure, durch die sie gingen und von der prachtvollen Ausstattung. Einige Diener und Beamte mit Papyri unter den Armen kreuzten ihre Wege, insgesamt herrschte ruhige Geschäftigkeit vor. Die Luft in den Fluren war angenehm kühl, anders als in den stickig heißen Straßen von Tiberias. Wie im Laufe der Anreise wurden sie nur von wenigen Menschen beachtet. Diejenigen, denen Jeschuas und Johannes Anwesenheit bewusst auffiel, befanden das Erscheinen von zwei ärmlich aussehenden Aramäern an diesem Ort zwar ungewöhnlich, doch alle sahen einen der ihnen bekannten Sklaven vor den Aramäern hergehend und so gingen sie wieder ihren Beschäftigungen nach. In einem Seitenflügel des Palastes, in dem nach Jeschuas Eindruck die Verwaltung untergebracht war, blieb der Sklave vor einer hohen Tür aus schwerem Holz stehen, die dieser öffnete. „Wartet hier,“ sagte er ihnen und er verschwand hinter der Tür, die er hinter sich schloss. „Immerhin wissen wir jetzt, wofür wir unsere Steuern zahlen,“ flüsterte Johannes. Jeschua nickte ihm kurz zu, doch mit einer Geste bedeutete Jeschua ihm auch, nicht alles laut auszusprechen, was er gerade dachte.
Die Tür wurde wieder geöffnet, der Sklave erschien erneut. „Folgt mir,“ sagte er abermals zu ihnen. Vor einem großen offenen Fenster sahen Jeschua und Johannes Claudius stehen, der sich ihnen gleich zuwandte. Der Sklave sagte: „Die Besucher, die Dich sprechen wollen, Herr.“ Und fast lautlos entfernte er sich. Claudius freute sich sehr, Jeschua und Johannes wiederzusehen, und sie begrüßten sich herzlich, dann sagte Claudius: „Mir wurde Euer Kommen mitgeteilt, obwohl niemand Eure Namen zu sagen wusste.“ „Niemand fragte uns danach,“ sagte Jeschua. „Wie ist es Euch in den zurückliegenden Wochen ergangen? Was führt Euch zu mir?“ Fragte Claudius sie. „Doch bitte, legt Euch nieder, Ihr müsst durstig und hungrig sein.“ Claudius klatschte einmal in seine Hände und Diener erschienen mit Brot, Salz, Obst und frischem Wasser. Jeschua und Johannes begannen sogleich über die Ereignisse zu berichten. Claudius hörte ihnen zu, stellte aber keine Fragen.
Als Jeschua beginnen wollte, über die Männer aus Kapernaum zu berichten, betrat Bezalel Claudius Arbeitszimmer. „Es ist mir eine große Freude Euch wiederzusehen, Jeschua und Johannes. Friede sei mit Euch.“ Sagte Bezalel. Bezalel sah in Jeschuas Augen die Frage, wie er wissen könne, dass sie hier sind. „Nirgendwo lässt sich ein Geheimnis schlechter bewahren als in einem Palast,“ sagte Bezalel und „Im Ernst. Spurius, der Mann, der Euch herführte, arbeitet zuweilen für Claudius und mich. Ich traf ihn zufällig an und er berichtete mir über zwei Aramäer, die er zu Claudius geführt hatte. Ich war einfach nur neugierig.“
Jeschua wiederholte für Bezalel kurz das, was er Claudius berichtet hatte, bevor Bezalel kam. Dann sagte Jeschua: „Vor zwei Tagen kamen zwei Fremde nach NaÏn, die sich nach Simon erkundigten. Sie gaben an, sie wären schon oft bei ihm gewesen. Mir erschien das aber merkwürdig, da sie vorher bei den Wachmännern nach dem Weg zu Simons Anwesens gefragt hatten. Ich sah am Dorfeingang, wie sie das taten. Ihre Rede zu uns war unhöflich. Ich lud sie ein ihr Nachtlager bei uns aufzuschlagen, doch sie zogen nach kurzer Zeit weiter.“ Und Johannes sagte: „Als sie weggingen, sahen wir auf einem der Leinensäcke, die auf dem Packesel lagen, das Fischzeichen.“ Anschließend berichtete Jeschua noch über die Entschlüsse der Weisen in Nazaret, dass ein Weiser samt Eskorte nach NaÏn gehen würde, Johannes und er selbst nach Tiberias reiten sollten, um Claudius und Bezalel zu informieren. „Es war richtig, dass Ihr zu uns gekommen seid. Danke für diese Informationen. Sagten Euch die Fremden, woher sie kamen und was Ihr Anliegen war?“ Stellte Claudius die erste Frage. „Sie sagten, sie seien Gastwirte aus Kapernaum und sie würden ihre Lieferanten regelmäßig besuchen, wohl, um sich von ihren Umständen zu überzeugen und um Preise mit ihnen zu verhandeln. Ich fand einen Namen, Matthias, in Simons Buchhaltungsschriften, den anderen nicht.“ „Habt Ihr Ihnen von der Untersuchungskommission berichtet?“ Fragte Bezalel. „Ja, Herr,“ sagte Johannes und „hätten wir das verschweigen sollen?“ „Nein, Johannes,“ sagte Claudius. „Angenommen, die Fremden aus Kapernaum sind an den aufrührerischen Tätigkeiten beteiligt und angenommen, sie erfahren über die Untersuchungen, dann werden sie denken Ihr konspiriert mit dem Fürsten und Rom. Dadurch kommt Euer Leben in Gefahr.“
„So,“ ergänzte Bezalel und „ist es wahrscheinlicher, dass sie Euch für das halten, was Ihr ihnen berichtet habt.“ Jeschua erinnerte sich an ihre Worte, als sie, nach der Abreise der Fremden vom Weingut, ihre Bedenken zusammengefasst hatten. Doch erst durch Bezalels letzten Satz, und speziell durch das Wort ‚konspiriert‘, wurde Jeschua die Tragweite der Ereignisse wirklich bewusst. Er selbst, Johannes, die Menschen auf Simons Weingut und in NaÏn, und selbst die Weisen von Nazaret: Waren sie nicht wie die Nüsse, die er als kleiner Junge in Vasen aus gebranntem Ton geworfen hatte: Abhängig von den Kräften und dem Geschick derjenigen, die sie warfen, unfähig über sich selbst zu bestimmen? Claudius bemerkte an Jeschua eine Veränderung. Er beschloss, ihn später darauf anzusprechen.
Claudius klatschte wieder in seine Hände und ein Diener betrat den Raum: „Bitte, Lucius soll zu mir kommen,“ sagte Claudius. Der Diener nickte und ging, nur wenig später kehrte er mit Lucius zurück. „Lucius ist hier, Herr,“ sagte der Diener. „Danke, Manius,“ sagte Claudius. Sie standen auf, um Lucius zu begrüßen. Dieser war verwundert über die Anwesenheit der Aramäer, doch auch er war erfreut sie wiederzusehen. Claudius informierte Lucius in aller Kürze über die Berichte von Jeschua und Johannes. „Was sind die bisherigen Ergebnisse Deiner Studien über die parthischen Schriftrollen, Lucius?“ Fragte Claudius. „Nun,“ sagte Lucius und er rollte eines der Papyri des Simon, die er mitgebrachte hatte, vor den Männer aus, „meiner Meinung nach sind die Schriftrollen eine Art Tagebuch. Simon schrieb die Begebenheiten seit seiner Abreise aus Babel in unregelmäßigen Abständen nieder. Danach heiratete Simon Sigalit in Dura Europos in Syria, anschließend zogen sie von Stadt zu Stadt weiter, immer in Richtung Süden. Ihr Ziel war Jerusalem. Dort kamen sie vor einigen Jahren auch an. Sie wurden aber an den Stadttoren abgewiesen, die Gründe sind nicht niedergeschrieben. Simon arbeitete über die Jahre als Weingärtner und Schriftgelehrter. In den Schriften wurde er vermutlich in Babel ausgebildet, er deutet es vage an. Wie er seine Kenntnisse im Weinanbau erworben hat, erwähnt er nicht. Regelmäßig schreibt er über Verpflichtungen, die er einzuhalten habe, an einigen Stellen schreibt er, dass er sie eingehalten hat. Was das für Verpflichtungen waren, schreibt er nicht. Außer dem Namen seiner Frau finden sich keine weiteren Namen. Er schrieb die Namen von Ortschaften auf, oder die von Gebieten, oft als Abkürzung. Er beschrieb sie aber nicht. Viele Passagen erscheinen mir wie Selbstermahnungen für bestimmte Verhaltens oder Denkweisen. Den letzten Eintrag schrieb er vermutlich vor zwei Monaten, der Art der Trocknung der Tinte nach zu urteilen: Alles Nötige ist vorbereitet.“
Jeschua erhob sich und er ging zu einem der Schriftpulte. Dann malte er das Fischzeichen auf ein leeres Stück Papyrus und zeigte es dem Lucius und fragte: „Verzeih, Claudius. Sahst Du dieses Zeichen in den Schriftrollen, Lucius?“ „Ja, Schriftgelehrter,“ sagte Lucius, wieder rollte er Papyri aus und deutete darauf. „Ihr seht, es steht über der ersten Zeile und unter der Letzten. Unter dem Ersten steht zusätzlich das griechische Alpha geschrieben, unter dem Zweiten das Omega.“ Nach einer kurzen Pause sagte Claudius: „Danke, Lucius. Ich weiß, Du bist momentan sehr beschäftigt. Geh zu Deiner Arbeit.“ „Ja, Claudius,“ sagte Lucius und er verließ den Raum. „Und was jetzt?“ Fragte Jeschua.
Claudius und Bezalel kannten den Bericht des Lucius bereits, sie wollten, dass die Aramäer ihn aus dem Mund des Lucius hörten. Claudius sagte: „Wir kennen diese Informationen schon seit einigen Tagen. Doch bis zu Eurer heutigen Ankunft waren sie de facto wertlos, weil sie keine konkreten Anhaltspunkte liefern. So konnten wir bisher überhaupt nichts unternehmen.“ „Werden die Schriftrollen des Simon schriftlich übersetzt?“ Fragte Jeschua. „Ja, Jeschua,“ sagte Bezalel und „Lucius arbeitet zur Stunde daran. Weshalb fragst Du?“
„Ich möchte die Übersetzungen so schnell, wie möglich lesen. Besonders die Selbstermahnungen.“ Die Männer sahen Jeschua an. „Verzeiht,“ sagte Jeschua und „Selbstermahnungen sind wichtige Übungen in der Ausbildung von Schriftgelehrten. Sie sind auf jeden Schüler individuell abgestimmt, jeder von uns hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Auch ich praktiziere sie. Die Selbstermahnungen des Simon helfen uns möglicherweise, ihn besser kennenzulernen, daraus können wir vielleicht auf sein Handeln schließen. Vielleicht erkennen wir die Spuren seines Handelns, wenn wir die treffen, die er einst traf. Und vielleicht können wir daraus ableiten, was die Menschen um Simon geplant haben.“ Johannes und Bezalel konnten Jeschua nicht folgen, Claudius hingegen schon. „Bis wann wird Lucius mit den Übersetzungen fertig sein?“ Fragte Jeschua. „In drei bis vier Tagen,“ sagte Claudius. „Diese Zeit haben wir vielleicht nicht,“ sagte Jeschua und „ich möchte lesen, was Lucius bis jetzt übersetzt hat.“ Wieder klatschte Claudius in seine Hände und wieder erschien der Diener. „Manius, bitte rufe den Lucius nochmals. Er möge die übersetzten Schriften mitbringen. Er weiß, welche ich meine.“ „Ja, Herr,“ sagte der Diener und ging. Wieder erschien Lucius, diesmal mit den Papyri, die seine bisherigen Übersetzungen enthielten. „Verzeih unsere Ungeduld, Lucius,“ sagte Claudius und „welche der Selbstermahnungen des Simon hast Du bereits übersetzt?“
„Diese hier,“ sagte Lucius und er übergab die Schriftrollen Claudius und „es sind aber auch andere Texte darin.“ „Danke Lucius, für heute werden wir Dich vermutlich nicht mehr stören. Und Lucius,“ der den Raum schon wieder verlassen wollte. „Ja, Claudius?“ „Bitte eile Dich mit den Übersetzungen.“ „Ja, Claudius.“
Nach einer kurzen Pause fragte Jeschua: „Gibt es hier einen Ort, an dem ich die Übersetzungen alleine und in Ruhe studieren kann, Claudius?“
„Nun, Jeschua. Der beste Ort dafür ist hier. Bezalel und ich werden Johannes ein wenig herumführen. Wie viel Zeit brauchst Du?“ Jeschua sagte, nachdem er die Anzahl und die Stärke der Schriftrollen geschätzt hatte: „Kommt nach einer Stunde wieder.“ Dann begann er zu lesen, was Simon geschrieben hatte.
Er verstand nun Lucius, der die Schriften eine Art Tagebuch genannt hatte. Es waren Fragmente, scheinbar ohne inneren Zusammenhang. Dann trennte Jeschua die Texte, die mehr Selbstermahnungen enthielten, von den anderen und er besah sie von Neuem. Zu Beginn ermahnte sich Simon seinen Großvater, seine Eltern und Lehrer zu allen Zeiten zu ehren und die Worte der Gottheit als einziges Gesetz anzuerkennen, gleich welche Verführungen auf ihn zukommen würden. Es folgten Lehrsprüche seiner Mentoren, die für ihn wichtig waren. „Konzentriere Dich jeder Zeit auf Deinen Auftrag,“ las Jeschua laut vor und „hüte Dich vor den Schwalben.“ Je mehr er las, umso mehr erschienen Jeschua die Texte unverständlich und er wollte seine Theorie schon verwerfen, als ihm etwas auffiel, dem er vorher keine Bedeutung beigemessen hatte: Über oder unter den Zeilen hatte Simon Abkürzungen von Orten oder Gebieten geschrieben. Er suchte in Claudius Arbeitsraum nach einer Karte der aramäischen Provinzen und fand schließlich eine. Er zeichnete die Karte sehr grob auf einen leeren Papyrus ab, in dem er vor allem den Jordan, das galiläische Meer im Norden, sowie Jerusalem und das Tote Meer im Süden hervorhob. Dann übertrug er die Ortsnamen aus Simons Texten in die Karte. Er begann im Norden mit Kapernaum. Als er fertig war, suchten Jeschuas Augen nach denkbaren Linien zwischen den Orten und am Ende seiner Suche sah er zwei ineinander verwobene gleichseitige Dreiecke vor seinem inneren Auge, ein nach oben weisendes und eines nach unten, mit identischem Zentrum. In der Mitte der Formen entstand so ein gleichmäßiges Sechseck. Er nahm einen Schriftkeil, tauchte ihn ein Tintenfass und er verband die Orte miteinander und am Ende sah er das Symbol vor sich. Sogar Nazaret und NaÏn wurden von den Linien berührt. Er kannte das Symbol, es wurde in vielen Häusern zur Dekoration verwendet. Die meisten Städte auf, oder ganz nah bei den Linien, waren in Galiläa und in Judäa. Simons Reisen waren einem Plan gefolgt. Sollte Claudius Theorie von einem Aufruhr richtig sein, so würde der Aufruhr hier am galiläischen Meer und in der Region um Jerusalem beginnen. Ziel war es, die Provinzen zu einem Reich zu vereinen. Er besah die Selbstermahnungen nochmals und nun verstand er sie völlig anders. Die Ermahnungen waren Botschaften, die Simon in die jeweiligen Orte gebracht haben konnte oder die er vielleicht aus ihnen mitnahm. Jetzt mussten die geschriebenen Worte nur richtig verstanden werden.
Jeschua sah durch das große offene Fenster in Claudius Arbeitsraum. Die Schatten im Innenhof wurden länger, es war Nachmittag geworden. Claudius, Bezalel und Johannes kamen zurück und Jeschua zeigte ihnen, was er entdeckt hatte. Claudius fand die Worte zuerst wieder: „Ich kenne einen Mann, der eine Autorität auf dem Gebiet der Geheimsprachen ist. Doch er lebt und arbeitet in Rom.“
„Jener Mann muss zu uns kommen,“ sagte Johannes. Claudius dachte kurz nach. „Mag sein, Johannes,“ sagte Claudius und „wir müssen einen Plan für unser Handeln entwickeln. Diese unsichtbaren Kräfte gehen offensichtlich methodisch vor, sie sind uns viele Schritte voraus.“
Claudius vertrat bereits während seines Studiums des römischen Rechts Kläger und Angeklagte in Strafprozessen vor Gericht. Auch nach Abschluss des Studiums setzte er diese Tätigkeit fort, auch wenn ihm der Dienst in der römischen Armee dafür zunehmend weniger Zeit ließ. Doch die Prinzipien einer möglichst faktenbasierten Beweisführung waren in ihm tief verankert. So begann er, wie in einem Strafprozess, den Sachverhalt darzulegen. „Was wissen wir durch Beweise? An erster Stelle ist der unnatürliche Tod Simons, des Schriftgelehrten und Winzers, bezeugt durch den Weingärtner Daniel und durch den Arzt Gallech. Zweitens haben Bezalel und Kenan geheimnisvolle Fischzeichen an Innenwänden von verlassenen Häusern gesehen. Drittens sahen Jeschua, Johannes und Kenan das Fischzeichen bei zwei Männern aus Kapernaum, die sich nach dem toten Simon erkundigten. Viertens liegen dem Legaten Claudius Babillus und dem Rechtsgelehrten Bezalel Simeon Berichte von gefangenen parthischen Soldaten über rebellische Tätigkeiten im Grenzgebiet zwischen Parthien und Syria vor. Diese wurden jedoch auch durch peinliche Befragung gewonnen, was die Kraft dieser Aussagen meiner Erfahrung nach erheblich mindert. Fünftens erkannten wir durch die hervorragend dargelegte Analyse des Schriftgelehrten Jeschua, dass das Tagebuch des toten Simon, dem Anschein nach kein Tagebuch ist, sondern vermutlich eine Sammlung von geheimen Botschaften.“ Claudius holte kurz Atem, dann: „Was wissen wir nicht durch Beweise? Erstens, wir kennen weder den, oder die Täter, die Simon erschlugen, noch wissen wir ihre Beweggründe. Zweitens wissen wir nicht, ob die an drei verschiedenen Orten beobachteten Fischzeichen im Zusammenhang mit Simons Tod, oder den Aussagen der gefangenen parthischen Soldaten, oder mit den Schlussfolgerungen aus der Analyse des Jeschua stehen.“ Er holte nochmals Atem. „Ich frage Euch: Gegen wen erheben wir also, auf welchen Beweisen begründet, welche Anklage?“ Bezalel, Jeschua und Johannes sahen Claudius verwundert an.
Claudius wusste auch, dass auf den Gebieten der Politik und des Militärs oft genug viel weniger als ein Beweis ausreichte, um ganze Völker ohne Anklage und Gerichtsverfahren auszurotten. Das römische Kaiserreich und dessen Vorgängerin, die römische Republik, aber auch die Reiche des großen Griechen oder die der Ägypter hatten dies in ihrer jeweiligen Vergangenheit vielfach praktiziert, mit wechselnden Erfolgen. Sie standen ihren zeitweiligen Gegnern darin in Nichts nach. Die Motive, meist eine Mischung aus Gier, Machtstreben, Neid und Hochmut der Herrschenden, ersetzten einfach Anklage, Beweisführung und Schuldspruch. Er erinnerte sich an heftige Debatten im Senat, als es die schwierige militärische Lage in den nördlichen Provinzen zum wiederholten Male erforderte neue Legionen auszuheben und sich etliche Senatoren wohlbegründet, aber erfolglos, dagegen aussprachen. Und er erinnerte sich an die bitteren Tränen und Anklagen römischer Mütter und Ehefrauen, als ihre Söhne und Ehemänner nicht aus den Kriegen zurückkehrten. Dann holte Bezalel Claudius von seinen ausschweifenden Gedanken in die Gegenwart zurück: „Claudius? Was willst Du uns sagen?“
„Verzeiht,“ sagte Claudius und „ich brauche eine Pause, lasst uns bitte beim Abendessen weiterreden.“ Claudius wandte sich an Jeschua und Johannes: „Wo werdet Ihr heute nächtigen?“
„Wir hatten, ehrlich gesagt, noch keine Gelegenheit darüber nachzudenken. Doch auf dem Weg zum Palast sahen wir einige Herbergen und es erschien uns, dass in ihnen noch freie Zimmer waren.“
„Das kommt nicht in Frage, Jeschua! Es wäre mir eine Freude, wenn Ihr in meinem Haus übernachtet.“ „Claudius,“ sagte Jeschua. „Wir danken Dir für Deine Großzügigkeit. Doch, wir sind einfache Aramäer. Werden die Leute um Euch nicht reden, wenn wir bei Euch übernachten?“ Claudius war wieder vollständig im Jetzt angekommen. „Bei mir gehen jeden Tag viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Standes ein und aus. Die Leute würden sich mehr Gedanken um mich machen, wenn es nicht so wäre.“ Jeschua und Johannes nickten. „Begleitest Du uns Bezalel?“ Fragte Claudius. „Mit Vergnügen, Claudius,“ sagte Bezalel.
Auf dem Weg zum Haus des Claudius musste Johannes Bezalel einfach fragen: „Herr, wird Deine Frau von Dir nicht Erklärungen fordern, warum Du nicht zum Abendessen bei der Familie warst?“
„Johannes,“ sagte Bezalel. „Ich nehme an, Du sprichst aus eigener Erfahrung, doch: Nenn mich bitte bei meinem Namen. Denn erstens, Du bist Aramäer, wie ich es bin, und zweitens sind wir beide Bürger des Römischen Reiches und damit sind wir vor den Gesetzen gleichgestellt. Drittens, und damit zurück zu Deiner Frage: Ich bin nicht verheiratet und auf mich wartet keine Familie. Meine Arbeitstage sind lang, keine Ehefrau könnte das auf Dauer ertragen. Und damit spreche ich aus eigenen Erfahrungen.“ Jeschua und Claudius schmunzelten. Johannes beließ es bei einem einfachen „Ja.“ Bezalel spürte Johannes Unbehagen. „Claudius und ich durften Dich als einen unerschrockenen und umsichtigen Mann kennenlernen und ich verstehe gut, warum Jeschua Dich seinen besten Freund nennt. Bleibe so, wie Du bist. Alles andere ist Wille der Gottheit.“
„Ja,“ sagte Johannes. Jeschua konnte sich nicht daran erinnern, mit Bezalel jemals über seine Gefühle für Johannes gesprochen zu haben, auch gegenüber Johannes hatte sich Jeschua nie offenbart. Doch Bezalel hatte recht, sagte sich Jeschua. Nachdem sie sich gründlich gewaschen hatten, legten sie sich zum Abendessen nieder. Claudius Diener brachten einfache Speisen, die Jeschua und Johannes gut kannten. Claudius erriet Jeschuas Gedanken: „Es ist so, wie ich es in NaÏn sagte: Ich esse, was Ihr esst, und trinke, was Ihr trinkt.“ Dann sagte Bezalel: „Claudius, Du sagtest, wir wollen beim Essen weiterreden. In der Zwischenzeit dachte ich über Deine Rede nach, als Du in den Rollen des Anklägers und des Verteidigers des Beklagten zugleich warst. Darf ich fortfahren?“
„Gerne, Bezalel,“ sagte Claudius und „Du weißt, ich schätze Deine Gedanken sehr.“ „Nun,“ begann Bezalel. „Wir haben heute Erstaunliches gehört und ja, wir verfügen nicht über viele Beweise über die Ereignisse oder die Menschen, die sie verursachten. Doch unsere unsichtbaren Gegenspieler wissen nicht, dass wir das nicht wissen.“ Bezalel sah, dass sie seinen Gedanken nicht folgen konnten. „Als Claudius eben von Gier, Machtstreben, Neid und Hochmut der Herrschenden sprach, sah ich einen Weg, wie wir uns ihnen vielleicht nähern können.“ Ohne genau zu wissen woher die Gedanken kamen, Jeschua war der Erste, der ahnte, was Bezalel sagen würde: „Unsere Gegenspieler sehen bei den mächtigen Römern und den einflussreichen Aramäern, die ja zusammenarbeiten, dass sie über unbegrenzte Mittel, Macht und Informationen verfügen. Deshalb haben sie sich einen sehr klugen Plan zurechtgelegt. Mit Widerstand rechnen sie vermutlich nur von den Mächtigen. Doch was würde geschehen, wenn Ihnen ein Gegenspieler aus einem anderem Teil der Gesellschaft gegenüberstehen würde?“ Jeschua beendete Bezalels Theorie. „Sie würden nicht an ihrer Gier oder ihrem Machtstreben scheitern, aber ihr Neid und Hochmut würden sie zu Fall bringen.“
„Wie das?“ Wollte Claudius wissen. „Nun,“ sagte Jeschua, „wenn eine ebenso konspirative und glaubhafte Kraft aus den Reihen der Galiläer erscheinen würde, wie es die Anderen sind, die ihnen die Stimmen des Volkes streitig macht, die die Anderen aber für ihre Sache brauchen, dann müssen sie aus Ihrer Geheimwelt heraustreten. Entweder werden sie mit der neuen Kraft verhandeln oder sie werden sie bekämpfen. Denn, Hochmut ist die Ferse des Achilleus von vielen Mächtigen, sie können einfach keinen Zweiten neben sich dulden!“
Claudius wandte sich an Johannes: „Was sagst Du dazu?“ Johannes verblüffte die anderen mit seiner Ruhe, denn er sagte: „Als Rom gegen die Parther kämpfte, war Rom ihnen zu Beginn oft unterlegen, weil die Parther berittene Bogenschützen hatten. Als Rom ihre Taktiken übernahm, konnte Rom den Parthern standhalten.“
„Wie wollen wir diese Gedanken in die Tat umsetzen?“ Fragte Claudius und wieder antwortete Johannes: „Der Mann aus Rom, der die Geheimsprachen versteht, muss die Schriften des Simon für uns übersetzen. Wir müssen sein, wie sie. Wir müssen geheime Zeichen setzen, wie sie.“
„Wie soll das praktisch aussehen?“ Fragte Claudius. Diesmal antwortete Bezalel: „Wir schlüpfen in die Rollen der Menschen dieser neuen Untergrundorganisation und ziehen wie die Anderen umher. Dabei orientieren wir uns an der Karte des Jeschua. Wir tragen die Kleidung der Aramäer, sprechen wie Aramäer, handeln wie Aramäer, leben und arbeiten wie Aramäer. Wir brauchen aber noch eine glaubhafte Botschaft.“
„Ich werde sie Euch sagen,“ sagte Jeschua und, „wir benötigen jedoch die Zustimmung der Weisen aus Nazaret, dass Johannes und ich vorübergehend andere Aufgaben übernehmen, als ursprünglich besprochen.“ Dann sagte Claudius: „Wie es scheint, haben wir einen Gedanken. Jetzt brauchen wir einen Architekten, der den Gedanken abschätzt und ihn auf einen Papyrus bringt. Dann werden wir sehen, wie sich daraus ein Gebäude bauen lässt.“
Sie nickten und alle waren müde. Bezalel ging zu seinem Haus, die anderen schlafen.