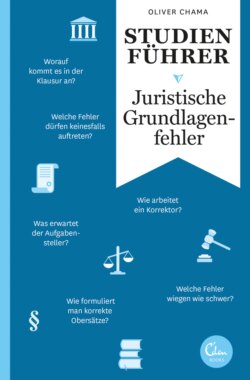Читать книгу Studienführer Juristische Grundlagenfehler - Oliver Chama - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. KAPITEL: BEWERTUNGSKRITERIEN JURISTISCHER KLAUSUREN
ОглавлениеDie Bewertung juristischer Klausuren beruht in der Regel auf drei elementaren Kriterien: Inhalt, Aufbau und Stil.
Inhaltlich muss eine Klausur erkennen lassen, dass ihr Verfasser sich mit dem Sachverhalt und den sich daraus ergebenen Rechtsfragen auseinandergesetzt und dabei das Recht mit Verständnis angewendet hat. Eine inhaltlich gelungene Klausur zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie nicht nur die bloße Behauptung von Rechtsfolgen enthält, sondern solche Behauptungen auch begründet werden. Dabei steigen die Anforderungen an die Qualität der Begründung mit der Bedeutung der jeweiligen Rechtsfrage für den konkreten Sachverhalt. Je wichtiger, d. h. entscheidender für die Beurteilung des jeweiligen Sachverhalts, eine bestimmte Rechtsfrage ist, desto umfassender und vertiefter muss die argumentative Auseinandersetzung mit dieser Rechtsfrage erfolgen. Umgekehrt zeigt der Bearbeiter mit einer Kurzbegründung bei weniger relevanten Rechtsfragen auch, dass er Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden kann. Eine gelungene Schwerpunktsetzung ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium für die inhaltliche Qualität einer Klausur. Wenn zu einer wichtigen Rechtsfrage viel geschrieben wird, kann es sein, dass das Geschriebene zwar inhaltlich nicht überzeugend ist, der Verfasser aber immerhin erkannt hat, dass das Problem so wichtig ist, dass ihm im Gutachten eine entsprechende Bedeutung beizumessen ist. Dies hat der Korrektor bei der Bewertung der Arbeit unbedingt zu berücksichtigen.
Der Aufbau einer Klausur muss zumindest nachvollziehbar sein. Regelmäßig setzt dies einen Aufbau entsprechend der gesetzlichen Systematik voraus. Wichtig ist vor allem, dass sich der Aufbau immer selbst erklärt. Ein Aufbau, der vom Klausurverfasser im Gutachten erklärt wird, dürfte misslungen sein. Das Bewertungskriterium »Aufbau« ist untrennbar mit dem Inhalt der Arbeit verbunden. Die Qualität des Inhalts wird oft durch die Qualität des Aufbaus beeinflusst. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass Klausuren häufig inhaltlich richtige Ausführungen enthalten, diese aber im Aufbau völlig falsch verortet werden. Die Verortung an der falschen Stelle kann im Extremfall dazu führen, dass die inhaltlich an sich gelungenen Ausführungen völlig entwertet werden. Der Aufbau kann so gewissermaßen den Inhalt zerstören. Dies dürfte vor allem dann der Fall sein, wenn der falsche Aufbau zeigt, dass der Klausurverfasser den Sinn und die Bedeutung seiner Ausführungen und die zugrunde liegende Gesetzessystematik selbst nicht verstanden hat.
Der Stil der Klausur muss den Anforderungen an ein juristisches Gutachten entsprechen. Der Gutachtenstil zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst eine Hypothese aufgestellt wird. Dann wird festgelegt, an welchen Kriterien sich die Richtigkeit dieser Hypothese messen lassen muss (Gesetz oder Definition). Anschließend erfolgt die Subsumtion. Diese ist der gehaltvollste Teil der Prüfung, denn hier wird der Sachverhalt anhand des oben genannten Kriteriums überprüft und festgestellt, ob er das Kriterium erfüllt oder nicht. Abschließend erfolgt die Konklusion, also die Feststellung, ob die Subsumtion im Ergebnis zur Verifizierung der Hypothese geführt hat oder nicht. Nicht bei allen Aspekten des Falles ist eine derartige Prüfung im Gutachtenstil geboten. Bei weniger problematischen Aspekten ist eine Prüfung im Urteilsstil angezeigt. Hierbei wird zuerst das Ergebnis behauptet. Dann wird dieses Ergebnis begründet, indem gezeigt wird, dass der Sachverhalt sich unter das Gesetz bzw. eine Definition subsumieren lässt. Irrelevante oder völlig unproblematische Aspekte sind im sogenannten »Feststellungsstil« lediglich kurz begründet festzustellen. Unbedingt zu vermeiden ist stets der sogenannte »Märchenstil«. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass lediglich der Sachverhalt nacherzählt wird und zwischendurch Gesetzeszitate oder einzelne rechtliche Wertungen einfließen. An manchen juristischen Fakultäten wird von den Studierenden in den ersten Semestern erwartet, dass sie immer und ohne Ausnahme ihre gesamte Klausur im Gutachtenstil schreiben. Auch völlig unproblematische Aspekte sollen demnach gutachtlich geprüft werden. Diese Praxis ist jedoch äußerst bedenklich, denn so erlernt der Studierende gleich zu Beginn seiner Ausbildung etwas als richtig, das ihm spätestens nach der Zwischenprüfung von den Korrektoren als falsch angelastet werden wird, nämlich die blinde Anwendung des Gutachtenstils auch bei unproblematischen Aspekten. Ein solches Vorgehen zeugt nicht davon, dass der Verfasser Wesentliches von Unwesentlichem unterschieden kann, denn diese Fähigkeit zeigt sich vor allem daran, dass man sich bei unproblematischen Aspekten kurz fasst. Der Gutachtenstil lässt aber ein Sich-kurz-Fassen kaum zu. Daher ist auch Studierenden in den ersten Semestern dringend zu raten, so früh wie möglich zu lernen, zwischen Gutachten- und Urteilsstil zu wechseln und diese Fähigkeit auch in den Klausuren anzuwenden.