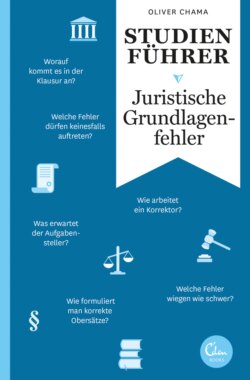Читать книгу Studienführer Juristische Grundlagenfehler - Oliver Chama - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. KAPITEL: WAS IST EIN FEHLER UND WAS NUR NICHT VERTRETBAR?
ОглавлениеAls Korrektor sieht man sich immer wieder mit Klausurausführungen konfrontiert, die nicht dem entsprechen, was man selbst aufgrund der »Musterlösung« und der eigenen juristischen Ausbildung und Erfahrung für richtig hält. Dann stellt sich die Frage, ob ein echter Fehler vorliegt oder ob es sich »nur« um Ausführungen handelt, die nicht vertretbar sind. Ein Fehler wiegt regelmäßig schwerer als eine Behauptung, die lediglich nicht vertretbar ist. Um diese beiden Kategorien zu unterscheiden, muss zunächst zwischen gesetzesbezogenen Ausführungen und sachverhaltsbezogenen Ausführungen unterschieden werden.
Sachverhaltsbezogene Ausführungen sind solche, die sich im Gutachten auf der Subsumtionsebene finden. Wenn geprüft wird, ob eine Sache fremd im Sinne von § 242 StGB ist, muss hierzu die entsprechende Sachverhaltsinformation über die Eigentumslage (bspw. »das Buch des A«) herangezogen werden. Wenn insoweit eine Information subsumiert wird, die so im Sachverhalt gar nicht gegeben wird (»das Buch des B«), liegt ein Fehler bei der Sachverhaltsanwendung vor. Solche Fehler wiegen regelmäßig schwer, weil der Prüfer als Grundvoraussetzung für das Gelingen einer Klausur von deren Bearbeitern verlangen darf, dass diese den Sachverhalt richtig lesen und nichts subsumieren, was (so) im Sachverhalt nicht steht. Nur sehr selten sind Sachverhalte vom Aufgabensteller so schlecht konzipiert, dass dem Klausurbearbeiter ein Interpretationsspielraum bleibt, innerhalb dessen er dann den Sachverhalt nach seinem Ermessen strecken und stauchen kann, um entsprechendes Subsumtionsmaterial zu gewinnen. Nur insoweit kann es zu der Frage kommen, ob eine entsprechende Sachverhaltsdeutung vertretbar ist oder nicht. Bei gut gestellten (»klaren«) Sachverhalten stellt sich diese Frage nicht.
Bei gesetzesbezogenen Ausführungen liegt ein Fehler dann vor, wenn Ausführungen nicht mit dem Gesetz vereinbar sind. Die Frage der Vereinbarkeit ist im Einzelfall anhand des Wortlauts, der Systematik, der Entstehungsgeschichte und des Telos des Gesetzes zu beantworten. Wenn beispielsweise ein Klausurbearbeiter behauptet, der Zugang der Willenserklärung beim Minderjährigen nach § 130 Abs. 1 BGB bewirke die Wirksamkeit der Willenserklärung, liegt er falsch. Nach § 131 Abs. 2 BGB erfordert nämlich die Wirksamkeit der Willenserklärung gegenüber einem Minderjährigen den Zugang bei seinem gesetzlichen Vertreter. Hier wurde also das Gesetz verkannt. Die erstgenannte Behauptung ist mit dem Gesetz (§ 131 Abs. 2 BGB) nicht vereinbar und daher falsch.
Anders verhält es sich bspw. mit der Behauptung, Bundespräsident könne man höchstens für zehn Jahre sein. Nach Art. 54 Abs. 2 S. 2 GG ist eine »anschließende« Wiederwahl nach der fünfjährigen Amtszeit nur einmal zulässig. Es spricht vom Wortlaut des Gesetzes her also nichts dagegen, dass jemand als Bundespräsident zehn Jahre im Amt ist, sodann ein anderer Kandidat das Amt übernimmt und schon nach dessen Rücktritt kurze Zeit später der vorherige Kandidat seine insgesamt dritte Amtszeit antritt. Dennoch liegt hier kein Fehler vor, wenn man behauptet, es könne höchstens zwei Amtsperioden mit demselben Amtswalter geben. Denn mit der Feststellung, der Wortlaut des Gesetzes lasse eine dritte Amtszeit des identischen Bundespräsidenten zu, ist es nicht getan. Im Hinblick auf die schlechten Erfahrungen mit dem Reichspräsidenten Hindenburg in der Weimarer Republik kann durchaus angenommen werden, Telos, Systematik und Entstehungsgeschichte des Art. 54 Abs. 2 GG gebieten eine möglichst geringe Machtkontinuität. Dem Wörtchen »anschließende« könne daher keine überragende Bedeutung zukommen. So kann durchaus vertretbar behauptet werden, nach zehn Jahren Amtszeit sei für denselben Kandidaten keine weitere Amtszeit mehr möglich. Dies kann jedenfalls anhand des Gesetzes begründet werden. Wenn die Begründung hierfür argumentativ gestützt und folgerichtig ist, ist diese Auffassung daher durchaus vertretbar. Wenn allerdings schon die Begründung das Gesetz verkennt oder fehlerhaft anwendet, ist diese Begründung falsch und das damit gefundene Ergebnis so nicht vertretbar.
Wer etwa behauptet, eine Strafbarkeit bei Schuldunfähigkeit sei kategorisch ausgeschlossen und die Rechtsfigur der alic (actio libera in causa) sei komplett abzulehnen, bewegt sich zwar gegen die herrschende Meinung, dennoch kann diese Behauptung ohne Weiteres mit dem verfassungsrechtlich fundierten Grundsatz nulla poena sine lege vertretbar begründet werden. Wer dasselbe mit dem Erlaubnistatbestandsirrtum versucht, wird größere Probleme haben. Dessen kategorische Ablehnung in der Klausur folgerichtig zu begründen, dürfte so aufwendig sein, dass es kaum gelingen wird. Dennoch läge kein »echter« Fehler vor, da die Ablehnung des Erlaubnistatbestandsirrtums in Ermangelung einer entsprechenden gesetzlichen Regelung nicht gegen das Gesetz verstoßen dürfte.
Wenn die Begründung argumentativ gestützt ist und folgerichtig das Ergebnis herleitet, darf der Prüfer das Ergebnis keinesfalls als falsch ansehen, selbst wenn die »Musterlösung«, er selbst, das BVerfG und Professor XY es anders sehen als der Klausurbearbeiter.
Die Grenzen zwischen einem Fehler und dem Nichtvertretbaren sind freilich fließend. Je besser die Begründung einer rechtlichen Behauptung ist, desto geringer die Gefahr, dass der Prüfer von einem Fehler ausgehen kann.