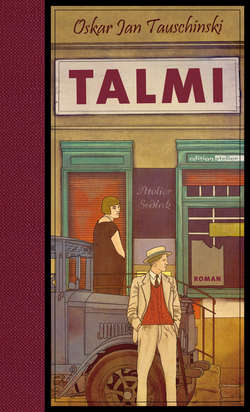Читать книгу Talmi - Oskar Jan Tauschinski - Страница 7
TRAVIATA SINGT FÜR SPORTLICHE JUGEND
Оглавление(Susannens Aufzeichnungen vom 12. März 1945)
Wie glücklich bin ich über die Petroleumlampe, die mir Margot verschafft hat!
So weit haben wir es im Zeitalter der Technik gebracht, daß man sich heute in einer Zweimillionenstadt nur helfen kann, wenn man im Hof einen Brunnen und daheim einen altmodischen Kohlenherd besitzt. Wer überdies noch genügend Petroleum zum Leuchten hat, muß mit dem Neid der Nachbarn rechnen. Die elektrischen Lüster, die Gas- und Badeöfen, die Wasserleitungshähne und Radioapparate sind verkümmerte Organe im Wohnungskörper geworden – müßige Zeugen der Vergangenheit, Staubfänger, ebenso nutzlos wie die Makartbuketts und Streusanddosen unserer Großmütter.
Zwar stinkt meine Lampe höllisch und blakt wie ein Fabrikschlot, aber sie leuchtet doch auch, und ich kann im verdunkelten Zimmer vor meinem Schreibblock sitzen und an dich denken, Ernstl, anstatt mich im Finstern schlaflos auf dem Diwan herumzuwälzen und nur Gedanken über ein ungewisses Morgen und ein unwahrscheinliches Demnächst wiederzukäuen.
Was nützt es, daß der Krieg zu Ende geht? Wird man denn seine letzten Phasen überstehen? In längstens vier Wochen beginnt bei uns das, was Warschau und Budapest schon hinter sich haben. Warum sollte für Wien eine Ausnahme gemacht werden? Aber, mein Gott, vier Wochen! Vielleicht sorge ich mich da um eine Zukunft, die ich gar nicht mehr erleben werde.
Nur die Vergangenheit ist fester Boden, auf dem der Fuß nicht strauchelt, und darüber hat die Erinnerung einen soliden Laufteppich gelegt, breit oder schmal, bunt durchwirkt oder grau, aber wohlbekannt und vertraut, denn wir haben ihn ja aus eigenen Erlebnissen geknüpft.
Der meine ist weder farbenfroh noch breit, obwohl ich mein Leben lang bemüht war, ihn möglichst »kunstgewerblich« zu gestalten. Einem einsamen Krüppel stehen nicht viele bunte Fäden zur Verfügung. Alles, was rot und leuchtend daran ist, stammt von dir, Ernstl! Vielerlei Farben hast du für meinen Teppich geliefert, wohltuende und grelle, aber zum Schluß hast du das Muster heillos verwirrt.
Drei Jahre liegt dein Tod nun zurück, und ich grüble seither ununterbrochen darüber nach, ob es so hat kommen müssen. Vergeblich mühe ich mich, Logik in dieser wüsten Ungereimtheit zu finden, die du dein Leben nanntest, und denke oft, daß ich dich wohl nicht gut genug gekannt habe. Aber wer hat sich so viel mit dir beschäftigt wie ich? Wer hat jedes deiner Worte auf die Waagschale gelegt, jede deiner Taten und Untaten so genau registriert und kommentiert? Beinahe hätte ich jetzt geschrieben: Wer hat dich so geliebt? Aber das wäre falsch und unwahr. Nein, nein, geliebt habe ich dich nie! So viel Selbstachtung und Vernunft habe ich doch immer aufgebracht. – Da zeigt es sich schon, wie vorsichtig man beim Schreiben sein muß. Das Papier verleitet zur Übertreibung. Und dabei setze ich mich doch gerade darum zum Schreibtisch, um schwarz auf weiß die objektive Wahrheit niederzulegen. Das hier sollen nicht meine Memoiren werden, sondern nur Tagebuchblätter, die dich und dein vertanes Leben betreffen. Wenn erst dein Dasein in Worte und Schriftzüge gebannt vor mir liegt, werde ich vielleicht erkennen, warum es so mit dir gekommen ist, warum alle Gunst des Schicksals und alle Gaben der Natur an dir verschwendet waren. Vielleicht aber – und dies ist der Hauptzweck meiner Arbeit – gelingt es mir, nachzuweisen, daß du ganz bestimmt unschuldig warst an Schwester Josefas folgenschwerem Unfall und daß dein eigener Tod eine Verkettung tragischer Zufälle und nicht die Verzweiflungstat eines Verantwortungslosen gewesen ist.
Heute ist mir dieser Gedanke gekommen, als ich am Abend vor der brennenden Oper stand. Und während ich nun hier sitze, verglosen vielleicht die Sessel, auf denen wir damals saßen – damals, vor zwanzig Jahren, als wir einander kennenlernten. Wahrscheinlich gibt es bald überhaupt keine stummen Zeugen unseres Lebens mehr. Dies Zimmer hier, in dem du so oft saßest, ist vielleicht morgen von einer Bombe zerschlagen. Schon jetzt scheint es mir fremd und kahl, weil Margot die Vorhänge, die wir zusammen ausgewählt haben, die Bilder, die du so liebtest, die Bücher, deren Menge dich so beeindruckte, in den Keller geräumt hat.
Der Mantel, in dem ich fröstelnd sitze, ist voll Ruß und riecht nach Rauch. Kein Wunder. Es schneite ja dicke, glühende Flocken wie bei einem feurigen Schneegestöber. Ich stand in der verlängerten Kärntnerstraße, dicht hinter einer Kette von Polizisten; neben mir wortlose Menschen mit rot überflackerten Gesichtern und Pupillen, in deren Dunkel sich die lodernde Feuersäule des Heinrichshofes beweglich spiegelte. Woran mochten sie alle denken, meine lieben Kompatrioten, die damals so begeistert »Heil!« gerufen hatten, als diese Krankheit begann, deren letzten Phasen sie nun beiwohnen? – Ach, Ernstl, auch du hast »Heil!« gerufen, du Narr!
Vom Karlsplatz her wehte uns eisiger Nebelwind in den Rücken, aber die Gesichter glühten von der Brandhitze. Es war wie ein gigantisches Kaminfeuer in einem kalten, finsteren Saal.
Alles erinnert an dich, Ernst!! Unsere Oper brennt; wo die Tische deines »Café Heinrichshof« standen, fallen jetzt glühende Balken auf das Pflaster. Überall bist du, und dabei bist du längst nirgendmehr – drei Jahre nach deinem tödlichen Unfall.
Oder irre ich? War es doch kein Unfall?
Ich weiß es nicht; aber vielleicht werde ich es wissen, wenn alles genau aufgeschrieben vor mir stehen wird. Wie war das doch damals, bei jener Traviata-Aufführung im März 1925? – Ach, wie kalt es ist! Ich muß mir die Füße in eine Decke wickeln …
Wieder einmal stand ich im Stehparterre ziemlich weit vorne, aber doch leider nicht an der Brüstung, und wartete auf den Beginn der Vorstellung. Wie freute ich mich auf die Ouvertüre, die gleich ertönen sollte, mit ihrem tränenfeuchten Geigengesang, der später von einer festlich getragenen Tanzweise abgelöst wird und der, vor dem vierten Akt nochmals angestimmt, in das hoffnungslose Schluchzen einer Todgezeichneten ausklingt. Damals liebte ich dies Werk um seiner selbst willen. Heute kann ich es nicht hören, ohne daß sehr persönliche, mein eigenes Leben und Erleben betreffende Erinnerungen in mir wach werden.
Neben mir stand eine schöne blonde Person von ebenmäßigem Wuchs und selbstgefällig törichtem Gesicht, das trotz der frühen Jahreszeit tief gebräunt war. Allem Anschein nach kam sie gerade von einem Skiurlaub im Gebirge. Sie schien mit ihrem Äußeren durchaus zufrieden. Das neue geblumte Kleid und die Frisur taten ihre Schuldigkeit. Auch hätte sie keinen günstigeren Standort für ihre Schönheit wählen können als neben mir, obwohl sie sicherlich nur von dem Wunsch, gut zu sehen und zu hören, beseelt, so rasch nach vorne geeilt war. Auf mich wurde sie ohne Zweifel erst aufmerksam, nachdem sie die noch fast leeren Logenreihen und das Parkett einer genauen Musterung unterzogen hatte.
Der Lokalaugenschein war zu ihrer vollsten Zufriedenheit ausgefallen. In einer der Parterrelogen, der zweiten oder dritten von uns aus, hatte ein junger Mann Platz genommen, der seinerseits das Opernglas über die Köpfe der dicht gedrängten Stehplätzler streifen ließ, wobei er sichtlich beim Anblick meiner hübschen Nachbarin verweilte. Er mußte noch sehr jung sein, vielleicht ein Student im ersten oder zweiten Hochschuljahr. Die Art, wie er sein Glas handhabte, wie er den Kopf langsam hin und her wandte, während die Linke lässig über den Logenrand hing, hatte etwas vollendet Graziöses – fast zu Graziöses für einen jungen Burschen, der noch dazu recht breitschultrig und muskulös aussah und einen kurzen, sehnigen Hals hatte. Besonders im Profil kam die Kräftigkeit dieses Halses zur Geltung, der vom Kleinhirn abwärts in gerader, harter Linie in den Kragen hinablief. – Dies wird einmal ein Stiernacken werden, mußte ich unwillkürlich denken. Vorläufig war es noch ein entzückender Stierkalbnacken.
Nun hob der junge Logeninsasse in scheinbarer Kurzsichtigkeit das Programm nahe vors Gesicht. Er hielt das Heft in den großen, sehr weißen und langfingrigen Händen mit einer Behutsamkeit, die eines kostbaren Pergamentes wohl würdig gewesen wäre, und tat, als sei er in die Lektüre vertieft. Aber seine Augen glitten immer wieder zerstreut vom Papier fort und zu uns herüber; und dies war verständlich.
Meine Nachbarin war zusehends schlanker und größer geworden. In ihre sonnengebräunten Wangen stieg bezaubernde Röte und ließ mich an eine reife, sommerwarme Marille denken. Auch sie schien ihr Textbuch auswendig lernen zu wollen; dazwischen fand sie Zeit, hie und da ihre Locken ordnend aus der Stirn zu streifen oder an ihrem Kleid herumzunesteln. Nur ganz selten und mit völlig beherrschter Teilnahmslosigkeit sah sie sich im Zuschauerraum um, und wenn ihr Blick dann gelegentlich die dritte Loge links streifte, so verweilte er dort kaum einen Augenaufschlag länger als bei den übrigen.
Es mußte knapp vor Beginn der Vorstellung sein. Der Saal, der lange leer geblieben war, hatte sich plötzlich sehr rasch gefüllt. Immer mehr Abendkleider und Smokings wurden in den vorderen Sitzreihen sichtbar, immer mehr Boutons, Broschen und Brillantanhänger leuchteten aus dem Dunkelrot der Logen. Das Stimmengewirr der präludierenden Instrumente war jetzt von dem der schwatzenden Zuschauer fast ganz überdeckt. Im Stehparterre stand man Kopf an Kopf. Da hörte ich plötzlich unweit hinter mir eine sehr höfliche, gleichsam höfisch gezierte Baritonstimme vielerlei Entschuldigungsfloskeln fast pausenlos hintereinander hersagen. Das unwillige Murmeln der Stehenden, die beiseite traten, wirkte nur wie eine Geräuschkulisse, von der sich die klar skandierten Silben des »Verzeihen Sie bitte«, »Nur einen Augenblick …«, »Entschuldigen Sie«, »Ich nehme Ihnen Ihren Platz durchaus nicht weg«, »Ich möchte nur …«, »O pardon …« deutlich abzeichneten.
Als wir uns umdrehten – die »Marille« und ich –, stand der Besitzer des höfischen Baritons schon vor uns. Er machte eine vollendete Verneigung – ganz so, wie man sie den jungen Leuten damals in der Tanzstunde beibrachte –, indem er zuerst nur den sehr hellen Kopf im Stierkalbnakken, dann aber ganz leicht auch die Schultern beugte, und sagte mit der gezierten Anmut eines schüchternen Liebhabers auf dem Theater:
»Wollen Sie mich, bitte, nicht für zudringlich halten, aber ich habe zwei Logensitze … Der Platz neben mir bleibt leer. Ich sehe Sie hier im Gedränge stehen … Darf ich Ihnen die zweite Karte geben?«
Zu wem sprach er? – Doch wohl zu der sonnengoldenen Sportlerin. Aber er sah mich dabei an, streckte die große Hand aus und reichte die Eintrittskarte – wem reichte er sie? – mir.
Ich war bis zu diesem Augenblick ausschließlich Zuschauerin bei dem uneingestandenen Flirt gewesen, und nun fand ich gar keine Zeit, um selbst in die Rolle zu schlüpfen, die ich der Marille zugeschrieben hatte. Ich nahm also die Einladung mit der gleichen Selbstverständlichkeit an, mit der ich mir in der Straßenbahn Platz machen ließ. Zu sitzen, wenn andere standen, war das Recht der Körperbehinderten – eines der wenigen Rechte, gemessen an den vielen Pflichten, die mir mein krummer Rücken auferlegte. Unbefangen machte ich von diesem Recht Gebrauch. Ehe ich Zeit fand nachzudenken, ob ich das Richtige tat, hatte ich schon mechanisch »Oh, besten Dank, sehr liebenswürdig!« gesagt und schickte mich an, ihm zu folgen. Da fing ich noch einen eigenartigen, etwas verlegenen und doch auch wieder triumphierenden Blick auf, den der muskulöse Jüngling mit den Allüren eines altmodischen Schwerenöters zu meiner schönen Nachbarin gleiten ließ. Was dieser Blick bedeuten sollte, konnte ich in der Eile nicht bestimmen. Es fiel mir nur auf, daß bei der raschen Bewegung seiner Augen das linke um den Bruchteil einer Sekunde hinter dem rechten zurückblieb. Bei ungenauem Hinschauen hätte man diese merkwürdige Trägheit des linken Auges für ein Schielen halten können, das jedoch sofort verschwand, als der Blick des jungen Mannes wieder auf mir ruhte. Übrigens war im Moment keine Zeit, darüber nachzudenken, denn wir hatten alle Mühe, uns durch die Menge zurück und zum Ausgang zu drängen. Dann ging es eilig treppab, treppauf und durch mehrere Korridore. Als wir die Loge betraten, war das Licht im Saal gerade erloschen, und ehe wir im Dunkeln unsere Plätze gefunden hatten, setzte das leise Schluchzen der Primgeigen ein.
Ich hatte im ersten Augenblick also weder Zeit noch Lust, mir Gedanken darüber zu machen, was geschehen war. Erst nach der Ouvertüre, als der Vorhang aufging und die Ensembleszenen in Violettas Heim begannen, gönnte ich mir einen Blick zur Seite. Mein jugendlicher Wohltäter, der während des Vorspiels auf seinem Platz herumgewetzt hatte, saß nun wie hypnotisiert da. Mit seinem Opernglas – einer altmodischen Damenlorgnette aus Elfenbein – fixierte er jeden Auftritt, jede Verbeugung, jeden Handkuß auf der Bühne. Ob er auch die Musik hörte, weiß ich nicht; jedenfalls genoß er die Vorstellung mit allen Sinnen. Sein weiches, stark gelocktes, sehr blondes Haar, das fast wie entfärbt wirkte, fiel ihm ins Gesicht, aber er war von den gesellschaftlichen Ereignissen im Hause der Kameliendame dermaßen in Anspruch genommen, daß er vergaß, es aus der Stirn zu streichen.
Seine linke Hand lag auf der Logenbrüstung dicht vor mir, und ich hatte Muße, sie zu betrachten. Sie war groß, weiß und langfingrig – eigentlich war sie etwas zu schön für eine Männerhand. Dabei hatte sie nichts Vornehmes, Intellektuelles oder seelisch Verfeinertes, wie sie da hell schimmernd auf dem dunklen Plüsch lag. Im Gegenteil, die Vorstellung lag nahe, daß sie flink und sicher zupacken könne. Das breite Gelenk verstärkte diesen Eindruck noch, um so mehr, als die Armbanduhr, die es trug, wiederum klein und für einen Mann fast zu zierlich war.
»Von der Freude Blumenkränzen sei mein Leben heiter durchzogen … Jeder Abend soll mich finden, wo die Lust mich taumelnd umfängt …«, sang Violetta, und ihr energisches, fleischiges Gesicht, das zugleich intelligent und hochmütig war, strafte sie Lügen. Aber wie sollte man aussehen, um solchen Unsinn singend zu rechtfertigen? Stimmlich war die Frau – eine rumänische Gastsängerin mit kompliziertem Doppelnamen – übrigens ganz hervorragend, und der Beifall, den sie nach der Arie erntete, dementsprechend stark.
Als der Applaus einsetzte, lief es wie ein Ruck durch die Gestalt meines jungen Nachbarn, der bis dahin die Sängerin ununterbrochen beobachtet hatte. Mit einem Ausdruck, als wolle er sagen: »Ach ja, natürlich …«, legte er den Operngucker zur Seite und begann selbst geräuschvoll zu klatschen.
In der Pause wandte er sich dann mit überaus liebenswürdigem Lächeln zu mir und sagte:
»Oh, verzeihen Sie, es war sehr, sehr unartig von mir! Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.« Dabei ergriff er meine Hand mit einer etwas zu familiären Selbstverständlichkeit und küßte sie, indem er einen Namen murmelte, der wie Ronalik oder Ronecek klang. Der Handkuß selbst war ihm jedoch wiederum vollkommen gelungen. Der blonde Kopf hatte sich dabei tief hinabgeneigt, und die Lippen streiften meinen rauhen Handrücken, als gelte der Kuß einem Heiligtum.
Ich sagte: »Sedlak. Sehr angenehm …« und fühlte, daß er meinen Namen ebenfalls nicht auffaßte. Er würde ihn wohl auch nicht verstanden haben, wenn ich ihn buchstabiert hätte, denn sein Blick war wieder zum Stehparterre hinabgeglitten, wobei das linke Auge sich um den Bruchteil einer Sekunde verspätete. Die schlanke Skiläuferin gönnte uns jedoch keinen Blick mehr. Sie schien überhaupt nur noch einen Rücken zu haben.
Der junge Herr neben mir sprach unausgesetzt. Er deutete auf die Logen und nannte die Namen mehrerer Insassen. Es waren wohlbekannte, adelige Namen, mitunter auch die von Großindustriellen, Bankiers und Regierungsmitgliedern. Er schien die Leute alle – wenigstens vom Sehen – zu kennen und sprach von ihnen mit ungezwungener Lässigkeit wie von Gleichgestellten. Was er sagte, war weiter nicht bemerkenswert, nur wie er es tat, beschäftigte mich ein wenig. Es war ausgesprochener Dialekt, dessen er sich bediente, aber in jener verweichlichten, verzärtelten, nasalen Betonung, wie ihn Schauspieler benützen, wenn sie altösterreichische Aristokraten darstellen. Einer ungeschriebenen Bühnenkonvention zufolge schien man in den »höheren Kreisen« so zu reden. Ich konnte damals nicht beurteilen, inwiefern dies den Tatsachen entsprach. Die wenigen Aristokraten, die ich vom Geschäft her flüchtig kannte, bemühten sich alle, möglichst ungezwungen, sportlich und amerikanisch zu wirken, um nicht in den Verdacht zu kommen, mit dem Grafen Bobby der Anekdote verwandt zu sein.
Mein junger Gastgeber war sich dieses Gefahrenmomentes sichtlich nicht bewußt. Seine breitschultrige, knabenhafte und doch schon gedrungene Sportlerfigur wirkte amerikanisch genug. Er konnte also in Gebärde und Sprache ruhig die Merkmale seiner Kaste zur Schau tragen. Denn daß es sich bei ihm um einen Angehörigen der oberen Zehntausend handelte, stand für mich nun schon fest. Auch die wesentlich gröbere rechte Hand, die ich jetzt im vollen Lampenlicht sah, konnte an dieser Meinung nichts mehr ändern. Die beiden abgebrochenen Nägel daran und die tiefen Rillen am Daumen und Zeigefinger, aus denen trotz sorgfältiger Maniküre nicht aller Schmutz zu entfernen gewesen war, deuteten darauf hin, daß der junge Mann wohl ein Motorrad, wenn nicht gar ein Kabriolett sein eigen nannte.
Inzwischen war Traviata wieder zu Wort gekommen. Die robuste Bukaresterin mit den fleischigen Zügen opferte zuerst ihren Schmuck für den Aufwand ihres Alfredo und dann ihre Liebe selbst, um seiner unbekannten Schwester zum Eheglück zu verhelfen. Schließlich war sie, um ihren Schmerz zu betäuben, zu einem »glanzvollen Freudenfest« geeilt und dort von dem übelberatenen Geliebten eine Dirne gescholten worden. Ja, Alfred hatte sich so weit vergessen, ihr das soeben im Kartenspiel gewonnene Geld vor die Füße zu werfen. Was blieb also einer Frau vom Format der Kameliendame übrig, als an Schwindsucht zu sterben?
Die massige Rumänin saß nun in ihrem Lehnsessel. Das große, intellektuelle Gesicht war weiß gepudert, und das rosaseidene Nachtgewand mit den Spitzen paßte schlecht zu ihren lebensvollen und zielbewußten Bewegungen. Es gehörte viel guter Wille dazu, um zu glauben, daß sie der Auszehrung zum Opfer gefallen war. Aber in ihrer Gesangskunst wurde sie dem Part gerecht. Wenn man die Augen schloß und über die verlogenen deutschen Worte hinweg den so ganz wahrhaftigen italienischen Tönen lauschte, dann wußte man um den Schmerz dieses einsamen Sterbens, um den Hoffnungsstrahl beim Anblick des reumütigen Geliebten, um die Euphorie, die dem plötzlichen Tod vorangeht.
Ein leises Zucken neben mir ließ mich die Lider auftun. Da saß mein Nachbar, hielt den Gucker vor die Augen, und während er aufmerksam die Gebärden der dahinsiechenden Traviata verfolgte, liefen ihm Tränen über das Gesicht.
Alles hatte ich eher erwartet als dies. Es würde mich nicht erstaunt haben, wenn er, um so recht up to date zu erscheinen, über die schwindsüchtige Karyatide spöttelnde Bemerkungen gemacht oder, ermüdet von der langen Aufführung, wohlerzogen gegähnt hätte. Aber so unverhohlene Tränen bei einem Sportsmann? – Meine Gefühle waren zwiegeteilt. Einerseits rührte es mich, daß seine junge Seele so beeindruckbar war, daß sie die Gabe hatte, sich hinreißen zu lassen, mitzugehen. Ich mußte ihm doch wohl unrecht getan haben, als ich ihn für oberflächlich und banal hielt. Wenn er das sentimentale Libretto und die vollendet interpretierte Musik nicht genau auseinanderzuhalten wußte, so lag das vielleicht nur an seiner Jugend. Aber anderseits war es auch wieder befremdlich, zu sehen, daß er gar keine Anstalten traf, seiner Rührung Herr zu werden. Auch als der Vorhang fiel und es hell wurde, zog er nicht sein Taschentuch hervor, sondern ließ die letzten Tränen unbekümmert auf seinen Wangen trocknen. Das Weinen hatte ihn auch nicht – wie zu erwarten gewesen – zum Kinde gemacht. Wie er so dastand, heftig applaudierend, wirkte sein Gesicht mit den stark geröteten Augen und den leicht geschwollenen Unterlidern, die zukünftige Tränensäcke ahnen ließen, wie das einer nicht mehr ganz jungen Frau. Übrigens schien er meinen Blick zu fühlen, denn er richtete wieder einmal mit gewandter Bühnenweltmannsgeste das Wort an mich:
»Ich habe vergessen, Ihre Garderobe in der Pause auszulösen und hierher zu bringen. Sind Sie mir böse deswegen?«
Ich stammelte etwas wie »Durchaus nicht!« und »Ich hol’ mir schon meinen Mantel«, aber er wollte nichts davon hören.
»Sie erlauben doch, Gnädigste, daß ich Sie auch heimgeleite, wenn Sie mir schon die Freude Ihrer Gesellschaft gemacht haben«, sagte er, und ehe ich Zeit fand, die romanhafte Unnatürlichkeit dieses Satzes zu erfassen, gingen wir schon über Treppen und Gänge der Stehparterre-Garderobe zu. Im Gehen summte, ja sang mein Begleiter halblaut die Duettmelodie des letzten Aktes, während er in seinen hellen Überzieher schlüpfte.
Bei der Kleiderausgabe herrschte arges Gedränge. Er nahm mir den Nummernzettel aus der Hand und stürzte sich ein wenig zu temperamentvoll in den Menschenknäuel. Ich stand wartend neben dem Spiegel. Jemand gebärdete sich so unbekümmert beim Ankleiden, daß ich einen heftigen Stoß in den Rücken abbekam. Unwillig sah ich mich um. Es war die Marille, die jedoch keine Anstalten traf, sich zu entschuldigen. Der Blick, der dem meinen begegnete, war zu zornig, um so verächtlich auszufallen, wie er gemeint war. Das nützt dir alles nichts, schienen die Augen der jungen Frau zu sagen, du hast ja doch einen Bukkel! – Dumme Gans, mußte ich meinerseits denken. Selten hat mir mein Buckel so gute Dienste geleistet. Wie müde wäre ich jetzt, hätte ich wie sonst drei Stunden lang auf den Zehenspitzen stehen müssen, um über so gerade Schultern wie die deinen hinwegzusehen!
Aber da kam man schon mit meinem Mantel. Die Marille wandte sich brüsk ab und ging, während die Augen meines jungen Schutzherrn ihr nun mit deutlichem Triumph folgten, wobei auch jetzt das linke sich um den Bruchteil einer Sekunde hinter dem rechten verspätete.