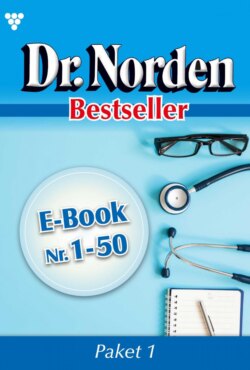Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Entschuldigen Sie bitte die Störung, Herr Doktor«, platzte Helga Moll ins Sprechzimmer, »aber Herr Grothe rief eben an. Uli hat hohes Fieber. Ob Sie möglichst schnell kommen könnten?«
Dr. Daniel Norden nickte und schrieb der Patientin, die er eben untersucht hatte, ein Rezept aus. Wegen einer Lappalie würde ihn die gute Molly, wie er sie nannte, nicht stören. Und wenn Generaldirektor Grothe selbst anrief, brauchte er keinen falschen Alarm zu vermuten, wie bei dessen Frau, die jede Gelegenheit nützte, um ihn kommen zu lassen.
Wenn Frau Grothe angerufen hätte, wäre Molly vorsichtig gewesen, denn sie kannte die Patientinnen sehr gut, die in ihrem Chef, den sie überaus schätzte, mehr den attraktiven Mann als den Arzt sahen. Ja, Molly kannte ihre Pappenheimer.
»Herr Grothe war völlig fertig«, sagte sie zu Dr. Norden, als er seinen Arztkoffer ergriff und zur Tür eilte. »Der Mann ist wahrhaft nicht zu beneiden.«
»Wie sieht es denn im Sprechzimmer aus?«, fragte Daniel Norden ablenkend.
»Noch ein gutes halbes Dutzend«, erwiderte Molly. »Zwei Bestrahlungen. Das kann ich machen.«
Er war schon an der Tür und nickte.
»Die anderen müssen halt warten, Molly. Oder sie müssen wiederkommen. Wenn Herr Grothe selber anruft, brennt es.«
Mit seinem schnellen Wagen war er bald am Ziel, und es war tatsächlich kein falscher Alarm. Blinddarmentzündung, war die Diagnose, die Dr. Norden nach kurzer Untersuchung gestellt hatte.
»Warum haben Sie mich nicht früher gerufen?«, fragte er vorwurfsvoll.
Werner Grothe fuhr sich mit dem Taschentuch über die Stirn.
»Ich bin erst heute Morgen zurückgekommen. Meine Frau ist gestern verreist. Sie dachte wohl, dass es nur eine Magenverstimmung sei.«
Typisch für sie, dachte Dr. Norden verärgert. Er kannte Marlies Grothe zur Genüge. Sie war eine überaus egoistische Frau, und zur Mutter taugte sie schon gar nicht.
Er überlegte, welchem Kollegen er Uli anvertrauen könnte. Dieter Behnisch, ja, der hatte ein Herz für Kinder.
Er rief in der Klinik an, und er erreichte ihn glücklicherweise sofort.
Uli war völlig apathisch, schon gar nicht mehr da. Er wusste nicht, was um ihn vorging, als der Krankenwagen kam.
»Ich fahre mit«, erklärte Werner Grothe heiser.
Dr. Norden nickte. »Mein Kollege Behnisch weiß Bescheid. Ihr Sohn ist in guten Händen. Sobald ich meine Sprechstunde beendet habe, werde ich in die Klinik kommen.«
»Danke, Herr Doktor!«, sagte Werner Grothe, dessen Mienenspiel seine innere Erregung verriet.
Dr. Daniel Norden widmete Marlies Grothe zornige Gedanken.
Diese eitle, selbstsüchtige Frau verdiente ein solches Kind nicht, und ihr Mann konnte einem leid tun. Er war ein netter Mensch. Trotz seiner exponierten Stellung war er mit den Füßen auf dem Boden geblieben.
Er hätte wahrhaft eine bessere Gefährtin verdient gehabt, die nicht nur darauf bedacht war, eine gesellschaftliche Rolle zu spielen und das Geld, das er verdiente, unter die Leute zu bringen.
Hoffentlich kommt der Junge durch, dachte er weiter. Schlimm genug sah es aus, und Dr. Norden wusste doch, dass Werner Grothes ganzes Herz an dem Kleinen hing.
Seine Miene war entsprechend düster, als er die Praxis wieder betrat.
»Schlimm?«, fragte Helga Moll.
»Sehr schlimm. Akuter Blinddarm. Sind noch welche geblieben?« Er blickte zur Tür des Wartezimmers.
»Alle. Ihre Patienten sind nicht abzuschrecken, Herr Doktor«, sagte sie aufmunternd.
Es würde noch gut zwei Stunden dauern, bis er mit der Sprechstunde fertig wurde. Auf die schnelle Tour wollte er keinen abfertigen, obgleich der kleine Uli nun sicher schon auf dem Operationstisch lag.
*
Uli war ein schmächtiges Kind. Dr. Behnisch stellte besorgt fest, dass dessen Konstitution wirklich Schlimmstes befürchten ließ.
Er war noch jung, aber als Chirurg hatte er sich dennoch schon einen Namen gemacht.
Er war gebürtiger Münchner, hatte mit Daniel Norden zusammen studiert und war dann mehrere Jahre als Assistenzarzt an einem großen Krankenhaus beschäftigt gewesen.
Ein vermögender Onkel hatte ihm den Kauf dieser Privatklinik ermöglicht, die er erst vor wenigen Wochen übernommen hatte.
Daniel Norden war einer der Ersten gewesen, bei denen er sich in Erinnerung gebracht hatte, aber Uli Grothe war nicht der erste Patient, den Daniel ihm schickte.
Er konnte sich nicht beklagen. Er hatte einen guten Start gehabt.
Größte Aufmerksamkeit bei der Narkose hatte er dem Anästhesisten geboten. Er selbst war jetzt ganz konzentriert.
Es war auch schlimm, was sich seinen Augen darbot, als er den Schnitt ausgeführt hatte. Der Blinddarm war bereits am Durchbruch. Leichtsinnig verschleppt, wie Dr. Behnisch kombinierte. Unmöglich konnte Daniel das übersehen haben.
Der Puls des Kindes war schwach, der Blutdruck sank zusehends ab. Dr. Behnisch durfte sich davon nicht irritieren lassen.
»Blutkonserven fertig machen«, sagte er ruhig. Besonnen führte er die Operation zu Ende.
Normalerweise war es eine Routineangelegenheit, doch wenn das Leben dieses kleinen Jungen gerettet werden konnte, war es nur Dr. Nordens schneller Entschlossenheit und dem Können dieses jungen Chirurgen zu verdanken.
Jetzt können wir nur noch beten, dachte Dieter Behnisch.
Für Werner Grothe hatte er dann, eine Viertelstunde später, aufmunternde Worte bereit.
Der Mann sah zum Gotterbarmen aus, und als Uli aus dem Operationssaal an ihm vorbeigefahren wurde, so weiß wie das Leintuch, auf dem er lag, brach er zusammen.
»Du lieber Gott«, bemerkte Oberschwester Martha, die schon dreißig Jahre im Dienst der Nächstenliebe hinter sich gebracht hatte, »nun brauchen wir noch ein Bett!«
»Wir können Vater und Sohn gleich in ein Zimmer legen«, erklärte Dr. Behnisch, nachdem er Herrn Grothe untersucht hatte. »Zumindest einige Tage Bettruhe wird er brauchen. Aber den Jungen legen wir erst zu ihm hinein, wenn er außer Lebensgefahr ist.«
Als Daniel Norden in die Klinik kam, erfuhr er, dass Werner Grothe einen Kreislaufkollaps erlitten hatte.
»Und die Dame des Hauses ist verreist«, sagte er bitter. »Sie hat mich wohl deshalb nicht zu Uli rufen lassen, um ihre Reise nicht infrage zu stellen. Sonst hat sie mich wegen jeder Kleinigkeit geholt.«
Dr. Behnisch sah seinen Kollegen nachdenklich an. Hinter Daniel waren die Frauen schon immer hergewesen, und jetzt sah er noch interessanter aus als früher.
Er musste wohl sehr diplomatisch sein, um sich seiner Haut zu wehren und allen auf ihn zukommenden Gefahren zu trotzen.
»Man müsste sie verständigen«, bemerkte er. »Der Junge schwebt in Lebensgefahr. Es war allerhöchste Eisenbahn, Daniel, und bei seinem Vater können wir froh sein, dass es nicht zu einem Herzinfarkt gekommenn ist.«
»Der Mann ist trotz seines Geldes nicht zu beneiden«, äußerte Daniel gedankenvoll. »Ich glaube, dass es wenig Sinn hat, seine Frau zu verständigen. Sie würde zwar eine dramatische Schau abziehen, aber Vater und Kind mehr schaden als nützen.«
»Ich bin in einer Zwickmühle. Du weißt, welche Vorwürfe ich mir einhandeln könnte, wenn ich es unterlasse, sie zu benachrichtigen.«
»Ist Herr Grothe ansprechbar?«, fragte Daniel.
»Augenblicklich noch nicht. Sie haben doch sicher Hausangestellte?«
»Eine ganze Reihe, aber es würde mich wundern, wenn sie wüssten, wo sich Frau Grothe derzeit aufhält.«
Und so war es auch. Allerdings konnte auch Werner Grothe darüber keine Auskunft geben, als er wieder bei Bewusstsein war. Er dachte nur an sein Kind.
»Es geht ihm schon etwas besser«, erklärte Daniel Norden, um ihn zu beruhigen. »Er wird nachher in dieses Zimmer gebracht werden. Könnten Sie mir sagen, wo Ihre Frau zu erreichen ist?«
»Nein.« Es klang müde, aber auch abweisend. »Wir hatten Differenzen. Sie hat ihre Koffer gepackt. Ihnen kann ich es ja sagen. Sie ahnen wohl, wie es um meine Ehe bestellt ist, Herr Doktor. Uli ist alles, was ich habe. Ich will ihn behalten! Ich darf ihn nicht verlieren!«, stöhnte er auf.
»Seien Sie zuversichtlich«, sagte Dr. Norden. Aber war das nicht ein billiger Trost?
Glücklicherweise schlief Werner Grothe unter der Wirkung der Spritze wieder ein.
Auf dem Gang traf Dr. Norden mit Dr. Behnisch zusammen, der eben aus einem Krankenzimmer kam.
»Da du einmal hier bist, Dan, könnten wir doch zusammen essen«, schlug er vor. »Du kannst dich gleich überzeugen, dass wir unsere Patienten gut versorgen.«
Daheim würde zwar Lenchen, seine getreue Haushälterin, warten, aber die war es ja schon gewohnt, dass er zu spät zu den Mahlzeiten erschien oder sie ganz versäumte.
Er unterhielt sich gern einmal mit dem Studienfreund. Dazu hatten sie bisher noch sehr wenig Gelegenheit gefunden.
»Du bist zufrieden, Dieter?«, fragte er.
»Es läuft alles wie am Schnürchen«, bestätigte der andere. »Das Personal ist gut geschult. Sie sind alle geblieben. Schwester Martha ist eine Perle, wie man sie nicht leicht findet. Ich kann nur hoffen, dass sie auch mit mir zufrieden ist.«
Warum sollte sie nicht. Dieter Behnisch war ein sympathischer Mensch. Er neigte schon jetzt ein wenig zur Behäbigkeit. Er war mehr als einen halben Kopf kleiner als Daniel Norden, hatte ein rundliches Gesicht, freundliche graue Augen, und dass er gern und gut aß, sah man seiner Figur an.
»Dass du immer noch Junggeselle bist, will mir gar nicht in den Sinn, Daniel«, bemerkte er lächelnd.
»Na, und du?«, konterte Daniel. »Du warst doch verlobt, als wir uns aus den Augen verloren.«
Dieter winkte ab. »Mich hat ein gütiges Geschick vor dem Fiasko bewahrt, das der gute Herr Grothe anscheinend erleiden muss. Irene hat einen andern begehrenswerter gefunden. Die Richtige ist mir noch immer nicht begegnet. Und dir?«
»Mir schon«, erwiderte Daniel, und dabei bekamen seine Augen einen sehnsüchtigen Ausdruck.
»Alte oder junge Liebe?«, fragte Dieter.
»Wie man es nimmt. Felicitas Cornelius.«
»Ach nee! Was sagt man dazu! Die kleine Cornelius? Ist sie denn schon erwachsen?«
»Na, hör mal! Sie ist bereits ein Fräulein Doktor und assistiert ihrem Vater auf der ›Insel der Hoffnung‹.«
»Da habt ihr euch ja einen romantischen Namen einfallen lassen. Der muss ja ziehen.«
Gehört hatte Dr. Behnisch schon von der »Insel der Hoffnung«, obgleich Daniel für das Sanatorium, das ihm und seinem zukünftigen Schwiegervater gehörte, keine Reklame mehr zu machen brauchte.
»Es ist auch romantisch dort«, erwiderte Daniel.
»Aber du gedenkst nicht, deine Praxis aufzugeben?«
»Vorerst nicht. Johannes Cornelius hat genügend Elan, um es mit seinem Team allein zu schaffen. Später einmal werde ich dort einsteigen. Ich bin außerdem ein bisschen egoistisch, denn ich möchte Fee für mich allein haben, wenn wir erst verheiratet sind.«
»Und wann soll das vonstatten gehen?«
»Am Jahresende, wenn eine im Sanatorium ruhiger ist.«
»Wie viele gebrochene Frauenherzen bleiben dann auf der Strecke?«, fragte Dieter anzüglich.
»So schlimm bin ich nun auch wieder nicht«, ging Daniel humorvoll auf die Bemerkung ein. »Es gibt schon lange keine Flirts mehr. Es gibt nur Fee.«
»Also die ganz große Liebe.«
»Ja, die ganz große Liebe«, bestätigte Daniel.
»Triffst du noch ehemalige Kommilitonen?«, fragte Dieter Behnisch.
»Schorsch Leitner ab und zu, aber auch erst in letzter Zeit. Er ist Chefarzt an der Frauenklinik und auch noch Junggeselle.«
»Immer noch unter Mutters Fuchtel?«
»Sie hat sich sehr geändert, seit sie auf der ›Insel der Hoffnung‹ war. Du siehst, der Name hat seine Berechtigung.«
»Wir sollten uns mal wieder zusammensetzen«, meinte Dieter. »War doch eine schöne Zeit damals. Man soll sich nicht zu sehr von der Arbeit auffressen lassen. Wohin das führt, beweist mal wieder der Fall Grothe.«
»Es ist schon schwer, zwei Ärzte unter einen Hut zu bringen, geschweige denn drei«, sagte Daniel. »Irgendetwas ist dann bei einem immer los. Aber Schorsch würde sich bestimmt freuen, dich mal wiederzusehen.«
»Spätestens anlässlich deiner Hochzeit, wenn wir für würdig befunden werden, eine Einladung zu bekommen.«
»Da müsstet ihr euch dann aber auf die Insel begeben. Die Hochzeit wird dort gefeiert.«
»Dann lerne ich das Paradies wenigstens auch mal kennen. Ja, ich bin sehr gespannt.«
Bevor Daniel wieder in die Praxis fuhr, sah er nochmals nach dem kleinen Uli.
Der Junge bekam eine Infusion. Sein Puls ging etwas kräftiger.
Er wurde rührend von Schwester Annelie umsorgt, die selbst erst vor einem Jahr durch die Unachtsamkeit ihrer Schwiegermutter ihr zweijähriges Söhnchen verloren hatte.
Es hatte sich tödliche Verbrühungen zugezogen, während sie im Dienst gewesen war. Ihre Ehe war darüber zerbrochen.
Nun gab sie alle Liebe, die sie ihrem Kind nicht mehr geben konnte, fremden Kindern.
»Wir werden es schon schaffen«, sagte sie leise, doch hinter ihren Worten stand ein leidenschaftlicher Wille, der dem schwermütigen Ausdruck ihrer schönen dunklen Augen widersprach.
Dr. Behnisch erzählte Daniel von dem schweren Schicksal der noch jungen Schwester, als er ihn zum Ausgang begleitete.
»Dem eigenen Kind hat sie nicht helfen können, wie tragisch«, meinte Daniel sinnend. »Wir sehen uns bald wieder, Dieter.«
»Das freut mich. Ich habe jetzt eine Untersuchung vor mir, vor der mir ein bisschen bange ist. Vielleicht kann ich mir bei dir Rat holen, wenn ich nicht weiter weiß.«
So verschieden sie im Äußeren waren, darin ähnelten sie sich. Sie betrachteten ihre Ansichten über eine Krankheit nicht als die unwiderrufliche Diagnose. Sie waren für kollegiale Zusammenarbeit.
*
Auch auf Dr. Norden wartete ein Patient, der ihm große Sorgen bereitete.
Er war das erste Mal vor einer Woche zu ihm gekommen. Seine Befunde lagen schon seit vier Tagen auf Dr. Nordens Schreibtisch.
Frau Moll hatte ihn anzurufen versucht, aber nicht erreichen können.
Sein Name war Martin Kraft. Er war fünfundvierzig Jahre alt, verheiratet und hatte einen erwachsenen Sohn. Daniel wusste das, weil ihn dieser Sohn fast gewaltsam hierhergebracht hatte.
Martin Kraft war Versicherungsvertreter und immer in Eile. Er hatte sich nie die Zeit genommen, sich um seine Gesundheit zu kümmern oder um seine Wehwehchen, wie er es nannte.
Nach den Befunden, die vor Daniel lagen, würde er sich künftig viel Zeit nehmen müssen, oder er hatte gar keine mehr.
Es war immer schwierig, einem Patienten klarzumachen, dass es eine tödliche Krankheit sein könnte, denn nur wenige konnten mit einer solchen Gewissheit weiterleben und kämpfen.
Dr. Norden kannte Martin Kraft zu wenig, um einschätzen zu können, zu welcher Kategorie er gehörte.
Er war schwer durchschaubar. In seinem Beruf, in dem er mit so verschiedenartigen Menschen zu tun hatte, hatte er gelernt, sein Mienenspiel zu beherrschen.
Er war schlank und hielt sich sehr aufrecht, obwohl ihm das schwerfallen mochte.
»Sie haben schon bei uns angerufen, Herr Doktor«, begann er stockend. »Entschuldigen Sie bitte, dass ich erst heute komme, aber ich war auswärts.«
Er sah sehr angegriffen aus, aber das wunderte Dr. Norden nicht. Die Blutsenkung war katatrophal, die übrigen Befunde ließen Schlimmes ahnen. Aber Dr. Norden wollte ganz sichergehen.
»Nun, was ist?«, fragte Martin Kraft ungeduldig. »Wahrscheinlich viel Lärm um nichts. Meine Frau hat sich hinter Jochen gesteckt und …«
»Das war richtig so«, sagte Dr. Norden, als er eine Atempause einlegte, die doch eine geheime Angst verriet. »Ich bin für eine klinische Untersuchung, Herr Kraft.«
»Noch mal untersuchen?«, fragte der andere erregt. »Sie haben mir doch schon genügend Blut abgezapft. Ganz schwach habe ich mich danach gefühlt.«
Ein deutlicher Vorwurf lag in seiner Stimme, aber darüber hörte Daniel hinweg. Er kannte auch solche Reaktionen zur Genüge.
»Ein Zeichen, dass Sie nicht so gesund sind, wie Sie meinen«, erwiderte er.
Er wollte Martin Kraft keinen Schrecken einjagen, aber als gewissenhafter Arzt musste er ihm deutlich vor Augen führen, wie bedenklich sein Zustand war.
»Ich kann mir einfach nicht leisten, mich ewig in eine Klinik zu legen!«, begehrte der Patient auf.
»Nicht ewig, drei Tage«, sagte Daniel, obgleich er starke Zweifel hegte, ob es damit abgetan sein würde.
»In meinem Beruf muss man am Drücker bleiben, Herr Doktor. So einfach ist das nicht. Mein Sohn studiert noch, und auf unserm Haus liegt eine Menge Belastungen. Es muss doch ein Mittel gegen diese Schmerzen geben, das wirklich hilft.«
»Mittel gibt es viele, die Schmerzen betäuben, aber wenn eine Krankheit in ihren Wurzeln bekämpft werden soll, muss ihre Auswirkung beobachtet werden. Das kann ich nicht, wenn Sie nur ab und zu mal eine Stippvisite bei mir machen.«
»Ein braves Pferd stirbt in den Sielen«, äußerte Martin Kraft leichthin.
»Und was wird dann mit dem Studium Ihres Sohnes und den Abzahlungen für das Haus?«, fragte Dr. Norden nun sehr direkt.
Martin Kraft sah ihn erschrocken
an.
»Das sollte eigentlich nur ein Scherz sein«, brummte er.
»Mir ist nicht zum Spaßen. Ich kann noch keine endgültige Diagnose stellen, aber die Schmerzen, die Sie haben, kommen nicht von einer chronischen Gastritis, wie Sie meinen.«
»Wie auch unser früherer Arzt meinte.« Es klang ungehalten.
»Jeder Arzt kann sich täuschen. Es ist menschlich. Sicher sprechen manche Symptome für eine Gastritis, und früher hatten Sie diese Schmerzen doch auch nicht so häufig, wie Ihr Sohn mir sagte. Ich denke, Sie würden den Weg des geringeren Übels wählen, wenn Sie möglichst bald in eine Klinik gehen würden. Zwingen kann ich Sie nicht, ich kann es Ihnen nur eindringlich raten.«
»Dann sagen Sie mir wenigstens die Wahrheit.«
»Das wäre voreilig. Ich möchte Sie gern zu Professor Wiese schicken. Er ist Spezialist für Nierenerkrankungen.«
»Ach was, Nieren, das ist die Bandscheibe«, widersprach Martin Kraft.
»Wenn Sie es besser wissen, ist Ihnen nicht zu helfen. Ich sage, es ist nicht die Bandscheibe und keine Gastritits, sondern es sind die Nieren.«
Dr. Norden konnte auch energisch werden. Sein Patient senkte den Blick.
»Gut, wenn Sie es sagen. Sie haben ja Medizin studiert. Aber wenn es nicht die Nieren sind und ich umsonst meine Zeit in der Klinik vertrödele, haben Sie einen Patienten weniger!«
»Daran werde ich nicht sterben«, erwiderte Daniel mit hintergründiger Betonung, die sein Gegenüber aber doch wohl verstand. Sein Gesicht wurde noch blasser.
»Na, schön, dann beiße ich eben in den sauren Apfel. Soll ich vorher noch mein Testament machen?«
»Das können Sie, aber besser wäre es, wenn Sie den Tatsachen ins Auge blicken und den Willen haben würden, gesund zu werden, Herr Kraft. Werden Sie Ihrem Namen gerecht.«
»So schnell bringt mich nichts um. Ich will ganz gern noch leben.«
»Das höre ich gern. Dann melde ich Sie bei Professor Wiese an und gebe Ihnen Bescheid, wann ein Bett frei ist.«
»Wenn schon, dann so bald wie nur möglich. Nächsten Monat will sich unser Jochen verloben, da möchte ich dabeisein und das Essen genießen können. Die Eltern seiner Braut haben nämlich eine Landwirtschaft.«
Hoffentlich kann er noch dabeisein, dachte Daniel.
Trotz dieser langen Unterhaltung hatte er nun eine kurze Ruhepause. Der nächste Patient war erst in einer Viertelstunde fällig.
»Ich fahre schnell mal raus in die Wohnung«, sagte Daniel zu Helga Moll. »Lenchen musste heute Mittag vergeblich auf mich warten. Ich habe mit Behnisch gegessen.«
»Wie geht es Uli?«, fragte sie. Endlich kam sie dazu.
»Hoffen wir das Beste. Sein Vater ist auch zusammengeklappt.«
»Kein Wunder bei der Frau. Sie kann einem den letzten Nerv töten. «
Molly, wie Dr. Norden sie nannte, weil sein Vater sie schon so gerufen hatte, konnte sich solche Bemerkungen erlauben. Sie war nicht gehässig. Sie war ehrlich.
»Nun wird sie sich wieder hysterisch in Szene setzen«, bemerkte Molly noch.
»Sie ist weit vom Schuss und amüsiert sich wahrscheinlich. Also, bis gleich.«
*
Er fuhr nicht nur hinauf in seine Penthouse-Wohnung, um Lenchen zu versöhnen, sondern auch um mit Fee zu telefonieren.
Molly brauchte ja nicht unbedingt zu wissen, dass dies jeden Tag sein musste.
Heute Abend war die Übertragung eines Fußballspiels im Fernsehen, die er sich ungern entgehen lassen wollte.
Fee kannte seine jungenhafte Begeisterung dafür, wie sie gleich zu erkennen gab, als er sie an der Strippe hatte.
Er lauschte so gern ihrer warmen, weichen Stimme, diesem leisen Lachen, das noch so lange in seinen Ohren nachklang.
»Ich hätte dich heute Abend schon nicht gestört«, sagte sie neckend.
»Oh, von dir würde ich mich gern stören lassen, Liebes. Kannst du nicht schnell mal kommen?«
»Wir haben Hochbetrieb, Daniel. Acht Neuzugänge.«
»Könnt ihr denn alle unterbringen?«
»Jetzt sind wir voll belegt.«
»Und keine Schwierigkeiten?«
»Mit denen muss man fertig werden. Paps hat ja die Ruhe weg. Isabel hat gestern abend ihre Zelte hier abgebrochen. Hat sie sich noch nicht bei dir gemeldet?«
Klang da nicht doch ein wenig Eifersucht durch?
»Sie wird Besseres zu tun haben«, erwiderte Daniel. »Denk du lieber an mich.«
»Das tue ich ja.«
»Dann vergiss nicht, dass du die einzige Frau in meinem Leben bist.«
Zum Abschied hauchte Fee einen Kuss in die Muschel, und dann ließ sie ihre schmale, schöne Hand auf dem Hörer ruhen.
»Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was man leidet«, sagte die tiefe, ruhige Stimme ihres Vaters hinter ihr.
Errötend wandte sie ihm ihr bezauberndes Gesicht zu.
»Ich leide nicht, Paps«, sagte sie.
»Aber Sehnsucht hast du, das sehe ich dir doch an«, meinte er liebevoll. »Muss ich dich mal wieder nach München schicken?«
»Das wäre so übel nicht, wenn es am Wochenende ginge. Aber es ist jetzt so viel zu tun.«
»Du weißt doch, dass die Patienten am Wochenende immer äußerst fidel sind, Kleines.«
»Am Wochenende kann man aber nichts erledigen.«
»Dann hängst du den Montagvormittag halt noch dran. Aber sag Daniel vorher Bescheid, sonst treibt ihn die Sehnsucht hierher und ihr verfehlt euch.«
Johannes Cornelius war glücklich, dass Daniel und Felicitas sich zusammengerauft hatten, und das hatten sie buchstäblich; denn lange Zeit waren sie wie Hund und Katze gewesen, und beide aus dem gleichen Motiv, das Liebe hieß.
Daniel hatte geglaubt, dass Fee gegen ihn eingestellt sei, und sie hatte gemeint, dass es zu viel andere Frauen in seinem Leben gäbe und er von ihr gar keine Notiz nähme. So schwer konnten sich Liebende das Leben machen, doch nun schienen alle Zweifel besiegt.
Vor allem war da Isabel Guntram, die attraktive und clevere Journalistin, gewesen, mit der Daniel schon recht lange befreundet war. Aber es war tatächlich nur eine Freundschaft.
Davon war Dr. Cornelius ganz überzeugt, nachdem Isabel drei Wochen auf der »Insel der Hoffnung« zugebracht hatte.
Fee dagegen rätselte darüber nach, ob es bei Isabel doch eine tiefere Neigung sei. Sie war viel mit Dr. Schoeller beisammen gewesen, aber er machte sich über Isabel wohl auch seine Gedanken.
Tatsächlich aber war es so, dass Dr. Jürgen Schoeller seine heimliche Liebe für Fee noch nicht überwunden hatte und sie gar nicht wusste, wie tief diese saß.
Der ungemein sympathische und überaus sensible junge Arzt, der es meisterhaft verstand, sich in die Stimmungen der Patienten hineinzudenken, konnte seine Gefühle sehr gut verbergen.
Er hatte gleich gewusst, dass er neben Daniel Norden keine Chance hatte, als der auf der Bildfläche erschien.
Und Jürgen Schoeller wusste mittlerweile, dass es Isabel mit Daniel ähnlich ergangen war. Sie waren beide nicht die Menschen, die mit dem Schicksal haderten. Sie fanden sich mit den unumstößlichen Tatsachen ab.
Nun war es gewiss nicht so, dass Dr. Schoeller keine Chancen bei Frauen gehabt hätte. Es gab auch hier auf der »Insel der Hoffnung« manch eine Patientin, die einem Flirt nicht abgeneigt war, wie zum Beispiel Lissy Reuter, die sich von einem Autounfall erholen wollte.
Eine Woche war sie schon hier, und sie hatte sich bemüht, Dr. Schoellers Aufmerksamkeit ausschließlich auf sich zu lenken.
Aber bis gestern war ja noch Isabel Guntram dagewesen, die sie nun als stärkste Konkurrenz ausgeschaltet wähnte.
Lissy, von Beruf Tanzlehrerin, wusste ihre weiblichen Vorzüge ins günstigste Licht zu rücken, aber man musste ihr lassen, dass sie dabei nicht herausfordernd wirkte.
Sie freute sich sehr, Jürgen Schoeller einmal allein und nicht in Eile zu erwischen, und er war viel zu arglos, um hintergründige Gedanken zu hegen.
Lissy hatte sich während ihres Aufenthaltes auf der »Insel der Hoffnung« schon blendend erholt, aber als Dr. Schoeller sich nach ihrem Befinden erkundigte, klagte sie doch über Gleichgewichtsstörungen.
»Sie dürfen nicht zu sehr auf die schlanke Linie achten«, erklärte er liebenswürdig. »Die Mahlzeiten sind so abgestimmt, dass Sie nicht fürchten müssen, zuzunehmen. Aber abnehmen sollen Sie auch nicht.«
»Finden Sie, dass ich abgenommen habe?«, fragte sie, kokett an ihrem leichten Sommerkleid zupfend.
»Wir können es auf der Waage kontrollieren«, sagte er lächelnd. »Ich kann mir nicht erklären, woher die Kreislaufstörungen kommen sollen. Der Puls ist regelmäßig, der Blutdruck normal, und Sie sehen blendend aus. Wie wäre es, wenn Sie unseren Patienten mal Tanzunterricht geben würden?«
»Ihnen auch?«, fragte sie mit einem Augenzwinkern.
»Das könnte nicht schaden. Nur wenn es Ihnen Spaß macht, Frau Reuter.«
»Und damit ich in der Übung bleibe. Keine schlechte Idee. Wann fangen wir an? Gleich heute Abend?«
»Heute Abend ist das Fußballspiel, das wollen unsere Herren sehen. Morgen vielleicht? Natürlich soll es keine Anstrengung für Sie sein.«
Und wenn sie jetzt nun sagte, dass sie mit diesem Beruf ihr Geld verdiene und Tanzunterricht nicht ohne Honorar geben würde?
Nein, das sagte Lissy nicht. Dazu war sie viel zu großzügig und auf ihr Image bedacht. Und sie hoffte doch insgeheim auch, sich damit ein Plätzchen in Dr. Schoellers Herzen zu sichern. Aber man konnte ihr wahrhaftig nicht nachsagen, dass sie dieses Ziel auf unfeine Art verfolgte.
Lissy war immer ein guter Kumpel gewesen. Sie hatte in ihrem fast dreißigjährigen Leben auch manche trübe Erfahrung mit Männer gesammelt. Ihr gesunder Optimismus hatte jedoch immer gesiegt. Sie fühlte sich wohl auf der »Insel der Hoffnung« und wollte einfach nur ein bisschen mehr Abwechslung haben. Die sollte sie nun haben!
Sie war jetzt nicht mehr kokett, sie war einfach heiter gestimmt, und diese Heiterkeit stand ihr gut zu Gesicht.
Das gewahrte ein anderer Mann viel bewusster als Dr. Schoeller.
Er hieß Maximilian Moeller und war erst vor zwei Tagen angekommen. Lissy hatte ihn noch nicht getroffen, denn er war nach einer sehr weiten Reise in einen vierundzwanzigstündigen Dauerschlaf versetzt worden.
Dr. Schoeller stellte ihn vor. Lissy lachte. »Schoeller-Moeller«, scherzte sie, »ist das lustig.«
Wohlgefällig ruhte ihr Blick auf dem zwar etwas blassen, aber recht annehmbaren und noch jugendlichen Mann, der sich höflich vor ihr verneigte.
Nun gab es plötzlich noch einen, der ihr recht gut gefiel, und weil er sich dafür interessierte, entschloss sich Lissy, zum ersten Mal in ihrem Leben, sich ein Fußballspiel im Fernsehen anzuschauen.
*
Dr. Daniel Norden hatte mit Professor Wiese telefoniert und Martin Kraft anschließend benachrichtigt, dass er am Freitag gegen zehn Uhr in der Klinik erscheinen möchte. Er konnte jetzt nur hoffen, dass sein Patient nicht wieder andern Sinnes wurde.
Ein weiteres Telefongespräch führte er nach der Nachmittagssprechstunde mit seinem Kollegen Behnisch, der ihm die beruhigende Nachricht geben konnte, dass es Herrn Grothe schon bedeutend besser ginge und Uli nun zu ihm ins Zimmer gebracht worden sei.
Er machte noch vier Besuche und kam heim, als die erste Halbzeit des Fußballspieles fast zu Ende war. Es stand noch unentschieden null zu null. Er hatte nichts versäumt.
Lenchen hatte ihm das Abendessen auf den Tisch gestellt und sich bereits in ihre Gefilde zurückgezogen.
Mit ihren nun fast siebzig Jahren wollte sie abends ihre Ruhe haben.
Ruhe herrschte in diesem Haus, in dem sich überwiegend Büroräume, eine Rechtsanwaltskanzlei, Daniels Praxis und neuerdings noch eine Zahnarztpraxis befanden. Vom Straßenlärm hörte man kaum etwas. Die Hauptverkehrsstraße lag weiter entfernt.
Daniel hatte es sich bequem gemacht. Das Spiel wurde jetzt schneller und versprach einen interessanten Verlauf, doch da wurde er plötzlich emporgeschreckt.
Bremsen quietschten, und ein dumpfer Aufprall folgte.
Diese Geräusche waren hier nun ganz ungewöhnlich, und während er schon wieder in seine Schuhe schlüpfte – es war eine ganz automatische Reaktion –, läutete es bei ihm.
Lenchen war schwerhörig. Sie vernahm weder das eine noch das andere. Wahrscheinlich schlief sie schon.
»Was ist?«, rief Daniel in die Sprechanlage.
»Helfen Sie bitte rasch!«, ertönte eine Männerstimme.
Daniel beeilte sich. Er fuhr mit dem Lift abwärts.
Das Erste, was er im Lichtkreis der Straßenlampe gewahrte, waren ein zerbeultes Auto an der Hauswand und ein Mann, der sich über eine am Boden liegende Gestalt beugte. Mit ein paar Schritten war Daniel dort.
»Sie ist nicht tot, sie kann nicht tot sein«, stammelte der Mann. »Ich kann nichts dafür, ich habe keine Schuld!«
Er stand sichtlich unter einem Schock, aber er war nicht verletzt. Daniel widmete seine Aufmerksamkeit der zusammengekrümmten schmalen Gestalt. Es war ein Mädchen oder eine noch sehr junge Frau. Das Gesicht war blutüberstömt, die Kleidung teilweise zerfetzt.
Er fühlte den Puls. Dieser war schwach spürbar.
»Helfen Sie mir«, sagte er zu dem Fremden. »Wir bringen sie in meine Praxis. Von dort können wir auch die Polizei benachrichtigen.«
»Polizei?«, stammelte der andere entsetzt. »Mein Gott, was wird mein Bruder sagen!«
»Das soll uns jetzt nicht interessieren«, entgegnete Daniel energisch. »Nehmen Sie sich zusammen, Mann! Fassen Sie an, aber vorsichtig!«
In solchen Situationen wirkten harte Worte manchmal Wunder. Der Fremde befolgte gehorsam Daniels Anordnungen.
Glücklicherweise hatte Daniel den Schlüssel zur Praxis in seiner Hosentasche. Er brauchte nicht nochmals in seine Wohnung hinaufzufahren.
Die Bewusstlose gab keinen Laut von sich. Gebrochen hatte sie anscheinend nichts. Ob innere Verletzungen vorlagen, konnte Daniel mit einem Blick allerdings nicht feststellen.
»Rufen Sie die Funkstreife an!«, wandte er sich in strengem Befehlston an den jungen Mann. »Da steht das Telefon. Ich muss mich um die Verletzte kümmern.« Und als der Fremde immer noch wie versteinert dastand, sagte er: »110.«
Der junge Mann wählte. Daniel zog eine Injektion auf. Nun musste er sich vor allem um die Kopfwunde kümmern, das Blut zum Stillstand bringen.
Nur im Unterbewusstsein, denn er war ganz konzentriert, vernahm er die bebende Stimme des Fremden. Der stand kurz darauf neben ihm.
»Was ist mit ihr?«, fragte er leise. »Die Funkstreife wird gleich kommen.«
»Sie hat anscheinend verflixt viel Glück gehabt und Sie auch«, erwiderte Daniel.
»Für mich war es Pech«, äußerte der Fremde deprimiert.
Daniel blickte auf. Erst jetzt sah er, dass der Mann auch blutete. Eine tiefe Schramme lief über seine linke Gesichtshälfte.
»Wie ist es eigentlich passiert?«, fragte er, doch da läutete es schon. Die Funkstreife war schnell gekommen.
»Sie hätten die Verletzte liegenlassen müssen«, war das Erste, was Daniel zu hören bekam.
»Und möglicherweise verbluten lassen?«, entgegnete er sarkastisch. »Ich bin Arzt. Die Verletzungen sind nicht allzu schwer, wie ich mittlerweile feststellen konnte. Jedenfalls nicht lebensgefährlich. Aber auf einer nächtlichen Straße kann man das nicht beurteilen. Wenn Sie gestatten, werde ich mich mit einer Klinik in Verbindung setzen.«
»Sie sind Dr. Norden?«, fragte einer der Beamten.
»Der bin ich.«
»Und dieser junge Mann?«
»Fragen Sie ihn. Ich kenne ihn nicht.«
Der Fremde war auf einen Stuhl gesunken und hatte die Hände vor sein Gesicht gelegt. »Ich bin Thomas Arndt«, sagte er stockend.
Daniel blickte auf. »Er steht unter Schockwirkung«, bemerkte er.
»Der Bruder von Dr. Arndt«, fuhr der andere monoton fort.
»Hat hier eine Anwaltskanzlei im Haus«, warf Daniel ein.
»Der Bruder oder er?«, fragte der Beamte.
»Mein Bruder ist Rechtsanwalt«, stotterte Thomas Arndt.
»Sollen wir ihn rufen?«
»Nein, bitte nicht!«, entgegnete Thomas abwehrend.
»Er ist verwirrt. Er muss sich erst beruhigen«, meinte Daniel. »Ich möchte jetzt einen Kollegen anrufen, ob er die Verletzte in seiner Klinik aufnehmen kann.«
»Bitte, aber wir müssen schließlich feststellen, wie der Unfall passiert ist«, erklärte der Beamte, der nun das Wort übernommen hatte.
»Sie wurde aus einem Auto gestoßen«, stammelte Thomas Arndt.
Drei ungläubige Augenpaare richteten sich auf ihn.
»Aus einem Auto gestoßen?«, wiederholte der Beamte gedehnt.
Daniel ging zum Telefon. Zum dritten Mal an diesem Tag wählte er die Nummer der Behnisch-Klinik.
Dieter Behnisch war noch anwesend.
»Du kommst wohl auch nicht zur Nachtruhe, Daniel?«, war seine erste Frage, als Dr. Norden sich meldete.
Er erzählte, was passiert war. Dieter Behnisch versprach ihm, sofort einen Krankenwagen zu schicken.
Die Platzwunde am Kopf des Mädchens war geklammert, das Gesicht vom Blut befreit. Das dunkle Haar war allerdings von diesem noch verklebt.
Es war ein sehr hübsches Mädchen. Daniel schätzte das Alter der Unbekannten auf neunzehn bis einundzwanzig Jahre.
Der Hosenanzug, der jetzt zerfetzt war, hatte Schick und war sicher nicht billig gewesen. Dafür hatte Daniel einen Blick.
»Also, wie kam es zu dem Unfall?«, fragte der Beamte.
»Ich werde dem jungen Mann ein Beruhigungsmittel geben«, schlug Daniel vor.
»Damit er uns einschläft?«
»Er wird nicht einschlafen. Ich möchte auch die Wunde versorgen.«
»Wie sind Sie zu dieser gekommen?«, wurde Thomas Arndt gefragt.
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich durch den Aufprall.«
Er sah Daniel dankbar an, als dieser ihm ein Glas reichte, in das er zehn Tropfen hineingezählt hatte.
Daniel sah es schon kommen, dass ihm eine lange Nacht bevorstand.
Die Verletzte wurde abgeholt. Er musste sie jetzt Dr. Behnischs Fürsorge überlassen, denn die Beamten erklärten ihm, dass sie ihn noch brauchen würden.
Zwei andere, die die Unfallstelle genau inspiziert hatten, gesellten sich nach einer Viertelstunde zu ihnen.
In der Zwischenzeit hatte Daniel das Gesicht des jungen Mannes behandelt, ein schmales, hübsches, jungenhaftes Gesicht.
Thomas Arndt war jetzt etwas ruhiger und auch besonnener.
Daniel erfuhr, dass er dreiundzwanzig Jahre und Student der Rechtswissenschaften war, dass Dr. Herbert Arndt ihn hergeschickt hatte, um eine wichtige Akte zu holen.
»Ich bin nicht zu schnell gefahren«, erzählte Thomas leise, »sonst wäre doch alles viel schlimmer gewesen. Vor mir fuhr ein Wagen. Plötzlich ging die Tür auf, und etwas fiel heraus. Ich dachte erst, es wäre ein Sack. Ich habe gebremst und wollte ausweichen. Es geschah alles so schnell. Ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren.«
»Klingt ein bisschen unwahrscheinlich«, brummte jemand im Hintergrund.
Aber ein anderer bemerkte sofort: »Der Wagen hat die Verletzte nur gestreift. Dann ist er an die Hauswand geprallt.«
»Ich habe gesagt, dass ich auszuweichen versuchte. Man reagiert doch instinktiv«, erklärte Thomas Arndt, nun bedeutend ruhiger.
»Und was für ein Wagen war das?«
»Ein dunkler Volvo.«
»Das konnten Sie genau erkennen?«
Thomas Arndt nickte. »Mein Bruder hat auch einen.«
»Einen dunklen?«, fragte der Beamte misstrauisch.
»Nein, einen beigen.«
Mit großem Unwillen bemerkte Daniel, dass man den jungen Mann in die Enge zu treiben versuchte, und auch ihn fragte man, was er denn gehört hätte.
Er berichtete wahrheitsgemäß, was er wusste, dann wurde Dr. Arndt doch angerufen.
Er war zwanzig Minuten später da, beherrscht und undurchsichtig, mehr Anwalt als Bruder und auf der Hut.
Die Fortsetzung des Verhörs fand in seiner Kanzlei statt.
Daniel wurde nicht mehr benötigt. Nach kurzem Überlegen entschloss er sich, in die Behnisch-Klinik zu fahren.
*
»Gut, dass du kommst! Ich habe eben schon bei dir angerufen«, empfing ihn Dieter. »Das Unfallopfer ist bei Bewusstsein. Wie heißt sie?«
Daniel sah ihn verwundert an.
»Keine Ahnung. Hast du sie nicht gefragt?«
»Natürlich, aber sie schüttelt nur den Kopf. Sie kann sich anscheinend an nichts erinnern. Das hat man ja öfter. Eine Amnesie nach einem Unfall. Kann sich schnell legen.«
»Oder auch nicht«, sagte Daniel. »Eine merkwürdige Geschichte.«
Er erzählte, was er wusste. Dieter hörte ihm aufmerksam zu.
»Du hegst Zweifel, dass es stimmt?«
»Eigentlich erscheint mir Thomas Arndt glaubwürdig, aber warum sollte ausgerechnet in unserer stillen Straße ein Verbrechen passieren? Es ist doch ein Verbrechen, wenn jemand aus dem Wagen gestoßen wird.«
»Dazu sucht man sich gewöhnlich stille Plätze aus.«
»Ein Stück weiter ist freies Feld«, äußerte Daniel gedankenvoll.
»Das zu klären, ist Sache der Polizei. Was das Mädchen anbetrifft, wird sich ja wohl jemand melden, der es kennt.«
»Innere Verletzungen?«, fragte Daniel.
»Nein. Prellungen, ein paar Kratzwunden. Sie muss sich gewehrt haben. Gehirnerschütterung, aber nicht bedrohlich. Ein hübsches Ding, sehr gepflegt, Mannequinfigur.«
»Da spricht der Kenner«, versuchte Daniel zu scherzen, obgleich ihm gar nicht danach zumute war.
»Na, das entgeht selbst einem alten Esel nicht«, meinte Dr. Behnisch lächelnd. »Willst du sie sehen? Vielleicht löst dein unwiderstehlicher Charme ihr die Zunge.«
Er führte Daniel in das Krankenzimmer. Es war ein kleiner Raum.
»Notaufnahme«, sagte Dr. Behnisch erklärend.
Zwei helle grüngraue Augen blickten Daniel an, fragend, ängstlich.
»Das ist mein Kollege Dr. Norden, der Ihnen Erste Hilfe zuteil werden ließ«, bemerkte Dr. Behnisch jetzt sehr freundlich.
»Ich weiß nicht, was passiert ist«, sagte das Mädchen.
»Sie wurden fast von einem Auto überrollt, nachdem Sie aus einem andern gefallen sind«, erwiderte Daniel ruhig.
Sie bewegte verneinend den Kopf.
»Ich weiß nichts. Ich kann mich nicht erinnern. Mein Kopf tut weh.«
»Sie bekommen eine Spritze, und dann werden Sie wieder schlafen«, meinte Dieter Behnisch.
Es war nichts von ihr zu erfahren.
»Dir wird die Polizei wahrscheinlich auch noch einen Besuch machen«, äußerte Daniel. »Tut mir leid, Dieter, dass ich dir Unannehmlichkeiten bereite.«
»Macht gar nichts. Interessante Abwechslung für den Nachtdient. Ich habe drei Frischoperierte, um die ich mich kümmern muss.«
»Was macht Uli?«
»Er schläft. Schwester Annelie hält Wache. Es sieht schon besser aus.«
»Wenigstens was Erfreuliches. Na, dann wünsche ich dir eine gute Nacht.«
»Spötter!«, lächelte Dieter Behnisch.
Als Daniel daheim anlangte, brannte in Dr. Arndts Kanzlei noch immer Licht.
Thomas Arndts Wagen stand am gleichen Platz. Es war ein Sportcoupé.
Daniel warf einen Blick hinein. Er benutzte dazu eine Taschenlampe.
Er sah, dass der Aschenbecher am Armaturenbrett herausgezogen war. Es konnte möglich sein, dass der junge Arndt sich dort die Schramme zugezogen hatte.
Als Daniel die Haustür aufgeschlossen hatte, vernahm er Motorengeräusch.
Er ließ die Tür einen Spalt offen und schaute hinaus. Warum er das tat, hätte er später nicht sagen können.
Er sah eine dunkle Limousine verhältnismäßig langsam vorbeifahren. Der Mann am Steuer hatte hellblondes oder weißes Haar. Genau konnte Daniel es nicht definieren. Er konnte aber sehen, dass er zu dem Wagen schaute. Er hatte eine scharf gebogene Nase.
Das konnte ein Volvo gewesen sein. Zufall? Oder die berüchtigte Rückkehr des Täters an den Ort der Tat?
Misch dich da nicht ein, Daniel, mahnte er sich. Schließlich war er Arzt und kein Kriminalist, und er hatte sich die halbe Nacht schon um die Ohren geschlagen. Wenn er jetzt noch bei Dr. Arndt anläutete, kam er vielleicht gar nicht ins Bett.
Über diese rätselhaften Ereignisse würde er wohl doch noch mehr erfahren.
Er sank müde ins Bett, aber einschlafen konnte er doch nicht gleich. Immer wieder kreisten seine Gedanken um den einen Punkt.
Warum hatte man dieses Mädchen hier, vor diesem Haus, aus dem Wagen gestoßen, wenn das stimmte, was Thomas Arndt gesagt hatte, und er hielt den jungen Mann für glaubwürdig.
*
»Nun konzentriere dich mal, Thommy!«, sagte Herbert Arndt zu seinem Bruder. »Die Polizei kann dir gar nichts anhaben. Es ist mir durchaus nicht angenehm, dass du in diese Geschichte verwickelt bist, aber eine Schuld können sie dir nicht in die Schuhe schieben.«
»Ich kann mich nicht konzentrieren, Bert. Ich habe mich so wahnsinnig erschrocken. Ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe.«
Er hatte es schon paar Mal wiederholt. Nun waren die Polizisten verschwunden, und er saß mit seinem Bruder allein in der Kanzlei, die sehr komfortabel eingerichtet war.
Dr. Herbert Arndt, Mitte dreißig, mittelgroß, eine interessante Erscheinung, saß jetzt lässig in dem grünen Ledersessel und hatte sich eine Pfeife angezündet.
Sein markant geschnittenes Gesicht verriet scharfen Verstand, sein schmaler Mund hatte einen ironischen Zug.
»Mir brummt der Schädel«, erklärte Thomas. »Warum stellst du mir überhaupt so merkwürdige Fragen? Ich habe dieses Mädchen niemals gesehen.«
»Jetzt werde ich dir mal etwas sagen, kleiner Bruder. Es ist kein Zufall, dass dieses Mädchen ausgerechnet vor diesem Haus aus dem Wagen gestoßen wurde. Der oder diejenige meinte, dass es Monika sei.«
»Monika?« Thomas riß die Augen auf. »Wie kommst du darauf, Bert? Es war bestimmt nicht Monika.«
»Das weiß ich. Ich bekam einen Anruf von einem Fremden, der sich nicht zu erkennen gab. Er sagte mir, dass ich Monika hier auflesen könne und mir dies als letzte Warnung dienen lassen solle.«
»Ich verstehe nicht«, sagte Thomas entsetzt. »Was soll das bedeuten? Eine Warnung?«
»Das erkläre ich dir später. Ich rief bei Monika an. Sie war gerade aus ihrem Geschäft gekommen. Sie hat noch dekoriert. Also konnte ihr nichts passiert sein. Ich wollte sie nicht beunruhigen und wünschte ihr eine gute Nacht. Wenig später bekam ich den Anruf, der mich herrief. Natürlich habe ich mir meine Gedanken gemacht. Der Täter muss jenes Mädchen mit Monika verwechselt haben.«
»Ich blicke nicht durch, Bert!«, stöhnte Thomas. »Du meinst, dass man Monika entführen wollte, um dir damit eine Warnung zuteil werden zu lassen?«
»Es scheint so. Ich stecke mitten in einem schwierigen Prozeß. Mein Mandant wird der Erpressung und des Rauschgifthandels beschuldigt. Er beteuert seine Schuldlosigkeit, und ich bin davon überzeugt, sonst hätte ich seine Verteidigung nicht übernommen. Darum werde ich von Anfang an unter Druck gesetzt. Die Hintermänner wollen meinen Mandanten als Sündenbock sehen. Das ist die Geschichte.«
»Um derentwillen ein unschuldiges Mädchen fast umgebracht worden wäre! Mein Gott, Bert, warum hast du der Polizei nichts von diesem Anruf gesagt?«
»Weil ich Monika heraushalten will und weil davon nichts in die Öffentlichkeit dringen soll. Der Prozess findet übermorgen statt.«
»Du lebst gefährlich«, murmelte Thomas.
»Du aber auch, Thommy. Und wenn diese Burschen spitzkriegen, dass sie nicht Monika geschnappt haben, schwebt auch sie in Gefahr. Ich muss sie in Sicherheit bringen.«
»Du hättest sie warnen müssen!«
»Damit sie in Panik versetzt wird? Heute nacht wird ihr nichts passieren. Die Täter sind doch überzeugt, dass sie ihr Opfer ist. Ich muss das alles durchdenken. Und du musst mir behilflich sein. Du musst gleich morgen früh in Erfahrung bringen, wer die Verletzte ist.«
»Da bin ich wahrhaftig in eine schöne Geschichte hineingeraten«, sagte Thomas. »Und ich hatte Angst, dass du mir die Leviten lesen würdest, weil ich den neuen Wagen zu Schrott gefahren habe.«
»Eine unerfreuliche Beigabe, aber du bist wenigstens heil geblieben.«
Die beiden Brüder verband trotz des Altersuntersehiedes von zwölf Jahren eine herzliche Zuneigung.
Ebenso lange ersetzte Herbert Arndt dem Jüngeren die Eltern, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, als Thomas gerade elf Jahre alt gewesen war.
Herbert war deshalb auch immer in Sorge, dass Thomas etwas passieren könne.
»Ich habe mir entsetzliche Vorwürfe gemacht, dass ich dich losgeschickt habe, als ich vergeblich auf dich wartete«, sagte Herbert, »aber vielleicht ist diesem fremden jungen Mädchen dadurch das Leben gerettet worden. Würdest du mir den Gefallen tun und heute nacht hier schlafen, Thommy? Ich muss morgen früh gleich zu Monika. Ins Untersuchungsgefängnis muss ich auch, und um neun Uhr muss ich auf dem Gericht sein. Du darfst dafür auch mal die Vorlesung schwänzen«, fügte er mit einem aufmunternden Lächeln hinzu.
Das war nur ein schwacher Trost, denn Thomas meinte, kein Auge zutun zu können. Aber dann schlief er doch ein.
Das Beruhigungsmittel, das Dr. Norden ihm gegeben hatte, schien am Ende doch zu wirken.
*
Lenchen war wie immer früh auf den Beinen. Kritisch musterte sie Daniel, als er sich an den Frühstückstisch setzte.
»Sie sehen aber verkatert aus«, brummte sie.
»Verkatert ist gut gesagt.«
»Was haben Sie gesagt?«, fragte sie, die Hand ans Ohr legend.
»Ich bin nicht verkatert, ich habe eine aufregende Nacht hinter mir«, erklärte Daniel laut. »Sie Glückliche haben davon natürlich nichts mitgekriegt.«
»Was für Aufregung?«, fragte Lenchen.
»Ein Unfall.«
»Jeden Tag passieren welche durch diese verrückte Fahrerei. Hat’s Tote gegeben?«
Sie war nicht mehr so leicht zu erschüttern, wenn sie ihren Doktor gesund vor sich sitzen sah. Aber dann erschrak sie doch, als sie hörte, dass es unmittelbar vor dem Haus geschehen war.
Auch Helga Moll empfing Daniel aufgeregt.
»O Gott, was ist denn da passiert?«, war die erste Frage.
Aber er kam nicht dazu, ihr eine Antwort zu geben, denn es läutete.
»Unsere Patienten werden immer pünktlicher«, sagte Molly.
Doch es war kein Patient, sondern Thomas Arndt. Da sie aber seine verpflasterte Wange sah, meinte sie doch, dass es ein Patient sei, und auch Daniel fragte gleich, ob er Schmerzen hätte.
»Ein bisschen«, erwiderte Thomas verlegen, » aber eigentlich komme ich, um mich nach dem Mädchen zu erkundigen.«
»Es geht ihr so weit ganz gut«, gab Daniel Auskunft.
Thomas wollte recht diplomatisch vorgehen und kein Misstrauen erregen
»Kann man sie besuchen? Wie ist eigentlich ihr Name?«, fragte er stockend.
»Ja, wenn wir das wüssten. Sie leidet an einer Amnesie.«
»Gedächtnisschwund?«, fragte Thomas beklommen.
»Wahrscheinlich durch den Schock hervorgerufen. Papiere hat man bei ihr wohl nicht gefunden?«
»Davon haben die Polizisten nichts gesagt. Mir ist das alles schrecklich.«
»Das glaube ich Ihnen gern, und Ihr Wagen war auch noch ziemlich neu.« Daniel wollte gern wissen, ob ihm das wichtig war.
»Besser so, als wenn ich über sie hinweggefahren wäre«, sagte Thomas jedoch »Ich möchte Sie nicht länger aufhalten, Herr Doktor. Herzlichen Dank noch für Ihre Hilfe.«
»Das ist selbstverständlich. Ich hätte noch eine Frage an Sie, Herr Arndt.«
»Ja?«
»Sie sagten, es wäre ein Volvo gewesen.«
Thomas nickte zustimmend. Fragend sah er Dr. Norden an.
»Den Fahrer des Wagens konnten Sie im Licht Ihres Scheinwerfers wohl nicht sehen?«
»Es ging alles so schnell. Ich war gerade erst um die Ecke gebogen«, erwiderte Thomas irritiert.
»Als ich aus der Klinik heimkam, fuhr ein dunkler Volvo vorbei«, sagte Daniel nachdenklich. »Ich frage mich, ob man sich überzeugen wollte, ob das Mädchen noch dort läge.«
»Ich weiß darauf keine Antwort. Sie sagten, dass das Mädchen in der Behnisch-Klinik liegt?«
Was hat er zu verbergen, fragte sich Daniel, dem die Unsicherheit des andern auffiel. Stimmt da doch manches nicht?
Aber sollte ihm das nicht gleichgültig sein? Er hatte der Verletzten geholfen. Es bestand für sie keine Lebensgefahr. Damit sollte er sich doch wohl zufriedengeben.
Molly war doch neugierig. Als Thomas gegangen war, stellte sie die Fragen, die ihr auf der Zunge brannten.
»Ist das der Bruder von Dr. Arndt?«
Daniel bestätigte es.
»Sein Wagen ist das da unten?« Daniel nickte. »War er schuld?«
»Nein, Molly. Eine ganz verzwickte Geschichte ist das, und es sollte mich nicht wundern, wenn wir heute nochmals Besuch von der Polizei bekämen.«
Doch diese Befürchtung bestätigte sich nicht. Molly hatte erfahren, was sie wollte.
Die Sprechstunde begann und erinnerte Daniel daran, dass er Wichtigeres zu tun hatte, als Detektiv spielen zu wollen.
Aber es wäre schon interessant für ihn gewesen, wenn er erfahren hätte, was Dr. Herbert Arndt an diesem frühen Morgen schon alles unternommen hatte.
*
Monika von Schönauer bewohnte einen kleinen, aber sehr komfortablen Bungalow in einem Prominentenvorort.
Sie war es gewohnt, früh aufzustehen, denn sie begann den Tag mit Frühsport und pflegte danach ausgiebig zu duschen.
Für ihre Morgentoilette brauchte sie auch viel Zeit, denn als Besitzerin einer exklusiven Boutique musste sie immer gepflegt aussehen.
Seit zwei Monaten war sie mit Dr. Herbert Arndt verlobt. Dass er sie gleich nach sieben Uhr in der Frühe mit seinem Besuch überraschte, versetzte sie dennoch in Erstaunen.
»Berti?«, rief sie verwundert, als sie seine Stimme durch die Sprechanlage vernahm.
So, wie sie war, nur knapp bekleidet, öffnete sie ihm die Tür.
»Berti«, sagte sie nochmals, »was ist denn mit dir los?«
Er wirkte übernächtigt und war so erregt, wie sie ihn noch nie gesehen hatte.
Er versuchte, seine Stimme unbefangen klingen zu lassen, aber es gelang ihm bei aller Beherrschung nicht.
Er war nur erleichtert, sie frisch und lebendig vor sich zu sehen.
Monika war ein bildhübsches Geschöpf. Tadellos gewachsen, eine richtige Mannequinfigur, ein bezauberndes, ausdrucksvolles Gesicht, umgeben von langem dunklem Haar.
Am schönsten waren ihre großen, weit auseinanderstehenden graugrünen Augen, die von langen schwarzen Wimpern umgeben waren.
Herbert Arndt liebte dieses Mädchen über alle Maßen, und Monika liebte ihn auch.
»Nun rede schon endlich!«, drängte sie.
»Zieh dich erst an, Liebling.«
»Das kann ich nebenher. Erst dein nächtlicher Anruf, dann dieser morgendliche Besuch. Das bin ich nicht von dir gewohnt, du seriöser Mann. Ich war heute Nacht gar nicht richtig da. Wir haben irrsinnig geschuftet.«
»Ihr?«, fragte er wachsam.
»Liebe Güte, das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt. Gestern abend ist Petra zurückgekommen. Sie hat mir geholfen. Sie hatte dann allerdings noch eine Verabredung und ist früher gegangen.«
»Petra«, sagte er heiser. Er fuhr sich mit dem Taschentuch über die Stirn.
Petra war Monikas drei Jahre jüngere Schwester. Die beiden geschäftstüchtigen Mädchen betrieben gemeinsam die Boutique. Petra war zur Modewoche in Düsseldorf gewesen und anschließend noch in Paris.
Nein, an Petra hatte er nicht gedacht, und nun wusste er nicht, wie er es Monika sagen sollte.
Seine Gedanken überstürzten sich. Thomas hatte doch gesagt, er hätte das Mädchen nie gesehen. Nein, er kannte Petra noch gar nicht persönlich. Er war auch mit Monika erst dreimal zusammengetroffen.
»Was siehst du mich so komisch an?«, fragte Monika verwirrt.
»Wollte Petra denn nicht hier schlafen?«, fragte er.
»Nein, sie wollte zu ihrer Freundin Uschi fahren. Sie hatte gestern Geburtstag und gab eine Party. Da wollte sie gleich in Schwabing bleiben.«
»Du hast nicht mit dieser Uschi telefoniert?«, fragte Herbert Arndt vorsichtig.
»Du machst mir angst! Ist etwas mit Petra?«
Sie war in ihren Hosenanzug geschlüpft und stand nun dicht vor ihm. Behutsam nahm er sie in seine Arme, und dann begann er mit heiser Stimme zu sprechen.
*
Thomas war zur Behnisch-Klinik gefahren. Er hatte sich ein Taxi kommen lassen.
Dr. Behnisch war im OP. Er konnte ihn nicht sprechen, und zu der Patientin wollte man ihn nicht vorlassen.
Er beschloss zu warten. Von Unruhe erfüllt, lief er in der Halle hin und her, dann hinaus.
Was hielt ihn eigentlich hier? Er konnte doch später nochmals wiederkommen. Er war nicht fähig, sich zu entscheiden, und da sah er Monika aus ihrem Sportwagen steigen. Nun war er erst einmal völlig konsterniert.
»Monika!«, rief er überrascht.
Sie sah sehr blass aus, aber das tat ihrer Schönheit keinen Abbruch.
»Bert war bei mir«, erklärte sie leise. »Hast du schon mit Petra sprechen können, Thommy?«
Sie sagte Thommy zu ihm, weil Bert ihn so nannte.
»Petra?«, fragte Thomas verwundert. »Wieso?«
»Meine Schwester. Es kann sich doch nur um meine Schwester handeln. Ihr habt euch noch nicht kennengelernt. Erst warst du weg, dann sie.«
Thomas wurde es schwindelig. Wie gelähmt stand er da und starrte in das reizvolle Gesicht seiner zukünftigen Schwägerin.
»Bert musste ins Untersuchungsgefängnis«, fuhr sie leise fort.
»Ja, ich weiß. Eine schlimme Sache ist das. Es tut mir schrecklich leid, Monika.«
»Es war sicher gut, dass gerade du gekommen bist. Weißt du wenigstens, wie es ihr geht?«
»Dr. Norden sagt, dass sie an Gedächtnisschwund leidet. Sie kann sich an nichts erinnern.«
»Wenn es ihr sonst nur einigermaßen geht«, bemerkte Monika leise. »Sich vorzustellen, was hätte geschehen können, erübrigt sich. Du hast doch keine Schuld, Thommy.«
»Mir ist keine Ähnlichkeit mit dir aufgefallen«, murmelte er.
»Wir sehen uns nicht ähnlich, nur die Figur und die Haarfarbe, und wie hättest du auch vermuten sollen, dass es sich um meine Schwester handelt. Sehr genau scheinen mich diese Gangster nicht gekannt zu haben. Jetzt habe ich auch noch Angst um Bert.«
»Er ist gewarnt, auf schreckliche Weise sogar«, sagte Thomas leise.
Nun warteten sie gemeinsam. Zwischen zwei Operationen hatte Dr. Behnisch ein paar Minuten Zeit für sie.
Mit seiner Erlaubnis konnten sie dann das Krankenzimmer endlich betreten.
Das Mädchen schlief. Monika klammerte sich an Thomas’ Arm.
»Petra!«, flüsterte sie mit tränenerstickter Stimme.
Unter dem Kopfverband, der ihr angelegt worden war, schaute eine kecke kleine Nase heraus, die ein bisschen spitz wirkte. Die Lippen waren fest aufeinandergepresst.
Unwillkürlich sah Thomas jedoch wieder das blutüberströmte Gesicht vor sich. Es kam ihm auch der Gedanke, welche entsetzliche Belastung es für seinen Bruder und Monika gewesen wäre, wenn sein Wagen Petra überrollt hätte. Eisesschauer rannen ihm über den Rücken.
Monika hatte ihre Fassung wiedergewonnen. Sie setzte sich ans Bett und griff nach Petras Hand. Ihre Schwester schlief so tief, dass sie es nicht bemerkte.
Lange, bange Minuten vergingen. Dann trat Schwester Martha ein. Ihr freundliches Gesicht war ernst.
»Draußen wartet ein Kriminalkommissar, der Sie sprechen möchte«, sagte sie mit grollendem Unterton. »Wenn es Ihre Schwester ist«, fügte sie hinzu.
»Es ist meine Schwester«, erwiderte Monika verhalten. Thomas sah plötzlich unendliche Verwicklungen auf sich und auch auf seinen Bruder zukommen.
*
Dr. Norden erfuhr gewisse Einzelheiten von jemandem, an den er in diesem Zusammenhang am wenigsten gedacht hätte.
Kurz vor Beendigung seiner Sprechstunde erschien Isabel Guntram in seiner Praxis. Sie sah blendend erholt aus. Sie begrüßten sich freundschaftlich.
»Fehlen kann dir nichts bei diesem Aussehen«, stellte Daniel fest. »Also eine private Stippvisite.«
»Berufliche«, berichtigte Isabel.
»Wieso das?«
»Es gab heute nacht einen mysteriösen Unfall vor diesem Haus.«
Er runzelte die Stirn.
»Du bist doch nicht unter die Kriminalreporter gegangen?«, fragte er irritiert. »Dein Ressort ist doch die Mode, Gesellschaftsklatsch und so.«
»Eben das«, erwiderte Isabel gelassen. »Das Mädchen heißt Petra von Schönauer und betreibt mit ihrer Schwester Monika eine exklusive Boutique. Ich kenne beide und bin dort auch Kundin. Außerdem ist Monika mit Dr. Arndt verlobt.«
Das warf nun ein völlig anderes Licht auf diese Geschichte. Daniel war sofort hellwach.
»Das musst du mir erzählen«, sagte er. »Fahren wir hinauf. Ich kann Lenchen nicht schon wieder mit dem Essen warten lassen. Du kannst teilhaben an köstlichem Rinderbraten, den sie mir heute Morgen schon offeriert hat.«
Lenchen hatte zwar nichts gegen Isabel, aber seit Daniel mit Fee verlobt war, fand sie es doch sehr unpassend, wenn Isabel sich hier blicken ließ. Das wollte sie dem Herrn Doktor bei Gelegenheit schon mal sagen.
»Nun berichte mal«, forderte Daniel Isabel auf.
»Eigentlich wollte ich von dir etwas hören«, entgegnete sie.
»Ich möchte im Hintergrund bleiben, Isabel. Ich habe Erste Hilfe geleistet, und damit hat es sich. Dr. Behnisch behandelt das Mädchen in seiner Klinik. Woher hast du eigentlich von dem Unfall gehört?«
»Aus dem Polizeibericht. Unser Reporter weiß, dass ich Monika von Schönauer recht gut kenne.«
»Wen kennst du nicht!«, spottete er.
»Spar dir deine Scherze, Dan«, sagte sie freundlich. »Ich habe gedacht, mich haut es hin, als ich hörte, dass sich dies hier vor dem Haus zugetragen hat. Das ist doch kein Zufall. Uwe ist der Meinung, dass es mit dem Fall Sperber zusammenhängen könnte.«
»Was für einem Fall?«
»Du liest wohl nie Zeitung?«, spottete sie jetzt.
»Ich habe selten Zeit. Molly informiert mich über das Wichtigste, aber für Kriminalgeschichten habe ich keine Zeit. Worum handelt es sich?«
»Erpressung und Rauschgift. Vor allem Rauschgift. Dr. Arndt hat Sperbers Verteidigung übernommen.«
»Gut, aber warum sollte man die Schwester seiner Verlobten vor der Haustür aus dem Auto werfen?«
»Ja, dahinter möchte ich gern kommen.«
Daniels Gedanken schweiften ab.
»Der junge Arndt hat gesagt, dass er das Mädchen nicht kenne«, bemerkte er nachdenklich.
»Das kann gut möglich sein. Lange sind sie noch nicht verlobt. Petra ist viel unterwegs. Sie macht die Einkäufe für die Boutique. Sie hat außerdem ihren eigenen Freundeskreis. Ein supermodernes Mädchen.«
»Süchtig?«, fragte er.
»Gott bewahre! Nein, damit hat sie nichts zu tun. Des Rätsels Lösung muss anderswo liegen.«
»Anscheinend sind die beiden Arndts da ganz schön in Schwierigkeiten geraten«, äußerte Daniel gedankenvoll. »Ich will mich nicht einmischen, Isabel. Der Junge macht einen guten Eindruck.«
»Ich will doch auch nicht sagen, dass er schuldig ist. Ich vermute, dass jemand Dr. Arndt eins auswischen wollte und dass man Petra für Monika gehalten hat.«
»Du hast eine blühende Phantasie. Machst du gleich einen Roman daraus?«
»Das Leben schreibt manches Mal die spannendsten Romane, Dan. Ich will dir mal was von dem Fall Sperber erzählen. Es geht dabei um Rauschgift für mehrere hunderttausend Euro. Keine kleinen Fische. Sperber ist geschnappt worden, als er an der Grenze kontrolliert wurde. Sein Wagen wurde auseinandergenommen, und da fand man drei Kilo Opium, am Tag darauf in einem Omnibus eine ganze Ladung. Und dann trat ein Belastungszeuge auf, der behauptete, von Sperber erpresst worden zu sein, weil er mal ein Päckchen für ihn befördert hätte, worin sich auch Opium befand. Ja, und eben dieser Mann behauptet auch, dass Sperber der Kopf einer Bande sei.«
Daniels Augenbrauen schoben sich zusammen.
»Und wer ist Sperber?«
»Du kennst den Namen Sperber nicht?«, wunderte sich Isabel.
»Doch nicht etwa die chemische Fabrik?«, fragte Daniel verblüfft.
»Eben die, und der Vater Sperber hat sich den besten Anwalt gesucht, um seinen Sohn aus dieser Klemme zu befreien.«
»Ich wusste ja gar nicht, dass Arndt ein berühmter Strafverteidiger ist.«
»Was weißt du schon! Du kennst doch nur deinen Beruf.«
»Das sag nicht. Ich kenne auch hübschere Sachen.«
»Monika von Schönauer ist schön«, sagte Isabel.
»Ihre Schwester ist auch nicht übel. Muss eine phantastische Figur haben.«
»Das will ich überhört haben!«
»Dieter Behnischs Feststellung«, winkte Daniel ab. »Ich habe nur ihre Kopfwunde versorgt.«
»Jetzt sei endlich mal ernst, Daniel! Weißt du wirklich nicht mehr?«
»Nein, und ehrlich gesagt, würde ich nichts verraten, wenn ich etwas wüsste. Holt euch eure Informationen lieber bei der Polizei.«
»Ich bin doch keine Klatschbase. Ich frage nur in Monikas Interesse. Bei ihr gehen natürlich auch Hippis ein und aus. Es gibt einige, die viel Geld haben.«
»Womit der Ausdruck Hippi verfehlt wäre. Jedenfalls möchte ich nicht in Dr. Arndts Haut stecken.«
»Der Prozess findet morgen statt.«
»Kann er das Beweismaterial gegen diesen Sperber entkräften?«
»Dann würde der nicht mehr inhaftiert sein. Aber ein paar Eisen scheint Dr. Arndt schon im Feuer zu haben.«
»Warum fragst du ihn nicht selbst aus?«
»Der ist verschlossen wie eine Auster. Er liebt Publicity überhaupt nicht.«
»Und seine schöne Braut?«
»Die braucht sie natürlich, aber in diesem Fall wird er sie hoffentlich gewarnt haben. Ich habe schon versucht, sie anzurufen, aber es meldet sich niemand. Ihr Geschäft ist geschlossen.«
»Ja, liebe Isabel, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Mal was anderes. Wie weit ist denn deine Freundschaft mit Schoeller gediehen?«
»Sei nicht so neugierig, sage ich jetzt. Man kann sich jedenfalls prächtig mit ihm unterhalten.«
»Fährst du am Wochenende zur Insel?«
»Ich komme ja gerade erst von dort. Fährst du?«
»Ich kann nicht weg. Habe ein paar schwere Fälle. Hoppla, da fällt mir was ein. Du bist doch über unsere High Society bestens informiert. Was weiß man über Marlies Grothe?«
»Allmächtiger! Ist sie auch eine Patientin von dir?«
»Derzeit sind es ihr Sohn und ihr Mann, aber auch nur indirekt. Sie liegen beide bei Behnisch.«
»Und sie amüsiert sich in Monte Carlo mit einem italienischen Playboy. Neueste Nachrichten!«
»Wie gut, wenn man eine Freundin hat, die so bewandert ist auf allen Gebieten, von denen ich keine Ahnung habe.«
»Nett von dir, dass du mich noch als Freundin bezeichnest, Dan.«
»Warum sollte ich es nicht? Das bleiben wird doch hoffentlich?«
Es schmerzte immer wieder ein bisschen, wenn sie ihn ansah. So ganz war sie über ihre Liebe noch nicht hinweg, die sie ihm allerdings niemals eingestanden hatte.
Es waren tatsächlich immer nur freundschaftliche und rein platonische Beziehungen gewesen, die sie verbanden, und als sie gemeint hatte, es würde doch mehr werden, war Fee in sein Leben getreten.
»Danke auch für das gute Essen. Richte es Lenchen aus, und sie soll mich nicht immer so vorwurfsvoll mustern. Ich nehme Fee nichts weg.«
Das würde ihr auch nicht gelingen. Ihr nicht und einer andern auch nicht. Ungeteilt gehörte sein Herz Fee.
*
Monika hatte indessen ein sehr unangenehmes Verhör über sich ergehen lassen müssen, und Thomas wollte man zuerst nicht glauben, dass ihm die Schwester seiner zukünftigen Schwägerin persönlich noch nicht bekannt gewesen
sei.
Sie waren zum Polizeipräsidium gebracht worden. Monika durfte gehen, er nicht.
Vergeblich hatte man versucht, seinen Bruder zu erreichen, gegen den man offensichtlich ebenfalls Misstrauen hegte.
Und Thomas hatte doch bei Monika bleiben und sie nicht aus den Augen lassen sollen. Sie hatte es ihm von Herbert ausgerichtet.
Nun stand sie auf der Straße, voller Angst und Misstrauen gegen jedermann. Ins Geschäft wagte sie sich nicht, nach Hause auch nicht.
Sie fühlte sich belauert und verfolgt, während sie schnell die Straße überquerte und auf den Taxistand zuging.
Als sie dann in einem Taxi saß, war sie sogar misstrauisch gegen den Fahrer. Es war ein ganz gemütlicher Schwabe.
Wohin denn die Fahrt gehen solle, musste er sie zweimal fragen, bevor sie kurz entschlossen die Adresse von Herbert Arndts Kanzlei nannte.
Der Verkehr war sehr dicht. Das Taxi kam nur langsam voran.
Hinter ihnen war ein dunkler Wagen, und wieder fühlte sich Monika verfolgt. Sie atmete erleichtert auf, als der endlich abbog, und dann waren sie auch bald am Ziel.
Aber als sie oben ankam, stand sie vor verschlossener Tür.
Das Büropersonal musste doch wenigstens dasein! Doch es öffnete niemand auf ihr Klingeln, und dann vernahm sie Schritte auf der Treppe.
Ihr Herz schlug bis zum Hals. Sie hastete weiter hinauf und stand vor Dr. Nordens Praxis. Das war doch der Arzt, der Petra geholfen hatte!
Sie drückte auf die Glocke. Es summte, sie drückte gegen die Tür, und die tat sich auf. Mit einem Seufzer der Erleichterung ließ Monika sie wieder ins Schloss fallen.
Helga Moll saß in dem geräumigen Vorraum hinter ihrem Schreibtisch. Erstaunt blickte sie die elegante junge Frau an.
»Sind Sie vorgemerkt?«, fragte sie, da sie dieses Gesicht noch nie gesehen hatte.
»Nein. Mein Name ist Schönauer. Ich muss Dr. Norden unbedingt sprechen.«
»Er kommt erst in einer Stunde. Er macht Besuche. Heute ist auch alles belegt«, erwiderte Molly, die grundsätzlich keine Ausnahmen machte, wenn es sich nicht um einen dringenden Fall handelte.
»Bitte, schicken Sie mich nicht weg! Ich weiß nicht, wohin ich soll!«, stammelte Monika erregt. »Ich werde verfolgt! Dr. Norden hat heute Nacht meiner Schwester geholfen.«
Es klingelte, und Monika zuckte zusammen.
»Bitte, verstecken Sie mich!«, flüsterte sie. »Sagen Sie niemandem, dass ich hier bin!«
Molly war nun allerdings schon bestens informiert, denn ihre Tochter Sabine war Volontärin in Isabel Guntrams Redaktion.
Sie geriet ebenfalls in Erregung und schickte Monika ins Sprechzimmer, bevor sie den Türöffner betätigte.
Aber es war nur ein ihr wohlbekannter Patient, der seinen Krankenschein brachte. Er ging bald wieder.
Molly konnte Monika beruhigen, aber das war nicht so einfach. Sie zitterte am ganzen Körper.
»Möchten Sie ein leichtes Beruhigungsmittel?«, fragte sie. »Das kann ich Ihnen geben.«
»Bitte, ja«, flüsterte Monika. Und als sie es genommen hatte, erklärte sie, dass sie eigentlich zu ihrem Verlobten wolle, aber dass niemand in der Kanzlei sei.
Sie wollte per Telefon versuchen, jemanden zu erreichen, aber auch das war vergeblich.
»Sie können warten, bis Dr. Norden kommt. Der weiß bestimmt einen Rat«, sagte Molly zuversichtlich, da sie nicht verraten wollte, wie gut sie selbst informiert war. Sie war da vorsichtig, denn Dr. Norden liebte es gar nicht, wenn zu viel geredet wurde.
Daniel war indessen in der Klinik gewesen. Einmal, um nach Herrn Grothe und Uli zu sehen, zum andern aber auch, um zu erfahren, ob Petra von Schönauer ihr Erinnerungsvermögen zurückerlangt hätte.
Das musste Dr. Behnisch verneinen. Er erzählte Daniel, dass ihre Schwester mit dem jungen Arndt dagewesen sei, dass beide aber dann bald von einem Polizeiinspektor abgeholt wurden.
»Und bisher hat sie sich noch nicht wieder gemeldet.«
Komisch ist das schon, dachte Daniel. Sollte sie doch tiefer in die Sache verwickelt sein, als Isabel vermutete?
Er sollte sich sehr wundern, als er in seine Praxis zurückkam.
*
Dr. Behnisch bemühte sich erneut, mit Petra ins Gespräch zu kommen, da sie wieder erwacht war.
»Nun, wie geht es uns?«, fragte er freundlich.
»Etwas besser«, erwiderte sie leise.
»Petra von Schönauer heißt unsere hübsche kleine Patientin also«, unternahm er einen Vorstoß.
»Petra von Schönauer?«, wiederholte sie fragend, und es war, als lausche sie in sich hinein. »Ich kann mich wirklich an nichts erinnern, Herr Doktor. Glauben Sie mir doch! Es ist so, als wäre ich eben erst zur Welt gekommen.«
»Und was ist mit Monika?«
Ihr Gesicht zeigte nur Erstaunen. »Monika?«
»Ihre Schwester Monika«, sagte er.
»Meine Schwester Monika«, wiederholte sie monoton. »Habe ich eine Schwester?«
Tränen drängten sich plötzlich in ihre Augen.
»Es ist schrecklich, wenn man so grübelt. Es kann doch nicht alles ausgelöscht sein! Wie lange bin ich jetzt schon hier?«
»Achtzehn Stunden, aber grübeln Sie nicht. Es wird Ihnen schon alles von selbst wieder in Erinnerung kommen.«
»Wenn ich eine Schwester habe, warum kommt sie dann nicht?«
»Sie wird schon kommen. Wir werden sie verständigen.«
Er wollte sie nicht quälen. Er wusste, dass sie sich nicht verstellte. So konnte man sich nicht verstellen. Aber er machte sich Sorgen.
Ein Fall von Amnesie war ihm bekannt als Unfallfolge, wo der Patient niemals sein Erinnerungsvermögen zurückerhielt. Wie ein Fremder lebte er innerhalb seiner Familie, schwermütig seiner Vergangenheit nachforschend und immer wunderlicher werdend.
Da freute es Dr. Behnisch schon mehr, den kleinen Uli bei Bewusstsein zu sehen.
»Papi hat gesagt, dass er nur meinetwegen hier ist und sich ins Bett gelegt hat, damit ich nicht allein bin«, erklärte er mit heiserem Stimmchen.
Dr. Behnisch tauschte schnell einen Blick mit Werner Grothe. Unauffällig nickte er ihm zu.
Es war eine gute Idee gewesen, es dem Kind so zu erklären, denn wie sehr der kleine Uli an seinem Papi hing, konnte man ihm vom Gesicht ablesen.
»Schwester Annelie ist lieb«, versicherte der Kleine.
»Wirklich sehr aufmerksam«, warf Werner Grothe rasch ein. »Ich fühle mich richtig wohl bei Ihnen.«
»Wir bleiben noch lange«, sagte Uli. »Hier ist es so schön ruhig.«
Das sagte ein Kind, das daheim alles hatte, alles, bis auf eine fürsorgliche und verständnisvolle Mutter.
Armes reiches Kind, dachte Dr. Behnisch.
Nach seiner Mutter fragte Uli gar nicht. Schwester Annelie war genau die richtige Betreuerin für ihn, sicher auch für seinen Vater. Sie war sanft, sprach nicht viel, vor allem hörte man von ihr nicht das oberflächliche Geschwätz, mit dem Marlies Grothe ihre Familie zu unterhalten pflegte.
Dr. Behnisch hatte schnell herausgefunden, dass Werner Grothes Zusammenbruch auf seelischen Kummer zurückzuführen war.
Jedenfalls waren Vater und Sohn sehr angenehme Patienten, wie ihm auch Schwester Annelie bestätigte. Nicht nur das, sondern sogar anspruchslos. Sie läuteten nie wegen Nichtigkeiten, sie wollten nichts Besonderes.
Dr. Behnisch hatte den Eindruck, dass es Schwester Annelie leid tat, keine Nachtwache bei ihnen mehr halten zu müssen.
*
Daniel hatte also die Überraschung erlebt, Monika von Schönauer in seiner Praxis vorzufinden.
Er hörte, wie sie von Ängsten gepeinigt, von Unruhe getrieben, von Sorge um ihren Verlobten, ihre Schwester, auch um Thomas erfüllt war. Man sah es ihr auch an.
Er redete ihr Mut zu. Mehr konnte er augenblicklich nicht für sie tun. Und natürlich konnte sie in seiner Praxis bleiben.
Endlich, gegen fünf Uhr, konnte Molly Dr. Arndt unten in der Kanzlei erreichen. Immer wieder hatte sie es versucht. Da er seinerseits überall nach Monika gesucht hatte, konnte sie ihn von seinen Sorgen befreien.
Dr. Norden hatte in der Zwischenzeit seine bestellten Patienten untersucht, und der letzte war gerade gegangen, als Dr. Arndt kam, um seine verängstigte Verlobte abzuholen.
Mit einem befreienden Schluchzen fiel sie ihm um den Hals, und der sonst so zurückhaltende Herbert ließ es sich auch in Gegenwart von Molly und Dr. Norden gefallen.
»Was ist mit Thomas?«, fragte Monika.
»Ich habe ihn losgeeist. Bedauerlich ist nur, dass ich alle meine Karten aufdecken musste«, erwiderte er. Und für Dr. Norden setzte er erklärend hinzu: »Es geht um einen sehr schwierigen Prozess.«
Dass Dr. Norden schon ausreichend informiert war, konnte er nicht wissen.
Dr. Arndts große Sorge war, Monika nun irgendwo unterzubringen, wo niemand sie vermutete, und da wusste Daniel einen Rat.
»Warum nicht in der Behnisch-Klinik, in unmittelbarer Nähe Ihrer Schwester?«, fragte er Monika. »Ich bin mit Dr. Behnisch befreundet. Es ist öfter der Fall, dass ein naher Familienangehöriger bei einem Kranken bleibt. Und gerade in diesem Fall wäre es auch für die Patientin nur von Vorteil.«
Dr. Arndt war voller Zweifel, aber Monika nickte.
»Ja, ich glaube, dass dies am besten wäre, Berti«, sagte sie.
Für Dr. Norden gab es kein Problem, sie ungesehen aus dem Haus zu bringen, falls man dieses beobachten sollte.
Sein Wagen stand in der Tiefgarage. Dorthin gelangt man mit dem Lift.
Monika legte sich auf den Rücksitz. Eine Decke wurde über sie gebreitet, und auf diesem Weg verließ sie das Haus.
Vorher hatte Daniel Dr. Behnisch verständigt und mit ihm eine Verabredung getroffen, die auch vor der Klinik etwaige Beobachter täuschen sollte. Als sie dort anlangten, kamen zwei Krankenpfleger mit einer Tragbahre, auf welche die in Decken gehüllte Monika gelegt wurde.
Schließlich geschah es öfter, dass ein Arzt eine Kranke in die Klinik brachte. Monika gelangte so in Petras Zimmer.
Petra blickte ihr mit weit offenen Augen entgegen.
»Petra!«, sagte Monika bebend.
Forschend glitten die grüngrauen Augen über ihr Gesicht. In Petras war mehr Grün als Grau, in Monikas mehr Grau als Grün.
»Ich bin deine Schwester Monika, Petra!«, erklärte sie eindringlich.
»Wenn ich mich doch nur erinnern könnte!«, stöhnte Petra. »Es ist alles so leer.«
»Es wird wieder besser werden. Ich bleibe jetzt bei dir.«
»Was geschehen ist, hat man mir schon gesagt«, flüsterte Petra, »aber warum ist es geschehen?«
»Das weiß niemand«, erwiderte Monika ausweichend, denn sie war von Dr. Behnisch zu äußerster Vorsicht gemahnt worden.
»Bitte, erzähl mir etwas aus meinem Leben. Du musst doch alles wissen, wenn du wirklich meine Schwester bist.«
»Ich weiß alles von dir. Wo soll ich anfangen?«
»Bei der Kindheit. Wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, möchte ich doch wenigstens erfahren, wie ich bisher gelebt habe.«
Ihre Lebensgeister regten sich jetzt wieder, und Monika begann zu erzählen, nachdem sie eine Tasse Kaffee getrunken hatte, die Schwester Martha gebracht hatte.
»Du sorgst für Abwechslung, Daniel!« Mit diesen Worten verabschiedete sich Dr. Behnisch von Dr. Norden. »Immer mal was Neues!«
»Du wirst mich zum Teufel wünschen«, meinte Daniel.
»Ganz im Gegenteil. Ich wünschte, du wärest mein Partner, nicht nur Zubringer von interessanten Patienten.«
Mit einem festen, freundschaftlichen Händedruck gingen sie auseinander.
*
Immer mal was Neues gab es auch auf der »Insel der Hoffnung«. Heute war es ein Tanztee, bei dem Lissy ihre Erfahrungen als Tanzlehrerin ins rechte Licht rücken konnte. Man war mit Freuden dabei. Auf der »Insel der Hoffnung« sollten nicht nur Krankheiten ausgeheilt werden, sondern auch die Lebensfreude der Patienten sollte nicht zu kurz kommen.
Lissy war in ihrem Element, und dazu trugen auch die bewundernden Blicke bei, die Maximilian Moeller ihr zollte. Zudem erwies er sich als gelehrigster Schüler.
Darüber hatte Lissy ganz vergessen, dass Dr. Schoeller nicht anwesend war.
»Sagen Sie bloß, Sie können nicht tanzen«, sagte sie munter zu dem netten Maxi, wie sie ihn schon ungeniert nannte. Das gehörte nämlich auch zur Therapie, dass die Patienten sich untereinander mit dem Vornamen ansprachen.
»Es kommt immer auf die Partnerin an«, gab Maximilian hintergründig zurück.
»Sie können perfekt tanzen«, erklärte sie. »Ich habe doch meine Erfahrungen. Sie sind sehr sicher auf dem Parkett.«
»Bis man mal ausrutscht«, meinte er doppelsinnig. »Ich bin es im wahrsten Sinne des Wortes, Lissy.«
»Das müssen Sie mir ein anderes Mal erzählen«, flüsterte sie ihm zu. »Ich habe jetzt meine Pflichten.«
Es behagte ihm nicht, dass sie auch die anderen Herren herumschwenkte und von ihm wohl erwartete, dass er sich der Damen annahm. Aber es kam eine so fröhliche Stimmung auf, dass er sich mitreißen ließ.
Lissy war wie ein Quirl. Überall war sie und steckte die Gesellschaft mit ihrem Temperament an.
»Da geht es ja lustig zu«, sagte Dr. Cornelius zu Anne Fischer, die umsichtig die Verwaltung des Sanatoriums leitete. »Man sollte nicht meinen, dass wir Kranke zu betreuen haben.«
»Fröhlichkeit trägt zur Genesung bei«, äußerte sie lächelnd.
»Hoffentlich jammern sie morgen nicht wieder recht.«
»Höchstens über einen Muskelkater«, meinte sie.
»Warum schließt sich Katja aus? So ein bisschen könnte sie doch auch mitmischen«, bemerkte Johannes Cornelius nachdenklich.
Katja, Anne Fischers Tochter, war nach einem Skiunfall für einige Monate an den Rollstuhl gefesselt gewesen.
Es schien erst, als wäre alle ärztliche Kunst vergebene Mühe, aber auf der »Insel der Hoffnung« hatte sie die Schocklähmung überwunden.
Ihre Genesung hatte schnelle Fortschritte gemacht, doch ihr Seelenleben konzentrierte sich ganz auf den jungen Pianisten David Delorme, der einer der ersten Patienten auf der Insel gewesen war.
»Sie hört mal wieder Davids Platten, und wahrscheinlich schreibt sie ihm wieder einen Roman«, sagte Anne seufzend. »Manchmal mache ich mir Sorgen, Johannes.«
»Sie ist jung. Sie schwärmt für ihn, und anscheinend hat er Katja doch auch nicht vergessen. Sollte man sich da einmischen? Jeder Mensch muss mit seinen Problemen fertig werden. Fee kann ich auch nirgends sehen. «
»Sie telefoniert schon seit einer halben Stunde mit Dr. Norden.«
»Damit die Post nicht pleite geht«, bemerkte er lachend.
Er wunderte sich dann doch, dass Fee mit so ernster Miene am Schreibtisch saß, als er in das Verwaltungsgebäude kam.
»Na, was haben wir denn für Sorgen?«, fragte er nachsichtig.
»Daniel erlebte einen ganzen Kriminalroman«, erwiderte Fee. »Es ist allerhand los bei ihm.«
Er wollte natürlich Genaueres wissen, und Fee musste Bericht erstatten.
»Was soll man dazu sagen«, meinte Dr. Cornelius kopfschüttelnd. »Was da so alles passiert. Wir haben anscheinend eines der letzten Paradiese hier. – Willst du nun nicht hinfahren?«, sagte er nach längerem nachdenklichem Schweigen.
»Doch, Paps, wenn du es erlaubst.«
»Dummerchen! Wir haben uns doch darauf eingerichtet.«
»Dann fahre ich Samstag früh.«
»Meinetwegen auch schon morgen Nachmittag.«
Ein heller Schein huschte über ihr Gesicht.
»Danke, Paps!«, sagte sie erfreut.
*
Es war Zeit zum Abendessen. Der Tanztee mit recht erfolgreichem Unterricht war beendet. Die heitere Stimmung hielt jedoch an. An Appetit fehlte es jetzt nicht. Nur Maximilian Moeller bediente sich recht sparsam.
»Warum essen Sie nicht, Maxi?«, fragte Lissy aufmunternd. »Angst um die schlanke Linie?«
Ihn bewegten andere Gedanken, wenn er in ihr hübsches Gesicht blickte.
»Wollen wir nachher noch einen Spaziergang machen?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Aber gern.« Sie war jetzt keine Spur kokett, sondern nur kameradschaftlich.
Dass ihn irgendetwas bedrückte, konnte ihr nicht entgehen. Auch in ihrem Beruf eignete man sich eine gewisse Menschenkenntnis an.
Es war ein schönes windstiller Abend.
»Hier könnte man alles vergessen«, begann Maximilian gedankenverloren.
»Tun Sie das, wenn etwas Sie bedrückt. Man soll nicht allzu viel Gefühlsballast mit sich herumschleppen.«
»Es ist ein anderer Ballast«, sagte er.
Das Temperamentsbündel konnte auch eine verständnisvolle Frau sein. Lissy legte ihre Hand auf seinen Arm.
»Sie wollen etwas loswerden, Maxi, also tun Sie sich keinen Zwang an. Wir verstehen uns doch mittlerweile schon ganz prächtig.«
»Ob es auch so bleibt, wenn ich Ihnen meine Geschichte erzählt habe?«, fragte er skeptisch.
»Warum nicht? Halten Sie mich für so oberflächlich? Ich habe auch meine Sorgen. Ich habe gelernt, sie niemandem zu zeigen. Man ist gern gesehen, wenn man lacht und sorglos erscheint, aber wer will schon mit den Sorgen anderer konfrontiert werden. «
»Das sind meine Gedanken, bevor ich von mir spreche, Lissy.«
»Das sollten sie gewesen sein«, sagte sie. »Sie brauchen sich solche Gedanken nicht zu machen.«
»Es ist eine Geschichte, die wohl recht oft passiert. Eine reizvolle Frau und ein verblendeter Mann. Jahre hat er gebraucht, um etwas zu schaffen, um ein gestecktes Ziel zu erreichen. Dann begegnete ihm eine Frau, die ihm völlig den Kopf verdrehte. Es machte ihn glücklich, ihr jeden Wunsch erfüllen zu können, und sie hatte viele Wünsche.
Er verschwendete allerdings auch zu viel Zeit an sie, nicht nur Geld, und merkte nicht, dass er von seinem Prokuristen, dem er ganz vertraute, hintergangen wurde. Und so war er eines Tages am Ende. Mit allem am Ende, denn einen armen Mann wollte die Frau nicht haben. Die Hochzeit war bereits festgesetzt, aber sie gab ihm den Laufpass. Er wollte nicht aufgeben, so verbohrt war er. Er fuhr zu ihrer Wohnung, die er ihr eingerichtet hatte, aber dort fand er bereits einen andern vor, und er ließ sich sogar zu einer heftigen Auseinandersetzung hinreißen. Dabei, ich sagte es Ihnen schon, rutschte er aus und hätte sich fast das Genick gebrochen. Acht Wochen lag er in der Klinik und hatte Zeit zum Nachdenken.«
Er machte eine Pause, und Lissy sagte eine Weile auch nichts. Dann sah sie ihn nachdenklich an. »Und wie kam er dann auf die ›Insel der Hoffnung‹?«, fragte sie.
»Durch einen Mann, der bereit war, dem Dummkopf eine Chance zu geben.«
»Was Sie davon überzeugen sollte, dass das Gute über Böses siegt«, sagte Lissy.
»Glauben Sie daran?«
»Gewiss!«
»Und was halten Sie von dem Dummkopf?«
»Dass er ein ehrlicher Mensch mit einem kindlichen Gemüt ist, wie eine gewisse Lissy. Wir können uns die Hände reichen. Es gibt auch törichte Frauen. Gleich zu gleich gesellt sich gern, sagt man doch. Wir scheinen dafür einen Riecher zu haben.«
Sie hakte sich fester bei ihm ein, und er legte scheu seine Hand auf ihre.
»Ich erzähle Ihnen auch eine Geschichte. Es war einmal ein sehr törichtes Mädchen, bis über beide Ohren in einen Mann verliebt, der große Pläne hatte. Pläne, die eine Menge Geld kosteten. Sie schuftete und schuftete, damit er seine Pläne verwirklichen konnte. Und was tat er? Er amüsierte sich mit ihrem sauer verdienten Geld mit anderen. Lustig, was?«
»Gar nicht lustig«, erwiderte er heiser.
»Sie träumte von einem erfolgreichen Mann, einem schönen Heim und Kindern, und er verschwand auf Nimmerwiedersehen. Aber sie war immer noch so optimistisch, zu glauben, dass man nicht alle Männer in einen Topf werfen solle. Sie steckte nicht auf und lebte ihr Leben nun auf ihre Weise. Immer mal ein kleiner Flirt, aber mehr nicht.«
»Und wie’s drinnen aussieht, geht niemand was an«, murmelte er.
»Ich resigniere nicht, Maxi«, sagte sie lächelnd. »Das Leben soll wert sein, gelebt zu werden. Fallen ist keine Schande, nur das Liegenbleiben. Man hat Ihnen eine Chance gegeben. Nehmen Sie sie wahr.«
»Wollen wir morgen einen Ausflug machen?«, fragte er plötzlich.
»Warum nicht? Ich schaue mir gern die Gegend an.«
»Ich möchte Sie mit dem Mann bekannt machen, der mir die Chance gibt. Er lebt auf der Riefler-Alm.«
»Wollen Sie Einsiedler werden?«, fragte Lissy neckend.
»Ganz im Gegenteil. Er heißt William Docker und ist ein sehr reicher Mann. Er musste auch erst einiges durchmachen, um zur Selbsterkenntnis zu gelangen. Er wollte nicht wahrhaben, dass seinem einzigen Sohn eine Frau wichtiger sein könnte als aller materieller Besitz. Davon musste er sich überzeugen lassen. Und nun braucht er einen Mann, der seine Geschäfte weiterführt, damit er viel Zeit für seine Enkel hat.«
»Da ist Ihnen doch eine große Aufgabe zugedacht worden. Wollen Sie noch mit der Vergangenheit hadern, Maxi?«, fragte Lissy.
»Es gäbe jetzt noch etwas«, sagte er zögernd. »Würde es Ihnen sehr schwer fallen, Ihre Tanzschule aufzugeben, Lissy?«
»Das kann ich mir gar nicht leisten«, erwiderte sie.
»Ich will damit sagen, ob Sie sich entschließen könnten, mit mir nach Amerika zu gehen.«
Lissy hielt den Atem an.
»Sind Sie sicher, dass Sie nicht wieder einen Fehler machen?«, fragte sie herzklopfend.
»Ganz sicher.«
»Lernen Sie mich lieber erst ein bisschen besser kennen, lieber Maximilian«, erklärte Lissy ernst. »Wir haben ja noch ein bisschen Zeit dazu.«
Aber es war doch ein schönes Gefühl, als er den Arm um sie legte, während sie zurückgingen. Sie ließen sich Zeit dafür. Sie konnte ihren Kopf an seine Schulter lehnen und schon ein bisschen davon träumen, dass es auch für sie noch ein echtes Glück geben würde.
»Insel der Hoffnung«, sagte sie träumerisch.
Er ergriff ihre Hände und küsste sanft ihre frischen Lippen.
»Und der Erfüllung«, fügte er dann hinzu.
*
Monika von Schönauer lag auf einer Notliege, den Kopf in die Hand gestützt, und blickte zu ihrer Schwester hinüber.
Nur das matte Licht der Nachtlampe erhellte das Zimmer.
»Gestern bin ich also aus Paris zurückgekommen«, sagte Petra schleppend.
Monika konnte es selbst fast nicht glauben, dass sich innerhalb von vierundzwanzig Stunden so viel zutragen konnte.
»Ja, und dann haben wir die Schaufenster dekoriert. Du hast mir geholfen, obgleich du zu Uschis Geburtstagsparty eingeladen warst.«
»Wer ist Uschi?«
»Deine Freundin.«
Noch immer kam Petra keine Erinnerung.
»Ich weiß nicht, der Schlag auf den Kopf muss sehr heftig gewesen sein«, bemerkte sie.
»Du bist aus einem fahrenden Auto gestoßen worden und auf die Straße gestürzt.«
»Ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen«, sagte Petra, »ja, einen sehr heftigen Schlag.«
Monika sprang auf und setzte sich an Petras Bett.
»Du erinnerst dich?«, fragte sie erregt.
Petras Blick war abwesend.
»Uschi«, murmelte sie, »ich wollte zu der Geburtstagsparty. Ich ging zu unserm Parkplatz. Mein Wagen stand neben deinem. Ein Mann trat auf mich zu und sagte, er wäre von der Polizei. Ich dachte … ja, was dachte ich? Jetzt weiß ich es wieder, Monika. Mein Gott!« Tränen rannen ihr über die Wangen, und aufschluchzend umarmte sie ihre Schwester. »Ich dachte, jemand hätte sich an meinem Wagen zu schaffen gemacht. Ich hatte doch noch mein ganzes Gepäck drin.«
»Es ist alles noch da«, erklärte Monika. »Ich habe mich davon überzeugt. Ich dachte, du wärest mit der U-Bahn gefahren, weil es bei Uschi so schlechte Parkmöglichkeiten gibt. Erzähl weiter. Wie sah der Mann aus?«
»Er war ziemlich groß und blond, nicht sehr sympathisch. Aber er ließ mir gar keine Zeit, eine Frage zu stellen. Er schob mich in eine dunkle Limousine.«
»In einen Volvo?«
»Ich weiß nicht. Ich war so verwirrt. Ich sah noch einen andern Mann, und dann bekam ich auch schon den Schlag auf den Kopf. Von da an weiß ich nichts mehr. Was hat dieser Überfall zu bedeuten?«
»Sie haben uns verwechselt. Sie wollten mich haben, um Bert zu erpressen.«
» Aber warum das alles?«, fragte Petra verstört.
Das erzählte ihr Monika dann auch noch. Sie hatte ihre Liege dicht an Petras Bett gerückt und hielt die Hand ihrer Schwester.
»Ich bin so froh, dass du lebst«, sagte sie, als sie mit ihrem Bericht zu Ende war. »Und was meinst du, wie froh Thommy sein wird, wenn alles wieder gut wird.«
Aber noch blieben viele Fragen offen. Monikas letzte Gedanken vor dem Einschlafen galten ihrem Verlobten.
Sie dachte nicht daran, wie wichtig es für ihn sein könnte, zu wissen, woran Petra sich erinnerte. Sie war nur müde.
Morgen früh, bevor Herbert Arndt zum Gericht fuhr, wollte er sie besuchen. Da konnte sie ihm alles erzählen. So meinte sie.
*
Dr. Norden kam gegen neun Uhr von Hausbesuchen zurück. Wie immer wollte er noch einmal den automatischen Anrufbeantworter in seiner Praxis abhören. Es konnte ja möglich sein, dass er irgendwo dringend gebraucht wurde.
Er fuhr mit dem Lift empor. Als sich die Tür öffnete, sah er einen Mann vor seiner Praxis stehen. Er drückte auf die Klingel.
Als Daniel neben ihm stand, drehte er sich um und fragte atemlos, so, als wäre er eben schnell die Treppe heraufgelaufen: »Sind Sie Dr. Norden?«
Daniel hätte nicht sagen können, warum ihm in den Sinn kam, dass dieser Mann gerade jetzt die Treppe heraufgelaufen war, anstatt den Lift zu benutzen.
»Gott sei Dank, dass ich Sie treffe!«, sagte der Mann in gebrochenem Deutsch. »Ich habe mich verletzt.«
Tatsächlich lief Blut über seine Hand. Daniel schloss die Tür auf. Schließlich war er Arzt, und wenngleich er auch keinen Nachtdienst hatte, musste er in einem Notfall helfen, wenn er wie eben jetzt zugegen war.
»Meine Name ist Miller«, stellte sich der Fremde vor. Er war mittelgroß und schmächtig und sehr gut gekleidet. Er war auch sehr darauf bedacht, dass kein Blut an seinen Anzug kam.
Seine Erklärung, dass er eine Autopanne gehabt und sich beim Reifenwechsel verletzt hätte, machte Daniel stutzig; denn eine solche Schnittwunde konnte man sich beim Reifenwechsel kaum zuziehen.
Außerdem blieb es bei einer solchen Tätigkeit nicht aus, dass man schmutzig wurde.
Der Schnitt war nicht tief, er blutete nur stark.
»Das werden wir gleich haben«, sagte Daniel gleichmütig. »Sie haben Glück, ich bin eben erst von Krankenbesuchen zurückgekommen.«
Herr Miller – Engländer oder Amerikaner war er nach seinem Akzent bestimmt nicht, eher Südländer – meinte wohl, erklären zu müssen, wieso er ausgerechnet zu ihm käme. Ein Straßenpassant hätte ihm den Namen von Dr. Norden genannt. Man hätte ihm aber auch gesagt, dass er aufpassen solle, weil sich in der vorigen Nacht hier erst ein mysteriöser Unfall ereignet hätte.
Bei Daniel klingelte ein Glöckchen. Ihm kam sowieso alles komisch vor, aber jetzt war er doppelt auf der Hut.
»So kann man in Verruf kommen«, bemerkte er leichthin.
Herr Miller wurde sehr gesprächig. Er wäre wohl ein bisschen sensationslüstern, meinte er mit einem albernen Lachen, aber was wäre denn eigentlich passiert?
Daniel betrachtete ihn mit einem durchdringenden Blick, dem er aber standhielt. Er musste ganz schön abgebrüht sein, wenn sein Erscheinen einen ganz bestimmten Zweck hatte.
»Das wird wahrscheinlich morgen alles in der Zeitung stehen«, erwiderte Daniel ausweichend. »Ich bin sehr beansprucht.«
Liebend gern hätte er in Erfahrung gebracht, was Herr Miller wirklich bezweckte, aber wie sollte er es anfangen, ohne ihn misstrauisch zu machen?
»Dann will ich Sie jetzt nicht länger aufhalten«, erklärte der andere. »Was bin ich Ihnen schuldig?«
Warum hatte er es plötzlich so eilig? Weil irgendwo eine Tür ins Schloss gefallen war? Daniel hatte es gehört.
»Darf ich noch um Ihre Personalien bitten?«, sagte er.
»Ich wohne nicht hier. Ich bin nur auf der Durchreise. Genügen zwanzig Euro?«
Er legte einige Geldscheine auf den Tisch, zog eilig seine Jacke an und war schon an der Tür.
»Vielen Dank, Herr Doktor.« Und dann war er draußen.
Zurück blieb ein zusammengeknülltes Taschentuch, das blutbefleckt war.
Mit spitzen Fingern hob Daniel es vom Boden auf, aber da sah er noch etwas liegen. Einen Zettel, den der Fremde wohl absichtlich aus der Tasche gezogen haben musste, denn Molly ließ nie etwas liegen.
Das Taschentuch konnte keinen Aufschluss geben über die wahre Persönlichkeit dieses Mannes. Aber was war mit dem Gekritzel auf dem Zettel, den Daniel nun glatt strich?
Arabische Schriftzeichen und eine Telefonnummer. Sonst nichts. Eine Münchner Nummer?
Daniel fühlte sich versucht, sie zu wählen, aber konnte das nicht für jemand eine Warnung sein?
Ich habe früher wohl ein bisschen zuviel Krimis gelesen, dachte er, aber er verwahrte den Zettel doch sorgfältig in seiner Brieftasche.
*
In seiner Wohnung erwartete ihn eine weitere Überraschung. Dr. Herbert Arndt in Lebensgröße.
»Ihre reizende Haushälterin war so liebenswürdig, mir Glauben zu schenken, dass ich Sie dringend sprechen müsste«, erklärte er. »Zum Glück sind wir uns schon mehrmals im Lift begegnet, sodass ich sie nicht erst davon überzeugen musste, dass ich Ihnen nichts Übles will.«
Obgleich er es mit einem Lächeln sagte, bemerkte Daniel, dass er überaus nervös war.
»Brauchen Sie ärztliche Hilfe, Herr Arndt?«, fragte er.
»Nein, nur einen Menschen, dem ich rückhaltlos vertrauen kann.«
»Wenn Sie mich damit meinen, besten Dank«, bemerkte Daniel. »Einen Drink?«
»Nein, ich muss noch fahren. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Ich wollte Sie bitten, einige sehr wichtige Akten für mich aufzubewahren.«
Er sprach abgehackt, geisteabwesend, und er wirkte sehr erschöpft.
»Setzen Sie sich doch bitte«, sagte Daniel freundlich. »Sie machen einen müden Eindruck.«
»Ich darf jetzt nicht müde werden. Morgen beginnt ein schwerer Prozess. Er wird vertagt werden, weil ich einige Beweismittel für die Schuldlosigkeit meines Klienten noch nicht beschaffen konnte. Deswegen muss ich eine Reise antreten.«
»Sie haben sich da anscheinend in eine gefährliche Geschichte eingelassen.«
»Risiken kann ein Strafverteidiger nicht ausschließen. Ich lasse mich nicht zur Kapitulation zwingen. Jetzt erst recht nicht, nachdem Petra fast ums Leben gekommen wäre. Außerdem weiß ich zu viel über die Hintergründe dieser Affäre, als dass man mich in Ruhe lassen würde. Diese Akten hier«, er deutete auf den schwarzen Lederkoffer, »müssen in Sicherheit sein. Wenn mir etwas zustoßen sollte, bitte ich Sie, den Koffer Kommissar Wetzel zu übergeben. Würden Sie das für mich tun?«
»Gewiss, Herr Arndt, aber wäre es nicht besser, wenn Sie die Nachforschungen der Polizei überlassen würden?«
»Ich habe meine Gründe, dies nicht zu tun. Ich will den jungen Sperber von jedem Verdacht befreien. Dürfte ich Sie auch noch bitten, Monika über meine Abwesenheit zu beruhigen? Wenn alles gutgeht, bin ich am Samstag zurück.«
»Dann nehmen Sie sich mal schön in acht«, sagte Daniel. und verschloss den Koffer vor Dr. Arndts Augen in seinem Safe.
An den geheimnisvollen Besucher und an den Zettel in seiner Brieftasche dachte er erst wieder, als Dr. Arndt gegangen war.
Er hörte dessen Wagen davonfahren und trat hinaus auf die Dachterrasse.
Die Großstadt ging schlafen. Die Lichter in den Häusern verlöschen.
Wie viel Straftaten mochten in dieser und in anderen Nächten begangen werden, über die es dann nicht mal eine kurze Zeitungsnotiz gab oder nur eine so unauffällige, dass man darüber hinweglas.
Würde diese Affäre noch Schlagzeilen machen? Und wenn schon, bald würden auch solche vergessen sein. Zu schnelllebig war die Zeit. Zu kurz war das Gedächtnis für Dinge, von denen man nicht persönlich betroffen war.
»Wollen Sie gar nichts mehr essen?«, fragte Lenchen hinter ihm. Zu seiner Verwunderung war sie noch aufgeblieben. »Dr. Arndt ist ein feiner Mann«, sagte sie, »immer höflich und zuvorkommend. Was fehlt ihm denn? Doch hoffentlich nichts Ernstes?«
»Ruhe, Lenchen, nur Ruhe«, erwiderte Daniel gedankenverloren.
»Ein Rechtsanwalt hat es auch nicht besser als ein Arzt«, brummte sie. »Wohl dem, der weder den einen noch den andern braucht.«
Lenchen hatte ihre eigene Philosophie, aber heute konnte Daniel nicht mal darüber lächeln.
»Immerhin ist es noch besser, wenn ein Anwalt den Arzt braucht, als der Arzt den Anwalt«, meinte Lenchen noch, bevor sie gute Nacht sagte.
*
Geweckt wurde Daniel am nächsten Morgen von zärtlicher Musik. Fee hatte ihm diesen Radiowecker geschenkt, da sie ihn nicht jeden Morgen mit einem Anruf erfreuen konnte, seit sie im Sanatorium so eingespannt war und dort der Tag sehr früh begann.
Die Gedanken an sie wurden verdrängt, als Lenchen ihm die Zeitungen brachte. Ihr Finger deutete auf eine fettgedruckte Schlagzeile.
»Prozess gegen Jürgen Sperber vertagt. Legt Dr. Arndt sein Mandat nieder?«
Wie sie es nur gleich immer erfuhren, diese Reporter, und wie sie es verstanden, aus allem eine Sensation zu machen.
Aber vielleicht war das in diesem besonderen Fall günstig für Dr. Arndt. Jene, die ihn zu fürchten hatten, mochten beruhigt sein.
Viertel vor acht Uhr rief Dieter Behnisch an.
»Entschuldige, dass ich dich so früh störe, Daniel, aber Fräulein von Schönauer macht sich Sorgen um ihren Verlobten. Er wollte heute ganz früh kommen. Sie hat schon in seiner Wohnung angerufen, aber er meldet sich nicht. In der Kanzlei ist auch noch niemand. Ich muss jetzt in den OP. Könntest du versuchen, ihn zu erreichen?«
»Er ist nicht da. Ich komme schnell mal rüber und spreche mit Fräulein von Schönauer. Wie geht es der Schwester?«
»Ach ja, das wollte ich dir noch sagen. Sie erinnert sich wieder an alles. Das wollten Sie Dr. Arndt auch sagen.«
»Das sollen sie lieber der Polizei sagen. Also, ich komme gleich.« –
Beruhigen ließ Monika sich nicht. Sie war zu ihm auf den Gang gekommen, weil Schwester Martha Petra versorgte. Außerdem brauchte Petra auch nicht alles zu wissen, worüber sie sich aufregen könnte.
»Bert muss triftige Gründe haben, wenn er das Mandat niederlegen will«, sagte Monika. »Ich habe die Zeitung schon gelesen.« Es war verständlich, dass sie sich dafür interessierte, was man über den Anschlag auf sie, dem Petra zum Opfer gefallen war, berichten würde, aber darüber stand nichts drin.
»Er wird das Mandat nicht niederlegen. Er will nur Zeit gewinnen«, erklärte Daniel.
»Wird er sich nicht unnötig in Gefahr begeben? Ich kenne Bert. Er ist nicht zu bremsen.«
»Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Er hat mir dringend ans Herz gelegt, Sie zu beruhigen. Er wird morgen zurück sein.«
Sonst verriet er ihr nichts. Er riet ihr nur nochmals, umgehend der Polizei Mitteilung zu machen von dem, was Petra ihr erzählt hatte.
Als er zu seiner Praxis zurückkehrte, fuhr vor ihm ein amerikanischer Wagen neuester Bauart, aber mit deutschem Kennzeichen. Er hielt vor seinem Häuserblock.
Daniel fuhr langsam daran vorbei und sah, wie ein großer blonder Mann mit einer auffallenden Hakennase ausstieg. Sofort erwachte sein Spürsinn wieder.
Er stieg ebenfalls aus und betrat das Haus gerade in dem Augenblick, als der Blonde in den Lift stieg.
Er schien sich völlig sicher zu fühlen, denn er drehte sich nicht einmal um.
An den Lichtzeichen konnte Daniel verfolgen, in welchem Stockwerk der Lift hielt. Es war das, in dem sich Dr. Arndts Kanzlei befand.
Daniel holte den Lift herunter und fuhr zu seiner Praxis hinauf.
Molly war eben gekommen und noch dabei, ihre Schreibutensilien hervorzuholen.
Er nickte ihr nur zu und stürzte ans Telefon.
Er wählte Dr. Arndts Nummer und war bass erstaunt, als sich Thomas Arndt meldete. Seine Stimme klang merkwürdig gepresst.
»Antworten Sie nur mit Ja oder Nein, falls ein großer, blonder Mann gekommen ist«, sagte Daniel.
Molly riss die Augen auf. Daniel legte seinen Finger auf den Mund.
»Halten Sie ihn fest. Ich benachrichtige die Polizei«, erklärte Daniel leise, aber jede Silbe betonend.
»Okay, bis später«, tönte Thommys Stimme erleichtert durch den Draht.
»Was ist denn nun wieder los?«, fragte Molly.
»Bezähmen Sie Ihre Neugierde, ich muss dringend telefonieren.«
Er verschwand in seinem Sprechzimmer, da jeden Augenblick Patienten kommen konnten.
»Sind wir nun eine Arztpraxis oder ein Detektivbüro«, murmelte Molly vor sich hin. Aber das Gespräch hatte nicht lange gedauert.
»Hoffentlich geht da unten alles gut«, sagte er besorgt.
Er ahnte nicht, dass Thommy auch während des kurzen Gesprächs mit ihm in die drohend auf ihn gerichtete Mündung eines Revolvers geblickt hatte.
*
»Also, heraus mit der Sprache! Wo ist Dr. Arndt?«, fragte der Blonde.
Obgleich es Thommy recht unbehaglich war, frohlockte er innerlich, weil der andere ihn nicht zu kennen schien.
»Erkrankt«, erwiderte er lakonisch. »Warum bedrohen Sie mich mit dem Schießeisen? Habe ich Ihnen was getan?«
»Ich möchte mich hier mal ein bisschen umsehen«, erklärte der Blonde zynisch.
»Bitte, bedienen Sie sich.«
»Wann kommt das Personal?«
Thommy blickte auf die Uhr, um Zeit zu gewinnen.
»Die Sekretärin kommt halb neun. Die andern sind beurlaubt.«
»Und Sie übernachten hier wohl«, sagte der Fremde sarkastisch.
»Ganz recht. Damit verdiene ich mir ein Taschengeld.«
Nun steuerte der Fremde auf das Regal zu, in dem die Aktenordner standen. Das Telefon klingelte.
»Ich darf doch wohl bedienen?«, fragte Thommy.
»Wie gehabt, aber kein falsches Wort, sonst knallt es!«
Thommy nahm den Hörer ab.
»Anwaltskanzlei«, meldete er sich.
Und dann hätte er doch beinahe die Fassung verloren, denn eine Stimme sagte: »Betätigen Sie unauffällig den Türöffner.«
Er schnappte nach Luft.
»Nein, Dr. Arndt ist nicht zu sprechen. Er ist erkrankt«, entgegnete er rasch.
»Immer mit der Ruhe, Freundchen. Nur keine Aufregung«, erklärte der Blonde, während sich Thommys Finger auf den Türöffner tastete.
»Ich bin nicht aufgeregt«, sagte er dabei laut, um das Summen zu übertönen.
»Und nicht so brüllen!«, äußerte der Fremde warnend.
Doch da ertönte schon das Kommando: »Hände hoch! Waffe fallen lassen!«
Thommy atmete hörbar auf. Der Blonde war so überrascht, dass er den Revolver fallen ließ, und gleich darauf schlossen sich Handschellen um seine Gelenke.
Ein hassvoller Blick traf Thommy, aber der konnte ihn nicht erschüttern.
Zehn Minuten später kam er in Dr. Nordens Praxis gestürmt. Daniel hatte gerade seinem ersten Patienten eine Spritze verpasst.
»Alles okay, Sie sind einfach toll!«, sagte Thommy mit jungenhaftem Enthusiasmus. »Wie konnten Sie denn ahnen, dass dieser Kerl in der Kanzlei war?«
»Ich habe ihn gesehen.«
»Und woher wussten Sie, dass etwas mit ihm nicht stimmte?«
»Weil er der Mann ist, der Petra von Schönauer aus dem Auto geworfen hat. Die Zusammenhänge erkläre ich Ihnen später mal. Jetzt muss ich mich um meine Patienten kümmern.«
Dass der Blonde abgeführt worden war, wusste Daniel schon von Molly, die es vom Fenster aus beobachtet hatte. Und was er in der Kanzlei gesucht hatte, ahnte er.
Dr. Arndt mochte es auch geahnt haben, da er ihm die Akten anvertraut hatte.
Der Vormittag sollte nicht vorübergehen, ohne noch einen weiteren Zwischenfall zu bringen.
Daniel machte gerade einer Patientin klar, dass sie ihre Medikamente regelmäßig nehmen müsse, auch wenn diese nicht gut schmeckten, als Molly hereinkam und ihm bedeutungsvolle Handzeichen machte.
»Da ist ein Herr Miller, der behauptet, gestern bei Ihnen gewesen zu sein«, flüsterte sie ihm zu. »Ein komischer Kerl.«
»Er soll warten, und wenn er bei mir ist, rufen Sie diese Nummer an, Molly«, sagte Daniel leise. »Sie sollen dringendst kommen.«
Molly starrte auf den Zettel, den er schnell geschrieben hatte, dann starrte sie ihn an.
»Ogottogott!«, seufzte sie. »Wann wird endlich wieder Ruhe einkehren.«
*
»Na, Herr Miller, Komplikationen?«, fragte Daniel. »Lassen Sie mich die Wunde mal sehen. Wir hätten wohl lieber noch eine Tetanusspritze machen sollen.«
»Nein, nein, deswegen komme ich nicht«, sagte Miller unsicher. Seine Augen hatten einen gehetzten Ausdruck.
»Wegen des Taschentuchs? Das haben wir aufgehoben«, bemerkte Daniel lässig.
»Ich suche krampfhaft einen Zettel, auf dem ich eine Telefonnummer notiert hatte. Habe ich ihn vielleicht hier verloren?«
»Nein, tut mir leid, einen Zettel habe ich nicht gefunden.«
»Zu dumm, ich habe die Nummer nicht im Kopf. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nochmals gestört habe.«
»Macht gar nichts. Bei der Gelegenheit will ich mir doch lieber nochmals Ihre Hand anschauen. Das ist im Honorar inbegriffen.«
»Es tut gar nicht mehr weh«, sagte Miller nervös. »Ich war nur erschrocken, weil es so geblutet hat.«
»Ja, so war es bei dem Unfallopfer neulich abends auch. Sie interessierten sich doch für den Vorgang. Zum Glück haben sich die Verletzungen als ungefährlich erwiesen. Die junge Dame ist auf dem Weg der Besserung.«
»Das freut mich.«
Daniel hatte das Pflaster von der Hand gelöst. »Sieht ja gut aus«, bemerkte er. »Seien Sie nur vorsichtig, falls Sie mal wieder ein Rad wechseln müssen.«
Vielleicht klang das doch zu spöttisch. Jedenfalls spiegelte sich auf dem hageren Gesicht Misstrauen und Furcht.
Er schrak zusammen, als es läutete. Seine Augen irrten umher, als suchte er nach einem Fluchtweg. Doch es blieb ihm keiner.
»Gemeiner Hund!«, sagte er zu Daniel, als die beiden Polizisten in der Tür standen.
»Aber, aber«, meinte Daniel sarkastisch, »warum denn gleich so böse! Die Herren wollen doch nur ein paar Fragen an Sie stellen.«
»Polente und fragen!«, stieß der andere hervor.
»Nun sehen wir uns ja wieder, Baku«, bemerkte der eine Polizist. »Na, dann wollen wir mal.«
»Sie können mir nichts beweisen, gar nichts!«
»Das wird sich ja herausstellen.«
Er wurde abgeführt. Der zweite Polizist blieb noch einen Augenblick bei Daniel zurück.
»Weiter so, Herr Doktor«, sagte er bewundernd. »Zwei an einem Vormittag, und was für Gauner!«
»Mir langt es für die nächste Zeit«, entgegnete Daniel. »Aber hier ist der Zettel, wegen dem Herr Miller oder Baku, oder wie er sonst heißen mag, kam. Vielleicht hilft der Ihnen noch weiter.«
Und dann erzählte er noch rasch, wie er die Bekanntschaft von Baku gemacht hatte.
»Was hat er denn bisher auf dem Kerbholz?«, fragte er danach.
»Einbruch, Hehlerei, Autodiebstahl und noch einiges.«
»Rauschgift?«, fragte Daniel.
Verblüfft sah ihn der Polizist an.
»Rauschgift?«, wiederholte er fragend. »Das ist nur eine Vermutung von mir. Mich sollte es wundern, wenn er nicht mit dem großen Blonden unter einer Decke stecken würde.«
»Mit Kemmler? Vermuten Sie das, weil beide hier im Haus geschnappt wurden?«
»Weil beide sich für den gleichen Fall interessieren«, äußerte Daniel nachdenklich. »Kemmler heißt der Mann, der Petra von Schönauer aus dem Wagen warf? Nun, dieser Baku interessierte sich sehr für die junge Dame. Sie sollten das Kommissar Wetzel sagen, und außerdem auch, dass Dr. Arndt sich wegen dieses Jürgen Sperber anscheinend in ziemliche Gefahr begibt.«
»Sie wissen allerhand. Wollen Sie das nicht dem Kommissar selbst sagen?«
»Mehr, als ich sagte, weiß ich nicht. Sie haben sicher mehr Erfahrung, aus diesen Burschen herauszubringen, was Sie wissen wollen.«
»Kemmler ist ein harter Brocken. Der redet noch lange nicht. Bisher haben wir ihm nie was nachweisen können.«
»Jetzt können Sie es aber. Er ist der Mann, der Fräulein von Schönauer entführt hat.«
»Er leugnet es.«
»Sie wird ihn identifizieren.«
»Also, wenn es mit der Arztpraxis mal nicht mehr klappen sollte, werden Sie Detektiv«, sagte Molly, bevor sie ihre Mittagspause antrat.
»Ich weiß jemanden, der dagegen laut Protest einlegen würde«, erwiderte er schlagfertig.
Nun gab es für ihn aber auch noch andere Patienten. Martin Kraft zum Beispiel, dessen Sohn ihn schon am Vormittag angerufen hatte, um ihm zu sagen, dass sich sein Vater in die Klinik begeben hätte.
Daniel wollte sich bei Professor Wiese vergewissern, welche Chancen für eine Heilung bestanden. Für ihn war ein Fall nicht einfach erledigt, wenn er den Patienten an einen andern Arzt überwies und besonders dies trug ihm so viele Sympathien ein. Viel konnte ihm Professor Wiese allerdings noch nicht sagen. Er meinte jedoch, dass es am besten wäre, den Patienten hierzubehalten und baldmöglich zu operieren, wenn Dr. Nordens Diagnose bestätigt würde.
Das teilte er Herrn Kraft dann vorsichtig mit, der gottergeben in seinem Bett lag.
»Geht es denn gar nicht anders?«, fragte Martin Kraft. »Man liest doch so viel von modernen Heilmethoden.«
»Die in manchen Fällen durchaus mit Erfolg angewendet werden können«, sagte Daniel. »Doch in Ihrem Fall wird eine Operation unvermeidbar sein.«
»Und mit welchem Erfolg?«, fragte Martin Kraft.
»Dass Sie sich Ihres Lebens wieder freuen können«, ermunterte ihn Daniel.
Der Kranke sah ihn nachdenklich an.
»Seien Sie bitte ehrlich, Herr Doktor. Wie stehen meine Chancen? Ich möchte keine Beschönigungen.«
»Sagen wir, fifty-fifty«, erwiderte Daniel zögernd. »Ich habe einen Patienten, der seit seinem zwanzigsten Lebensjahr mit einer Niere lebt, und jetzt ist er siebzig.«
»Wissen Sie, was mich bei dieser dummen Geschichte tröstet? Mir ist klar geworden, wie meine Frau und mein Junge sich um mich sorgen, was ich ihnen doch bedeute. In der dauernden Hetze ist mir das gar nicht bewusst geworden. Wenn ich es überstehe, werde ich mein Leben doch ein wenig anders einrichten.«
Alles hat zwei Seiten, dachte Daniel, und das fand er dann auch bestätigt, als er in die Behnisch-Klinik fuhr, um Herrn Grothe und Uli und auch die Geschwister Schönauer zu besuchen.
Auf dem Gang traf er Marlies Grothe, wie immer hoch elegant, wie immer exzentrisch.
Helle Empörung stand ihr auf dem Gesicht geschrieben, als sie auf ihn zukam.
Wie ein Wasserfall sprudelte es von ihren Lippen: »Man will mich nicht zu meinem Mann und meinem Sohn lassen, Dr. Norden! Da rufe ich zu Hause an und erfahre, dass sie beide in der Klinik sind. Ich komme auf schnellstem Wege hierher, und man behandelt mich wie eine Aussätzige!«
»Das ist wohl doch ein wenig übertrieben«, entgegnete Dr. Norden kühl. »Sie sind sehr erregt, Frau Grothe. Uli hat eine schwere, lebensgefährliche Operation hinter sich und darf keinesfalls Aufregungen ausgesetzt werden.«
»Ich bin seine Mutter!«, begehrte sie auf.
Er maß sie mit einem Blick, der sie ziemlich unsicher machte.
»Man kann mir doch nicht zum Vorwurf machen, dass ich meine Reise angetreten habe«, versuchte sie sich zu rechtfertigen. »Sie war lange geplant.«
»Uli fühlte sich nicht wohl, als Sie abreisten. Ihr Mann war nicht da. Sie hätten mich rufen lassen können. Sonst haben Sie mich doch auch immer geholt, wenn dem Jungen oder Ihnen etwas fehlte.«
»Uli hatte doch andauernd was. Sie haben selbst oft genug gesagt, dass das harmlos ist.«
»Eine Mutter sollte eigentlich wissen, wenn ihrem Kind ernsthaft etwas fehlt.« Er konnte es sich nicht verkneifen, das zu sagen.
»Aber es ist eine Ungezogenheit von meinem Mann, mir durch die Schwester ausrichten zu lassen, dass er mich nicht zu sehen wünscht!«
Hatte Werner Grothe das tatsächlich getan? Dann musste er allerdings sehr triftige Gründe haben.
»Nun, ich werde nach Hause fahren«, äußerte Marlies Grothe herablassend. »Man wird mich wohl wissen lassen, wenn ich hier erwünscht bin.«
Werner Grothe lag nicht mehr im Bett.
Er saß angekleidet in einem Sessel neben dem Bett seines Sohnes und erzählte ihm Geschichten.
Nachdenklich musterte Daniel sein blasses entschlossenes Gesicht.
»Na, wie geht es, Uli?«, fragte Daniel.
»Schon viel besser. Papi muss ja leider wieder arbeiten, aber Schwester Annelie ist immer da. Das hat sie mir versprochen. Und Papi kommt auch oft. Heute darf ich schon etwas essen.«
»Das ist aber fein«, meinte Daniel herzlich.
»Und ein paar Schritte muss ich auch schon gehen. Das ist gut für den Kreislauf, hat Dr. Behnisch gesagt. Er ist lustig. Wir haben schon gelacht.«
Und dieses Lachen hatte ihm wohl nicht vergehen sollen, wenn seine hysterische Mutter sich hier in Szene setzte. Sie wurde jetzt mit keinem Wort erwähnt. Später begleitete ihn Werner Grothe hinaus.
»Haben Sie Marlies noch getroffen?«, fragte er ohne Umschweife.
»Ja«, erwiderte Daniel knapp.
»Sie wird sich natürlich in den höchsten Tönen über mich beschwert haben. Aber so geht es einfach nicht mehr weiter, Herr Doktor. Sie ist nur gekommen, weil sie Geld braucht. Sie hat wieder mal gespielt und vielleicht auch so einen halbseidenen Playboy ausgehalten.«
In seiner Stimme klang tiefe Bitterkeit.
»Ich will ganz offen sein. Zwischen uns gab es große Differenzen. Unsere Ehe ist eine Farce. Um Ulis willen machte ich gute Miene zum bösen Spiel, aber gerade jetzt ist mir bewusst geworden, dass ich dem Jungen da keinen Gefallen erweise. Er leidet mehr unter ihren Launen als unter einer Trennung. Uli hat selbst gesagt, dass sie nicht kommen soll. Ich werde heute heimfahren und reinen Tisch machen.«
Daniel schwieg dazu. Was sollte er auch sagen. Das war ein sehr persönlicher Entschluss.
»So kann ich nicht mehr weiterleben«, meinte Werner Grothe leise. »Verstehen Sie das?«
O ja, er verstand es, aber kam es darauf an?
Er traute dieser egoistischen Frau zu, dass sie mit Tränen und Flehen ihren Mann umstimmen würde. Für Marlies Grothe war doch nur Geld wichtig.
Schwester Annelie kam aus einem Krankenzimmer. Daniel bemerkte den Blick, den Werner Grothe ihr nachschickte. Ein Ausdruck war darin, der ihn nachdenklich stimmte.
Werner Grothe hatte Gelegenheit gehabt, Vergleiche zu ziehen, und dabei schnitt seine Frau schlecht ab. Aber vielleicht war es auch mehr. Vielleicht hatte Werner Grothe einen Menschen gefunden, von dem er sich und sein Kind verstanden fühlte.
Es wäre wohl ganz interessant gewesen zu hören, was er seiner Frau zu sagen hatte.
*
Im Krankenzimmer von Petra von Schönauer herrschte gedrückte Stimmung. Monika hatte Kommissar Wetzel alles erzählt, was sie von ihrer Schwester erfahren hatte, aber jetzt galt ihre Sorge ihrem Verlobten.
Bei Petra waren mit dem Erinnerungsvermögen auch die Lebensgeister wieder erwacht. Sie machte einen verhältnismäßig frischen Eindruck.
Daniel erzählte den beiden jungen Damen, was sich an diesem Vormittag abgespielt hatte, aber Monika hörte nur geistesabwesend zu. Sie zerbrach sich den Kopf über Berts geheimnisvolle Reise.
Dann kam Thommy, mit einem großen Strauß Blumen und in bester Stimmung.
»Bert hat angerufen. Er wird heute Abend zurück sein«, verkündete er. »Du wirst dir doch nicht etwa Sorgen machen, Monika?«
Ihre Miene entspannte sich etwas.
»Was hat es mit dieser Reise auf sich, Thommy?«, fragte sie.
Daniel sah den Zeitpunkt gekommen, sich zu verabschieden. Dass Herbert Arndt ihm die Akten zur Aufbewahrung gegeben hatte, schien nicht einmal sein Bruder zu wissen.
Daniel machte seine Besuche. Ein Grippefall, zwei Rekonvaleszenten, drei Kinder mit Mumps. Etwas Besonderes lag nicht vor. Das war gut so.
In Gedanken war er schon bei Fee, und er hoffte auf ein ungestörtes Wochenende mit ihr. Nach diesen aufregenden Tagen konnte er es auch brauchen.
Drei Dauerpatienten, die Bestrahlungen und Spritzen bekamen, hatte er noch bestellt. Der erste wartete schon.
Molly machte die Abrechnungen für die Krankenkassen. Da sprach man sie lieber nicht an. Es war die einzige Arbeit, bei der sie leicht nervös wurde. Außerdem war Molly durch die ungewöhnlichen Ereignisse auch ein bisschen aus dem Tritt gekommen.
»Machen Sie Schluss für heute«, sagte Daniel.
»Das Quartalsende steht vor der Tür«, erklärte sie.
»Was, schon wieder?«
»Ja, so schnell vergeht die Zeit.«
Der letzte Patient ging, und da läutete es erneut.
Na, wer wird das wieder sein, dachte Daniel, und da Molly nun doch ihre Sachen gepackt hatte und gegangen war, öffnete er selbst die Tür.
Im nächsten Augenblick lag Fee in seinen Armen. Wie ein Verdurstender küsste er sie, überglücklich, sie endlich wieder an sich drücken zu können.
»Hoffentlich komme ich nicht ungelegen?«, meinte sie schelmisch.
Seine Finger glitten streichelnd durch ihr seidiges silberblondes Haar.
»Eine größere Freude hättest du mir gar nicht machen können, Liebling«, erwiderte er zärtlich.
»Paps war großzügig. Er hat mich schon heute fahren lassen, und ich brauche erst Montag mittag zurück zu sein.«
»Und nichts soll uns stören«, sagte er.
Dann sprach er noch auf Band, welche Ärzte Wochenenddienst hatten, schaltete den automatischen Anrufbeantworter ein, schloss die Praxis sorgfältig ab und fuhr mit ihr nach oben in die Wohnung.
Lenchen freute sich nicht weniger über Fees Besuch. Sie strahlte über das ganze Gesicht.
Für sie war die Welt in Ordnung. Fee war die einzig richtige Frau für ihren Doktor. Sie zog sich schnell wieder in ihr Reich zurück, damit die beiden durch nichts gestört wurden.
*
Werner Grothe hatte seine Frau nicht daheim angetroffen. Umsonst hatte er sich so schnell auf den Weg gemacht.
Sie hatte damit natürlich nicht gerechnet. Sie kam erst gegen sieben Uhr heim, frisch vom Friseur, und nur um sich umzukleiden, denn sie hatte nicht die Absicht, daheim zu sitzen und Trübsal zu blasen.
Werner hörte sie kommen und wartete in seinem Zimmer noch einige Minuten. Die Tür zu seinem Arbeitszimmer stand einen Spalt offen.
Gerade hatte er sich aufgerafft, zu Marlies zu gehen, als er leichte Schritte vernahm. Dann hörte er, wie die Tür zu dem Arbeitszimmer vom Gang geöffnet wurde.
Durch den handbreiten Spalt konnte er genau seinen Schreibtisch sehen. Gleich darauf auch Marlies, die in ein leichtes Negligé gehüllt war. Sie bemühte sich, die Schreibtischschublade zu öffnen. Er schob die Tür auf.
»Darf ich fragen, was du suchst?«
Seine Stimme klang eisig. Ihr Kopf ruckte empor. Entsetzt sah sie ihn an.
»Du bist hier?«, fragte sie schrill. »Ich denke, du bist krank?«
»Du hast meine Frage noch nicht beantwortet«, sagte er ruhig.
Plötzlich war alle Erregung von ihm gewichen. Er war kalt und nüchtern, als stünde ihm eine schwierige geschäftliche Verhandlung bevor.
Marlies gab keine Antwort. Hektische Röte hatte ihr Gesicht und ihren Hals überflutet.
»Du brauchst dich nicht zu bemühen. Die Schublade ist abgeschlossen«, erklärte Werner Grothe. »Geld oder ein Scheckheft hättest du da ohnehin nicht gefunden. Wie viel Schulden hast du wieder gemacht?«
»Was schlägst du für einen Ton an!«, entgegnete sie, um Zeit zu gewinnen. »Wie behandelst du mich überhaupt! Ich komme voller Sorge zurück und …«
»Willst Geld, nichts als Geld!«, stellte er fest. »Wenn ich nicht früher als erwartet zurückgekommen wäre, wäre Uli jetzt tot.«
»Übertreib doch nicht! Du musst alles gleich dramatisieren. Was bedeutet denn heute schon noch eine Blinddarmoperation. Das ist doch eine Bagatelle.«
»Der Blinddarm war am Durchbruch, aber was interessiert dich das. Das Kind war dir ja immer im Weg.«
»Ich bin nur nicht für diese Affenliebe«, widersprach sie heftig. »Du verwöhnst und verzärtelst den Jungen!«
»Ein Kind braucht Liebe und Verständnis, aber das sind für dich ja Fremdworte. Ich habe bereits mit meinem Anwalt gesprochen und die Scheidung eingeleitet.«
Fassungslos starrte sie ihn an.
»Und mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf?«
»Denk mal nach. Ich habe keine Lust mehr, für deine Liebhaber mit zu arbeiten.«
»Das müsstest du erst beweisen!«, schrie sie ihn unbeherrscht an.
»Das ist leicht zu beweisen. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Das Maß ist voll, Marlies! Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.«
»Da steckt doch eine andere Frau dahinter!«, versuchte sie den Spieß umzudrehen.
Er sah sie verächtlich an.
»Weil ich so viel Zeit habe«, bemerkte er spöttisch.
Das Telefon läutete. Marlies wollte den Hörer abnehmen, aber er kam ihr zuvor.
Er ließ sie nicht aus den Augen und spürte, wie nervös sie war.
»Es ist für dich. Dein Kavalier. Du hattest wohl die Absicht auszugehen. Nun, ich hindere dich nicht daran.«
Er schlug die Tür hinter sich zu, rückte energisch seine Krawatte zurecht und verließ das Haus.
Sie kam ihm durch den Garten nachgelaufen.
»Ich will doch nicht ausgehen, Werner«, sagte sie atemlos. »Wohin gehst du?«
»In die Klinik.«
Sie kniff die Augen zusammen.
»Bitte, bleib! Wir müssen uns doch aussprechen.«
»Das haben wir oft genug erfolglos getan. Du kannst mich nicht mehr umstimmen. Ich spiele nicht mehr mit. Bevor Uli aus der Klinik kommt, hast du das Haus verlassen. Das ist mein letztes Wort.«
»So einfach stellst du dir das vor!«, höhnte sie.
»Nein, ich habe es mir schwergemacht, zu schwer. Ich habe es immer wieder in mich hineingeschluckt, weil ich einfach nicht glauben wollte, dass eine Frau so minderwertig sein kann.«
Er schob sie von sich, als sie sich an seinen Arm klammerte. Dann ging er auf seinen Wagen zu und fuhr davon.
Mit finsterer Miene blickte sie ihm nach. Aber jetzt dachte sie in erster Linie daran, wovon sie ihre Schulden bezahlen sollte und was ihr Mann sagen würde, wenn ihm die Rechnung präsentiert würde.
Sie hatte begriffen, dass er unversöhnlich war.
*
Schwester Annelie war lange bei Uli geblieben. Ab und zu musste sie sich mal um andere Patienten kümmern, aber heute ging es ganz friedlich zu, und Schwester Martha sorgte dafür, dass Annelie sich dem Kleinen widmen konnte.
Sie wusste, wie gut der jungen leidgeprüften Frau die Zuneigung des Kindes tat.
Meistens war es ja so, dass die Mütter bei den kleinen Patienten blieben und es gar nicht so gern sahen, wenn eine Schwester eine zu große Rolle im Leben ihres Kindes spielte. Liebevolle Mütter waren eben nicht frei von Eifersucht. Aber bei Uli war das ja anders, und aus dem Mund des Kindes hatte es Schwester Annelie heute zum ersten Mal deutlich erfahren.
»Wie lange darf ich noch hierbleiben?«, hatte Uli gefragt.
Andere Kinder fragten, wie lange sie denn noch bleiben müssten.
»Sicher nur eine Woche noch«, erwiderte Schwester Annelie, selbst betrübt darüber, wie schnell diese Woche vergehen würde. »Freust du dich denn nicht, wenn du wieder nach Hause gehen kannst, Uli?«
»Nein. Ja, wenn Papi immer da wär schon, aber so nicht.« Er hatte seine Mutter bisher überhaupt nicht erwähnt, doch jetzt sagte er: »Wenn Mama doch immer wegbleiben würde.«
Schwester Annelie kroch ein Frösteln über den Rücken. Sie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte, so schwieg sie lieber.
»Mama ist ja doch fast nie zu Hause«, fuhr Uli fort, »und wenn sie da ist, sagt sie bloß, dass ich sie nicht stören soll. Und alle Hausangestellten, die nett sind, bleiben nicht lange. Warum kommt Papi heute eigentlich nicht mehr?«, wechselte er dann das Thema.
»Ich weiß es nicht, Uli. Er wird sicher viel zu erledigen haben.«
Uli wusste nicht, dass seine Mutter im Lande war. Werner Grothe hatte es ihm verschwiegen.
Schwester Annelie dachte jetzt an die elegante, puppenhafte Frau, die so gar nicht zu Werner Grothe passte.
»Papi arbeitet viel zu viel«, meinte Uli, »und Mama gibt das Geld aus.«
»Aber dein Papi hat dich sehr lieb«, sagte Annelie leise.
Uli nickte. »Ich ihn aber auch. Er hat mir versprochen, dass er öfter für mich Zeit haben wird, wenn Mama nicht mehr da ist. Vielleicht kommt sie doch nicht mehr.«
»Willst du das denn?«, fragte Annelie gepresst.
»Ja«, erwiderte Uli, ohne zu überlegen. »Es wäre schön, wenn du immer bei uns sein könntest, Schwester Annelie.«
Das hatte er schon ein paar Mal gesagt, und gerade als er es diesmal sagte, trat Werner Grothe ein.
Annelie stieg das Blut ins Gesicht. Sie zwang sich zu einem Lächeln.
»Siehst du, Uli, nun ist dein Papi doch noch gekommen«, bemerkte sie.
Aber als sie zur Tür ging, fragte Uli: »Warum läufst du denn gleich weg? Hast du keine Zeit mehr?«
»Du hast doch jetzt Gesellschaft. Ich muss mich noch um andere Patienten kümmern. In einer halben Stunde kommt meine Ablösung.«
»Wo wohnst du eigentlich?«, fragte Uli.
»Ein ganzes Stück entfernt«, erwiderte sie.
»Papi kann dich doch heimfahren, dann brauchst du nicht zu laufen. Gell, Papi, das tust du gern?«
»Selbstverständlich«, antwortete Werner Grothe leicht verlegen.
»Das ist wirklich nicht nötig. Ich fahre mit der U-Bahn«, erklärte Annelie rasch.
»Ich bin jetzt sowieso müde«, meinte Uli, »aber es ist schön, dass du mir noch gute Nacht sagen kommst, Papi.«
»Sonst kann ich auch nicht schlafen, mein Kleiner.«
Uli legte seine Wange auf Werner Grothes Hand.
»Noch eine Woche kann ich hierbleiben«, flüsterte er. »Ist Mama dann wieder zu Hause?«
Werner hörte, mit welchem Widerwillen er »Mama« sagte.
»Sie wird nicht mehr dasein, Uli«, entgegnete er stockend.
»Nie mehr?«
»Nie mehr.«
»Hat sie das geschrieben?«
»Nein, ich habe es ihr gesagt. Kannst du es denn schon verstehen? Du bist doch noch so klein.«
»Aber ich bin froh, wenn sie nicht mehr da ist«, sagte Uli.
Du müsstest es hören, Marlies, dachte Werner Grothe. Das Kind wird dich nicht vermissen. Es will gar nichts von dir wissen.
»Könnten wir nicht Schwester Annelie zu uns holen, Papi?«, fragte Uli »Da müsste sie nicht so viel arbeiten, und sie ist so lieb. Da würde ich dich auch nicht so sehr vermissen.«
»Ich weiß nicht, ob das geht«, antwortete Werner Grothe leise.
»Du kannst sie ja mal fragen. Wenn du sie heute nach Hause fährst, kannst du sie fragen, Papi. Ich will jetzt sowieso schlafen.«
»Du stellst dir das so einfach vor«, murmelte Werner Grothe verlegen.
»Fragen kann man doch«, meinte Uli. »Geh jetzt lieber, sonst ist sie weg.«
Er schlang seine Ärmchen um seines Papis Hals und drückte seine Nase an dessen Wange.
»Dich habe ich schrecklich lieb, Papi«, sagte er zärtlich. »Ich bin froh, dass du wieder gesund bist.«
»Und ich bin froh, wenn du wieder gesund bist. Schwester Annelie könnte uns ja hin und wieder besuchen.«
»Aber schöner wär’s doch, wenn sie immer bei uns sein könnte. Sie hat so weiche Hände. Wenn sie mich streichelt, tut gar nichts mehr weh.«
»Jetzt schlaf gut, mein Junge«, sagte Werner und küsste den Kleinen auf die Stirn.
»Aber du fährst Schwester Annelie heim!«, drängte Uli.
»Wenn ich sie noch treffe.«
Er sah Annelie, wie sie in ein Zimmer huschte. Er wartete draußen im Wagen auf sie. Vielleicht wollte sie ihm ausweichen, scheu, wie sie war. Er meinte, sie schon ganz gut zu kennen.
Es vergingen noch zwanzig Minuten, bis sie kam, in einem grauen Lodenmantel, der nicht mehr in der Mode war. Bescheiden wie sie selbst, war auch ihre Kleidung.
Er fragte sich plötzlich, was eine Krankenschwester wohl verdient, die so viele Stunden am Tag auf den Beinen
war.
Annelie wurde erst rot, dann blass, als er die Wagentür öffnete.
»Nun kommen Sie schon«, sagte er in väterlichem Ton. »Ich habe sowieso keine Lust, nach Hause zu fahren.«
Ja, es graute ihm davor, wieder mit Marlies zusammenzutreffen, und er ahnte, dass sie heute mal auf ihn warten würde.
»Haben Sie schon gegessen?«, fragte er beiläufig.
»Ich esse immer in der Klinik.«
»Aber vielleicht könnten wir irgendwo noch ein Gläschen Wein trinken?«
»Lieber nicht, das bin ich nicht gewohnt.«
»Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Wer weiß, wann sich wieder eine so günstige Gelegenheit ergibt.«
»Vielleicht könnten wir dann ein Stück gehen. Ich bin gern an der frischen Luft. «
»Verständlich, wenn man den ganzen Tag so eingespannt ist. Fahren wir zum Forstenrieder Park.«
»Werden Sie nicht erwartet?«
»Wohl möglich, aber das soll uns nicht stören. Ab heute ist es bei mir aus.« Es klang sehr bestimmt.
Annelie schwieg. Sie schwieg auch dann, als sie nebeneinanderher gingen.
»Verzeihen Sie die indiskrete Frage, aber fühlen Sie sich wohl in Ihrem Beruf?«
»Sonst hätte ich ihn nicht gewählt«, erwiderte sie.
»Noch eine dumme Frage. Ist der Verdienst auch Ihrem Einsatz entsprechend?«
Sie sah unwillkürlich an sich hinab.
»Doch, augenblicklich muss ich nur sparen. Ich möchte mir eine eigene Wohnung einrichten. Bald habe ich es geschafft. «
Es klang sehr rührend. Von ihrem Schicksal wusste Werner Grothe noch nichts, aber an diesem Abend sollte er es dann doch noch erfahren, und er war tief erschüttert.
Sie wäre bestimmt gern bei ihrem Kind geblieben, aber sie hatte mitarbeiten müssen, um ein Haus abzuzahlen, von dem sie nun gar nichts hatte. Und was noch schlimmer war: Sie hatte das Kind verloren, das sie über alles liebte.
»Es tut mir leid«, sagte er leise. »Ich wollte nicht kaum vernarbte Wunden aufreißen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht zu uns kommen wollen, um Uli zu betreuen. Ja, deshalb wollte ich mit Ihnen sprechen. Er wünscht es sich so sehr. Selbstverständlich würden Sie das gleiche Gehalt bekommen wie in der Klinik. Ich brauche einen Menschen, bei dem ich Uli in guten Händen weiß. Mit dem auch ich sprechen kann«, fügte er stockend hinzu.
»Das geht doch nicht«, flüsterte sie.
»Warum nicht? Ich habe die Scheidung eingereicht. Meine Frau wird das Haus verlassen haben, bevor Uli aus der Klinik kommt. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Schließlich habe ich mir das Ganze ja selber eingebrockt, aber früher oder später musste es so kommen. Überlegen Sie es sich, Annelie. Uli ist ein liebes Kind. Er wäre sehr glücklich, wenn seine liebe Schwester Annelie bei ihm sein würde. Sie sind doch viel zu zart, um diesen schweren Dienst zu versehen.«
»Sie sind sehr nett, Herr Grothe.«
»Nett? Ich mache Ihnen einen Vorschlag aus purem Egoismus.«
»Nein, Sie sind nicht egoistisch.«
»Kennen Sie mich schon so gut?«
»Ich habe tagtäglich mit Patienten zu tun, da bekommt man schon eine gewisse Menschenkenntnis. Ich habe selten einen Vater kennengelernt, der so rührend lieb zu seinem Kind ist. Aber vielleicht hat Ihre Frau jetzt eine andere Einstellung. «
»Marlies?« Er lachte blechern auf. »Sie hat alles zerstört. Sie hat sich nie um den Jungen gekümmert. So viel Scherben kann man nie mehr zusammenkitten. Es würden immer Bruchstücke fehlen, und das Fragment würde doch wieder auseinanderbrechen.«
Er drehte sich zu ihr um und sah sie an.
»Sie könnten immer bei uns bleiben, wenn Sie wollen, Annelie. Lassen Sie es sich durch den Kopf gehen.«
»Für Uli sorgen können«, flüsterte sie. »Schön wäre es. Ich werde es mir überlegen. Ich weiß nur nicht, wie ich es Dr. Behnisch sagen soll. Er ist ein netter Chef. Schwestern sind so rar.«
»Ich kann ihn ja fragen«, meinte Werner.
»Lassen Sie mir bitte etwas Zeit.«
Sie dachte auch daran, dass es nächste Woche schon wieder anders aussehen könnte. Marlies Grothe hatte auf sie nicht den Eindruck gemacht, als gäbe sie leicht auf, was sie besaß.
Das Leben war zu hart mit Annelie umgesprungen, als dass sie daran glauben konnte, dass es auch ihr mal einen geheimen Wunsch erfüllen könnte.
Werner brachte sie heim. Sie wohnte in einem alten grauen Miethaus.
Wie gut würde es ihr tun, einen Garten um sich zu haben, ein dankbares Kind und auch einen dankbaren Mann, der schon fast vergessen hatte, dass es auch solche Frauen gab.
*
Daniel Norden dagegen war nur glücklich. Zwischen ihm und Fee herrschte vollkommene Harmonie. Sie konnten miteinander reden, sie konnten schweigen, ihre Blicke, ihre Herzen hatten sich immer etwas zu sagen.
»Diese himmlische Ruhe«, bemerkte er mit einem tiefen Seufzer. »Es ist so schön, dass du schon heute gekommen bist.«
»Beschrei die Ruhe nicht«, meinte Fee neckend, und sie hatte es kaum ausgesprochen, als es läutete.
»Nein!«, rief Daniel.
»Ich schaue nach. Lenchen hört es ja doch nicht«, sagte Fee.
Er hielt sie zurück.
»Nein, du gehst nicht!«, erklärte er, und sie war ganz erschrocken, als er sie ins Zimmer zurückschob.
Uber die dramatischen Ereignisse dieses Tages hatte Daniel nämlich noch nicht gesprochen.
Voller Misstrauen öffnete er die Tür. Vor ihm stand Dr. Arndt, müde, abgekämpft, mit tiefen Ringen um die Augen. Daniel war erleichtert.
»Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind!«, sagte er.
Fee hörte es, und ihr Herzklopfen legte sich.
»Kommen Sie herein«, forderte Daniel den Anwalt auf. »Ihnen sei es gestattet, obgleich ich Besuch habe.«
»Ich will nicht stören«, erwiderte Dr. Arndt.
»So würde ich Sie sowieso nicht gehen lassen«, bemerkte Daniel, in dem sich der Mediziner meldete.
Fee hatte schon die Tür zum Wohnraum geöffnet.
»Dr. Arndt«, stellte Daniel vor, »meine zukünftige Frau.«
»Es tut mir schrecklich leid, dass ich so hereinplatze«, beteuerte Herbert Arndt, »aber ich brauche die Akten.«
Fee sah Daniel verwundert an, aber jetzt bekam sie keine Auskunft.
»Essen Sie etwas«, sagte Daniel. »Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten?«
»Wenn ich vielleicht ein Bier haben dürfte?«
»Gern, aber zuerst ein paar Happen essen«, erwiderte Daniel. »Um Ihre Verlobte und Petra brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es ist alles in Ordnung. Außerdem sind heute ein Mann namens Kemmler und ein gewisser Baku verhaftet worden.«
Dr. Arndt sah ihn verwundert an. »Wie das?«
»Hier im Haus, Baku in meiner Praxis. Kemmler ist mit Hilfe Ihres Bruder dingfest gemacht worden.«
Dr. Arndts Miene hellte sich auf.
»Das sind ja glänzende Aspekte! Ist es sehr unverschämt, wenn ich Sie bitte, mir Genaueres zu erzählen?«
Nun bekam Fee auch gleich einen Teil mit, und da Daniel ihr die Vorgeschichte schon am Telefon berichtet hatte, fiel es ihr nicht schwer zu kombinieren.
»Du hast mir nicht erzählt, welchen aufregenden Tag du hinter dir hast«, warf sie ein.
»Ist doch alles gutgegangen. Jetzt brauchst du dich nicht mehr aufzuregen«, entgegnete Daniel. »Du wirst bestimmt alles noch ganz genau erfahren. Haben Sie erreicht, was Sie wollten?«, fragte er dann den Anwalt.
»Ich konnte eine sehr wichtige Sache klären«, erwiderte der Anwalt. »Ich weiß jetzt, wie das Rauschgift in Sperbers Wagen gelangte.«
»Darf ich fragen, wie?« Daniel war daran doch sehr interessiert.
»Es wurde unten in die Karosserie eingebaut.«
Daniel und Fee sahen ihn staunend an.
»Ohne sein Wissen? Das ist doch kaum möglich«, bemerkte Daniel.
»O doch, es war doch möglich. Ich wollte es zuerst auch nicht glauben, als er immer wieder beteuerte, dass er ahnungslos sei, aber glücklicherweise erfuhr ich von einem Parellelfall. Der davon Betroffene war nicht so naiv wie Jürgen Sperber. Auch er wurde in einen leichten Autounfall verwickelt. Auch ihm wurde Hilfe von den daran Beteiligten angeboten. Auch er war selbstverständlich froh, nicht mit der ausländischen Polizei konfrontiert zu werden. Sie wissen ja, welche Schwierigkeiten einem daraus erwachsen können.
Die Hilfsbereitschaft war keine Menschenfreundlichkeit. Es waren äußerst clevere Ganoven, die auf diese Weise das Rauschgift unterbringen konnten, mit der begründeten Hoffnung, dass man nicht darauf stoßen würde. Aber irgendjemand muss wohl doch gepfiffen haben. Nun, ich denke, dass nun genügend Entlastungsmaterial gesammelt ist, um meinen Mandanten freizubekommen.«
Offen blieb jetzt noch die Frage, warum er sich persönlich so sehr engagiert hatte und auch in Gefahr begab. Auch das erklärte Dr. Arndt.
»Das Fatale für uns an der Geschichte war, dass Petra und Jürgen Sperber sich recht gut kennen. Ich fühlte mich ganz schön in die Enge gedrängt, als ich erfuhr, dass sie gekidnappt worden war. Wenn sie jetzt noch die Burschen identifizieren könnte, die das getan haben, brauchten wir nichts mehr zu fürchten.«
»Sie kann und wird es«, erklärte Daniel. »Sie kann sich an alles erinnern.«
»Das ist ja phantastisch!«, sagte Dr. Arndt erleichtert. »Nun will ich Ihnen aber wirklich nicht mehr auf die Nerven fallen. Jetzt kann ich wieder eine Nacht ruhig schlafen, und morgen werde ich mich gründlich vorbereiten. Einstweilen vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft und Ihre tatkräftige Unterstützung, Herr Norden.«
*
Er war mit seinem Aktenkoffer entschwunden. Daniel und Fee waren wieder allein. Er nahm sie in die Arme und küsste sie.
»Weißt du, was wir morgen machen, Liebstes? Die Tür hinter uns zu, dann fahren wir an den Chiemsee und segeln mal wieder. Mein Boot verrottet sonst. Und wir haben unsere Ruhe.«
»Wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht«, sagte Fee.
Sie traten hinaus auf die Dachterrasse. Daniel blickte zum Himmel.
»Es wird schön bleiben«, äußerte er hoffnungsvoll.
Er sollte recht behalten. Ein strahlendschöner Morgen erwachte und lockte sie früh aus den Betten.
Lenchen war nicht beleidigt, als sie ihr Vorhaben ankündigten. Sie packte den Picknickkoffer.
Sie erreichten die Autobahn gerade noch, bevor die große Welle des Ausflugsverkehrs einsetzte, und waren schnell am Ziel. Ebenso schnell war das Boot klargemacht.
»Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Boot allein«, sang Daniel übermütig.
»Im Wald allein, heißt es«, warf Fee lachend ein.
»Wir können am Abend auch noch in den Wald gehen, wenn es dich danach gelüstet«, meinte er. »Du, ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt, Liebling. Drei Wochen haben wir uns schon nicht gesehen. Eine Ewigkeit.«
»Und was da so alles passieren kann«, bemerkte Fee.
»War bei euch auch was los?«
»Nur Erfreuliches. Bei uns ist jetzt jeden zweiten Tag Tanztee. Wir müssen uns umschauen, dass sich laufend Tanzlehrer bei uns auskurieren wollten, wenn Lissy mit ihrem Maxi in die Staaten geht.«
Jetzt musste sie erzählen, und Daniel hörte ihr lächelnd zu.
»Eine Heiratsvermittlung betreibt ihr nebenbei auch noch«, scherzte er.
»Die wird von den Patienten selbst betrieben. Gott bewahre uns, dass wir uns auf so glattes Parkett begeben. Aber das Klima scheint dafür auf der Insel besonders günstig zu sein.«
»Wir zwei sind ein prächtiger Beweis dafür, oder meinst du nicht?«
Ganz gelöst waren sie, frei vom Alltag, glücklich in ihrer Zweisamkeit.
Der herrliche Tag hatte viele Ausflügler aufs Wasser gelockt. Und nicht nur Segelboote schaukelten auf den Wellen, die nun von einem frischeren Wind schon höher schlugen.
»Das Wetter wird anscheinend doch umschlagen«, stellte Daniel fest.
»Schau mal, Daniel, wie unverantwortlich«, sagte da Fee. »Mit dem Schlauchboot so weit hinauszufahren und dazu noch ein kleines Kind mitzunehmen.«
»Die Dummen sterben nicht aus«, bemerkte er. »Ja, gibt es denn so was! Jetzt schaukeln sie auch noch!«
Und da war es schon geschehen. Etwa zwanzig Meter war das Schlauchboot noch von ihnen entfernt, als es plötzlich von einer Welle erfasst und umgeworfen wurde.
Fee war starr vor Schrecken, als gellende Aufschreie an ihre Ohren klangen.
»Das Kind, mein Gott, das Kind!«, schrie sie auf.
Da fragte Daniel auch bereits: »Wirst du allein mit dem Boot fertig, Fee?«
»Ja, ja doch«, stieß sie hervor, und schon schoss er wie ein Pfeil ins Wasser. »Pass auf, Daniel!«, rief sie ihm zu, bebend vor Angst.
Mit kräftigen Stößen teilte er die Wellen. Er war ein guter Schwimmer, aber leicht war das Vorankommen nicht.
Vom Ufer heulte eine Sirene auf. Das Knattern von Motorbooten drang an sein Ohr. Er sah eine Hand, die sich aus dem Wasser streckte und dann versank. Er sah das blaue Schlauchboot endlich schon nahe.
Ein winzig scheinendes Etwas klammerte sich daran und schrie: »Papa! Mama!«
Daniel konzentrierte sich nur auf das Kind. Endlich hatte er es erreicht, griff nach ihm.
»Stillhalten«, sagte er, »nicht zappeln!«
»Mama! Papa!«, jammerte das Kind.
Aber Daniel hatte jetzt keine Zeit, über den Leichtsinn der Eltern nachzudenken. Ein Motorboot holte ihn und das Kind an Bord.
Er blickte sich um und konnte doch nichts sehen als das treibende Schlauchboot und sein eigenes Boot, das näher kam.
»Das ist mein Boot«, sagte er heiser und schwer atmend. »Setzen Sie mich ab. Suchen Sie die Eltern des Kleinen.«
»Mama! Papa!«, schluchzte der Junge, der höchstens fünf Jahre sein mochte. Und das Ufer schien so fern. Waren seine Eltern unter denen, die jetzt so zahlreich auf die Unglücksstelle zuschwammen?
Daniels Kraft war vorerst erschöpft. Er wusste auch, dass Fee nicht lange allein mit dem Boot fertig werden konnte, da der Wind jetzt noch stärker auffrischte.
Zuerst hoben sie das Kind über die Bootswand. Es kauerte sich gleich am Boden zusammen und schluchzte angstvoll.
Daniel nahm das Steuer. Rein automatisch handelte er, während Fee den Kleinen in eine Decke hüllte. Er murmelte etwas in italienischer Sprache.
Sie konnte es nicht verstehen, da seine Zähne klapperten. Sie flößte ihm warmen Tee mit Zitrone ein.
»Freddo«, sagte er bebend.
»Es wird dir gleich wärmer werden«, meinte Fee.
»Io non capisco«, murmelte der Kleine.
»Io parlo un po’ d’italiano«, erklärte Fee. »Capisco?«
Der Kleine nickte. Fee hatte den Arm um ihn gelegt. Er schmiegte sich an sie.
»Papa! Mama!«, flüsterte er wieder.
Eine Stunde später wussten sie, dass er weder Papa noch Mama wiedersehen würde, und jetzt war es auch zu spät, sich wegen dieses Leichtsinns zu erregen.
Ein Kind stand allein auf der Welt, in einem fremden Land, mit dessen Menschen es sich nicht verständigen konnte. Was sollte nun mit ihm geschehen?
»Wir werden ihn mitnehmen«, sagte Fee entschlossen. »Er kann bei uns bleiben, bis sich Verwandte melden.«
Und das ist unser schönes, geruhsames Wochenende, dachte Daniel. Die Freude am Segeln war ihnen vergangen.
Mit einem kleinen Jungen, der nichts anhatte als eine Badehose und, in eine warme Decke gehüllt, vor Erschöpfung eingeschlafen war, fuhren sie heim.
»So langsam beginne ich an die Sterne zu glauben«, brummte Daniel. »Manchmal müssen sie eine besonders ungünstige Konstellation einnehmen. Eine so turbulente Woche habe ich wahrhaftig noch nicht erlebt.«
*
»Jesses, Jesses!«, sagte Lenchen, als er den Jungen, der noch immer schlief, in die Wohnung trug. »Was gibt es denn nun schon wieder?«
Doch Zetern gab es bei Lenchen nicht, und ihre von Daniel so oft belächelte Sentimentalität sollte sich endlich einmal als nützlich erweisen, denn sie hatte einen ganzen Koffer voll Kinderkleidung von ihm aufbewahrt.
Irgendwelche Vorwürfe gegen die Eltern des kleinen Jungen zu äußern, hätte sie als Lästerung empfunden, denn sie hatten ihren Leichtsinn mit dem Leben bezahlen müssen.
Gedanken, dass es für den Kleinen vielleicht besser gewesen wäre, nicht gerettet zu werden, kamen ihr auch nicht.
Wenn ihr im Nachhinein noch etwas Sorgen bereitete, dann der Gedanke, was ihrem Doktor alles hätte passieren können, den sie doch aufgezogen hatte, als wäre es ihr Kind.
»Wie heißt denn der Kleine?«, fragte sie.
Aber nicht einmal das wussten Fee und Daniel. Sie wünschten sich, dass der Junge möglichst lange schlafen würde, denn sie wussten nicht, wie sie es ihm sagen sollten, dass er seine Eltern verloren hatte.
Fee betrachtete den Kleinen. Er war ein hübsches Kind. Nun wieder durchwärmt und trocken, lockte sich das schwarze Haar um ein schmales Gesichtchen. Lange schwarze Wimpern lagen auf den braunen Wangen.
Die festen kleinen Finger hatten sich in der Bettdecke festgekrallt, als hielte er sich noch immer an dem Schlauchboot fest.
Der Instinkt des Kindes hatte es vor dem Ertrinken bewahrt. Warum hatten sich nicht auch seine Eltern so gerettet? Diese Frage würde wohl niemals eine Antwort finden.
»Nun wäre also zu überlegen, was wir mit dem Kleinen machen«, meinte Daniel.
»Ich werde ihn mitnehmen. Bei uns kommt er am ehesten auf andere Gedanken. Es wird bestimmt eine Zeit vergehen, bis die Identität seiner Eltern festgestellt ist und eventuelle Verwandte verständigt werden können. Es wird wohl auch Zeit vergehen, bis sie die Eltern finden.« Fröstelnd zog sie die Schultern zusammen. »Vielleicht konnten sie nicht mal schwimmen, oder ein Strudel hat sie erfasst.«
»Denk jetzt nicht darüber nach, Fee«, sagte Daniel leise. »Diese Woche stand tatsächlich unter unglückseligen Aspekten.«
Er setzte sich neben sie und schob seinen Arm unter ihren Kopf. Sie lehnte ihre Wange an seine.
»Es ist schrecklich für das Kind, dass es nicht begreifen wird. Ob es überhaupt seinen Namen weiß?«
»Das wird sich noch herausstellen. Du kannst dich wenigstens halbwegs mit ihm verständigen. Meine italienischen Sprachkenntnisse sind minimal. Wahrscheinlich waren es Gastarbeiter, die meinten, hier ihr Glück machen zu können, wie so viele.«
»Die vielleicht Glück hatten und dadurch übermütig wurden.«
Er streichelte mit dem Handrücken ihre Wange. Und da schreckte sie ein Weinen auf.
Schnell ging Fee zu dem Kleinen. Mit aufgerissenen Augen saß er im Bett.
Seinem Gestammel entnahm sie, dass er sich noch auf dem Wasser wähnte.
Sie nahm ihn in die Arme. Zu ihrem Erstaunen beruhigte er sich schnell.
»Wie heißt du?«, fragte sie.
»Mario.« Wer sie sei, wollte er dann wissen.
»Fee«, erwiderte sie.
Sie sei lieb, aber wo wären denn seine Eltern, fragte er nun.
Fee hätte später nicht mehr sagen können, wie sie doch die richtigen Worte fand, um ihm das Geschehen begreiflich zu machen.
Er war ganz stumm und sah sie nur unentwegt mit seinen großen, dunklen Augen an. Fee fragte nach seinen Verwandten. Er schüttelte den Kopf und erklärte, dass seine Nonna im Himmel sei. Und dann erkundigte er sich, ob seine Eltern sie besuchen würden.
Fee fand, dass dies vorerst eine tröstliche Erklärung sei.
Sie erzählte ihm, dass sie ihn mitnehmen wolle auf eine schöne Insel.
Ob er nun Angst hatte vor dem Wasser? Er fragte nicht danach.
Lenchen brachte ihm Essen, und er stürzte sich mit Heißhunger darüber.
Er wollte wissen, wie die Nonna heiße, denn er hielt Lenchen für eine Großmutter. Fee sagte ihm langsam den Namen vor, und er wiederholte ihn mit drolliger Betonung.
Er konnte in deutscher Sprache bitte und danke sagen und guten Tag.
Als Fee ihn fragte, ob er wisse, wie alt er sei, nickte er eifrig und hob seine rechte Hand empor. Und dann sagte er, dass er heute Geburtstag hätte und sein Papa dazu das Boot gekauft hatte.
Kalte Schauer liefen über Fees Rücken. Sein Geburtstag war der Todestag seiner Eltern geworden.
Sie streichelte sein Lockenköpfchen, worauf er versicherte, dass sie alle sehr lieb seien.
Er wurde bald wieder müde, aber vor dem Einschlafen betete er. Der liebe Gott möge seine Eltern beschützen und zu ihm zurückschicken, wenn sie die Nonna besucht hätten, sagte er.
Fee traten die Tränen in die Augen. Sie blieb an seinem Bett sitzen, bis tiefe, ruhige Atemzüge verkündeten, dass er eingeschlafen war.
*
Wollte man die dramatischen Umstände von Marios Anwesenheit außer acht lassen, gestaltete sich diese recht unterhaltsam.
Er war ein kleiner Junge, der unversehens in eine ihm unbekannte Welt geraten war.
Er durfte in einem wunderschönen Bad planschen und sich an einen reichgedeckten Frühstückstisch setzen.
Er fand, dass Fee eine schöne Dame sei, und war begeistert, dass Daniel ein Dottore war. Lenchen rief er »Nonna Lenchen«, und er schaute ihr interessiert zu, wie sie in der supermodernen Küche das Essen bereitete.
Lenchen hatte ihm blaue Leinenhosen und ein blaues Hemd mit weißen Punkten angezogen.
»Das hat mir auch mal gepasst«, stellte Daniel schmunzelnd fest.
»Und wie gut, dass ich nichts weggeworfen habe«, sagte Lenchen betont.
»Du hast natürlich geahnt, dass wir es mal brauchen würden«, bemerkte Daniel.
»Es sind Erinnerungen«, erklärte Lenchen.
»Sie ist einfach rührend«, meinte Fee. »War es nicht schwer für sie, zu dem Jungen, den sie so mütterlich aufgezogen hat, eines Tages ›Herr Doktor‹ zu sagen?«
»Das war ihre Idee. Meinetwegen hätte sie weiterhin Burschi zu mir sagen können. So hat sie mich nämlich immer gerufen. Aber sie war ja so unsagbar stolz, dass aus dem Lausbuben ein Doktor geworden ist. Ich habe sie dann, als sie ›Herr Doktor‹ zu mir sagte, übrigens mit Frau Häfele angeredet, aber da war sie drei Tage beleidigt.«
Durch Mario lernte nun Fee auch ein Stück von Daniels Kindheit kennen.
Und so kamen auch die Erinnerungen an die Zeit, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren, als er ein halbwüchsiger Junge und sie ein kleines Mädchen gewesen waren, ungefähr im Alter von Mario.
Daran konnten sie sich beide nicht mehr erinnern.
»Siehst du, und so wird sich Mario eines Tages auch nicht mehr an dieses Geschehen erinnern können, wenn er ein anderes Elternhaus bekommt«, sagte Daniel.
»Ein anderes Elternhaus«, wiederholte Fee gedankenvoll. »Ja, wenn es wirklich niemanden gibt, der mit ihm verwandt ist, werden wir ihm Adoptiveltern suchen.«
»Vielleicht nimmt ihn Isabel. Sie hatte doch mal die glorreiche Idee, einen kleinen Vietnamesen adoptieren zu wollen. Mit ihren Berichten über die Waisenkinder hatte sie doch überwältigenden Erfolg.«
»Du selbst würdest wohl kein Kind adoptieren?«, fragte Fee.
»Nein, denn wir werden selbst genug bekommen, um ausreichend beschäftigt zu sein«, erwiderte Daniel, ohne zu überlegen.
»Und wenn ich keine Kinder bekäme?«
»Dann könnte man darüber immer noch reden.« Er sah sie an und griff nach ihrer Hand. »Man soll sich vom augenblicklichen Mitgefühl nicht verleiten lassen, Fee«, sagte er leise. »Ein Kind zu adoptieren, bringt eine ungeheure Verantwortung mit sich. Wenn die eigenen aus der Art schlagen, bleibt die Verpflichtung, alle Konsequenzen zu tragen. Wenn es aber ein adoptiertes Kind ist, könnte man sich doch allzu leicht von jeglicher Verantwortung freisprechen.«
»Aber man kann doch ein Kind genauso lieben«, wandte sie dagegen ein.
»Man kann es, aber man muss es erst liebenlernen: Das Kind, das eine Frau selbst zur Welt bringt, ist von der ersten Sekunde seines Daseins an ihr Kind. Ich schließe darin ein, dass sie es als einen Teil von sich selbst betrachtet, wenn sie weiß, dass sie ein Kind haben wird. Ja, ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, wie sich die Gefühle einer werdenden Mutter auf das werdende Leben auswirken.«
»Welche Gedanken?«, fragte Fee.
»Es gibt wohl nicht wenige Frauen, die zuerst entsetzt sind, wenn sie erfahren, dass sie ein Kind bekommen werden. Es gibt andere, die in einen Freudentaumel geraten, für die das Kind die Krönung einer Liebe ist. Und das bekommt das werdende kleine Wesen mit. Genauso wie später, wenn es auf der Welt ist. Es fühlt, ob seine Mutter ihm alle Liebe gibt oder nur eine geteilte. Es fühlt, ob sich die Mutter ihm mit ganzem Herzen widmet oder nervös wird, manchmal gar das Kind als Last betrachtet. Es wird ein zufriedenes Kind sein, wenn es sich immer geborgen fühlt, ein unzufriedenes, quengeliges Kind, wenn es beiseite geschoben wird.«
»Du hast dich wirklich damit beschäftigt, Daniel«, sagte Fee. »Du hast mir eine Lektion erteilt, die ich mir hinter die Ohren schreiben werde.«
Er sah sie zärtlich an.
»Du wirst eine gute Mutter sein, Liebes. Da ist mir nicht bange. Und ich hoffe, dass ich auch ein guter Vater sein werde. Aber gerade weil ich mir so viel Gedanken darüber mache und auch schon einige Erfahrungen sammeln konnte, würde ich niemals ein Kind adoptieren. Dazu gehört eben sehr viel Bereitschaft, innere Überzeugung und auch sehr viel Kraft.
Hilflose Babys sind immer niedlich. Plötzlich wächst das Kind heran, kriegt vielleicht abstehende Ohren oder sonstige Merkmale, die es nicht mehr so niedlich erscheinen lassen. Es wird vielleicht ein sehr trotziges oder ungezogenes Kind, obgleich man sich bemüht hat, es liebevoll zu erziehen. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Es kann an Zerstörungswut leiden, oder es entwickeln sich Eigenschaften, die einem fremd sind.
Meinst du nicht, dass dann sehr schnell der Gedanke kommt: Es ist ja nicht unser Kind. Das hat es von seinen Eltern, das ist das fremde Blut, das in ihm fließt. Und in dem Augenblick, wo solche Gedanken aufkommen, vermindert sich schon das Verständnis.«
»Kinder sind die Produkte ihrer Umgebung, nicht die ihrer Erbanlagen«, warf Fee ein.
»Das will ich nicht wegreden. Wahrscheinlich sind auch Adoptivkinder mit so verschiedenen Maßstäben zu messen wie die eigenen. Ich will nur sagen, dass ich sehr subjektiv urteile und ein Adoptivkind niemals so lieben könnte wie ein eigenes. Vorausgesetzt natürlich, dass man selbst Kinder haben kann. Du musst mich schon so nehmen, wie ich bin. Ich habe immer Hochachtung und Bewunderung für Eltern empfunden, die da keine Unterschiede machen, aber das liegt eben in der Natur des einzelnen.«
»Und wenn unsere Kinder Fehler hätten, die wir nicht begreifen könnten?«, fragte Fee.
»Dann würde ich nicht den Kindern die Schuld geben, sondern die Erziehungsfehler bei mir suchen, Fee. Ich wünsche, dass alle unsere Kinder so werden wie du.«
»Du Schmeichler! Meinst du, ich hätte keine Fehler?«
Er umschloss ihr Gesicht mit beiden Händen.
»Du bist eine wunderbare Frau. Das hast du gestern wieder bewiesen. Manche andere hätte ihren Unwillen bekundet, dass dieses Wochenende einen ganz anderen Verlauf genommen hat, als wir es uns vorgestellt haben.«
»Ärgerst du dich darüber?«
»Wie könnte ich, Liebling! Wir haben ein kleines Menschenleben gerettet, und nichts entbindet uns von der Verantwortung, nun auch dafür zu sorgen, dass Mario wieder ein frohes Kind wird.«
»Das hast du schön gesagt«, flüsterte Fee und küsste ihn auf den Mund. »Ich liebe dich, Daniel, und ich bin glücklich, dass unsere Kinder einen solchen Vater bekommen!«
»Es wird Zeit, dass wir heiraten und einen Sprössling bekommen, Fee«, murmelte er zwischen zwei zärtlichen Küssen.
Das war aber auch die einzige Stunde, die ihnen blieb, denn dann mussten sie sich dem schon wieder recht lebhaften Mario widmen, der ihnen unbedingt erzählen wollte, was er inzwischen alles von Lenchen gelernt hatte.
*
Unvorbereitet wollte Fee ihren Vater nicht mit dem Kind überraschen.
Dr. Cornelius fiel erst mal aus allen Wolken, als sie ihn anrief und ihm sagte, dass sie Mario mitbringen würde.
»Du lieber Gott, du lieber Gott«, murmelte er vor sich hin, als das Gespräch beendet war.
»Warum rufen Sie den lieben Gott an, Johannes?«, fragte Anne Fischer.
»Fee bringt einen kleinen Jungen mit«, erwiderte er.
»Einen Patienten von Daniel?«
»Nein, sie haben ihn aus dem Wasser gefischt. Sie waren beim Segeln am Chiemsee. Seine Eltern sind ertrunken.«
»Ich habe das heute Morgen im Radio gehört«, äußerte Anne nachdenklich. »Sie sagten, dass von einem Münchner Arzt ein Kind gerettet worden sei. An Daniel habe ich dabei aber nicht gedacht.« Sie sah Dr. Cornelius forschend an. »Ist es Ihnen nicht recht, dass Fee den Jungen mitbringt? Das arme Kind! Es muss doch entsetzlich sein, die Eltern zu verlieren.«
»Ich habe doch nichts dagegen, dass Fee ihn mitbringt, aber ich kenne sie. Vor lauter Mitgefühl wird sie ihr ganzes Herz an das Kind hängen. Und ich kenne auch Daniel. Er durchdenkt alles.« Er seufzte wieder. »Es ist ein kleiner Italiener. Er spricht kaum Deutsch.«
»Das wird er schnell lernen. Katja spricht perfekt Italienisch. Oh, ich muss es ihr gleich sagen. Für sie wird es eine Freude sein.«
Warten wir es ab, dachte Dr. Cornelius.
Mario war indessen recht zufrieden mit allem, was er an diesem Tag erlebte. Um ihm möglichst viele neue Eindrücke zu vermitteln, waren Daniel und Fee mit ihm am Nachmittag in den Tierpark gefahren.
So viel fremdartige Tiere hatte Mario noch niemals gesehen.
Vor den Elefanten hatte er ein bisschen Angst, weil sie gar so groß waren, vor den Raubtieren ebenfalls. Aber die lustigen Affen und die schwatzhaften Papageien gefielen ihm sehr. Er wollte sich gar nicht von ihnen trennen.
Dann durfte er auch noch auf einem Pony reiten und den munteren Seehunden zuschauen. Viel zu schnell verging ihm die Zeit.
Er fragte Fee, ob sie wieder einmal dorthin fahren würden.
Er fragte auch, wie lange er bei ihnen bleiben dürfe, und war ein wenig traurig, als Fee ihm erklärte, dass sie am nächsten Morgen wegfahren würden.
Mario wollte gern bei Nonna Lenchen und dem Dottore bleiben, aber Fee versicherte ihm, dass es ihm auf der Insel bestimmt auch gefallen würde.
Nun, anschauen konnte er es sich ja mal. Für alles Neue zeigte er sich sehr aufgeschlossen. Er war sehr aufnahmefähig und begriff schnell.
Am Abend hatte er seinen deutschen Wortschatz schon vergrößert, und Fee hatte erfahren, dass er noch gar nicht lange hier gewohnt hatte.
Seltsamerweise erwähnte er Papa und Mama nicht. Vielleicht versuchte er schon jetzt, die Erinnerungen zu verdrängen.
Lenchen hätte nichts dagegen einzuwenden gehabt, wenn der Junge geblieben wäre, aber sie war so vernünftig, einzusehen, dass er hier nicht die Abwechslung haben würde wie auf der »Insel der Hoffnung«.
So gut war sie doch nicht mehr auf den Beinen, dass sie mit dem Jungen herumlaufen konnte.
Vor der Heimfahrt wollte Fee noch einige Sachen für Mario kaufen.
Nach dem Frühstück hatte Daniel die Polizeistation am Chiemsee angerufen und sich erkundigt, ob sich schon jemand gemeldet hätte, der das italienische Ehepaar gekannt hatte, aber dies war nicht der Fall.
So war der Junge einstweilen nur Mario, ohne Nachnamen, ein Kind ohne Eltern. Und man war froh, ihn nicht in einem Heim unterbringen zu müssen.
Mario erkundigte sich eingehend, was der Dottore jetzt machen würde und wann sie ihn wieder besuchen würden. Aber zum Abschied sagte er: »Arividerci, Daniel.«
Von Nonna Lenchen fiel ihm der Abschied noch schwerer. Sie gab ihm Kuchen und eine Tafel Schokolade mit.
Fee kleidete den Jungen ein. Er brauchte ein paar warme Sachen, denn bald konnte das Wetter umschlagen.
Fee dachte gar nicht daran, dass er womöglich nur für kurze Zeit bei ihnen bleiben könnte. Und daran dachte Mario wohl auch nicht mehr.
Er versicherte ihr während der Fahrt immer wieder, dass sie alle sehr lieb seien und er sie auch sehr lieb hätte.
Ob sie nie mit Daniel schimpfe, wollte er ebenfalls wissen, und auch, warum sie nicht immer beisammen wären.
Sie erzählte ihm, dass sie auch Ärztin sei, und da wurden seine Augen ganz groß. Er hätte gemeint, dass sie ein großes Mädchen sei, sagte Mario.
Als sie dann über die schmale Landzunge zur Insel fuhren, schloss er die Augen.
Sein kleines Gesicht war erblasst, als er den See sah. Aber es bekam schnell wieder Farbe, als sie von Dr. Cornelius und Anne Fischer in Empfang genommen wurden.
Die vielen hübschen Häuschen gefielen ihm sehr, und er staunte, als Fee ihm erzählte, dass die Leute hier immer nur ein paar Wochen bleiben würden und dann neue kämen.
Mit Katja schloss er schnell Freundschaft. Sie führte ihn dann auch auf der lnsel herum und zeigte ihm alles. Ihm gefiel es auch hier sehr gut.
»Und was soll nun werden?«, fragte Dr. Cornelius seine Tochter währenddessen.
»Wir werden abwarten, und wenn es möglich ist, wollen wir Adoptiveltern für ihn suchen«, erwiderte Fee.
Johannes Cornelius war erleichtert.
»Ich dachte schon, du wolltest ihn behalten«, meinte er.
»Gefällt er dir nicht? Er ist doch ein liebes Kerlchen«, sagte Fee. »Daniel hat mich allerdings überzeugt, dass er lieber eigene Kinder haben möchte.«
»Das ist sehr vernünftig und ganz meine Meinung.«
»Stört er dich?«, fragte Fee befremdet.
»Durchaus nicht. Für Katja ist es sogar recht nett, dass sie Gesellschaft hat. Sie kann sich mit ihm beschäftigen und wird hoffentlich von David Delorme abgelenkt.«
»Was du nur gegen diese Freundschaft hast, Paps«, äußerte Fee kopfschüttelnd.
»Sie verrennt sich zu sehr in diese Träume. Eines Tages zerplatzen sie, und dann gibt es ein böses Erwachen für sie.«
»Nur weil er Künstler ist?«
»Weil Katja nicht dafür geschaffen ist, durch die Welt zu zigeunern. Sie braucht Sicherheit und Ruhe.«
Er machte eine kleine Pause.
»Und eine Aufgabe«, fügte er hinzu.
Nun, die hatte Katja jetzt zugeteilt bekommen, und sie schien damit durchaus einverstanden zu sein. Fee fragte sich nur, ob es diesem empfindsamen Mädchen nicht weh tun würde, wenn man ihm Mario wieder wegnahm.
Für ihn war es ein bisschen verwirrend, dass sich so viele Menschen um ihn kümmerten, dass er plötzlich zum Mittelpunkt wurde, um den sich alles zu drehen schien. Dass er außerdem verwöhnt wurde wie nie zuvor in seinem Leben.
Jeder wollte dem Bambino, der so plötzlich ein Waisenkind geworden war, etwas Gutes tun, und Dr. Cornelius machte da keine Ausnahme.
*
Der erste Anruf, den Helga Moll entgegennahm, kam von Isabel Guntram. Molly gefiel das gar nicht. Am Montagmorgen, in aller Frühe, wo sowieso immer so viel los war, brauchte sie wahrhaftig nicht daherzukommen.
Molly hatte eigentlich nichts gegen Isabel, aber die Anhänglichkeit fand sie doch etwas übertrieben, da es auch Isabel hinreichend bekannt war, dass Dr. Norden vergeben war.
Diesbezüglich hatte Molly etwas altmodische Ansichten. Sie fand, dass sich das einfach nicht gehörte.
Sie hatte noch kaum mit dem Chef sprechen können, da das ganze Wartezimmer gesteckt voll war. Montags war das immer so.
Aber mit dieser Auskunft gab sich Isabel nicht zufrieden. Sie müsse Dr. Norden unbedingt sprechen wegen des kleinen Italieners, den er gestern gerettet hatte.
Das war Molly nun ganz neu. Sie fiel aus allen Wolken.
Am liebsten hätte sie Dr. Norden gleich danach gefragt, aber das war nicht möglich, da er bei einer Untersuchung war.
Aber sie stellte das Gespräch doch durch, und es dauerte ein paar Minuten.
Molly musste ihre Neugierde zügeln. Erst eine Stunde später hatte sie Gelegenheit, ihre Frage anzubringen,
»Wieso haben Sie einen kleinen Italiener gerettet?«, fragte sie ohne Umschweife.
»Weil er sonst ertrunken wäre, wie seine Eltern.«
Molly schnappte nach Luft.
»Sie waren das? Wir haben es im Radio gehört und auf diesen Leichtsinn geschimpft. Wir haben auch gesagt, dass sich deswegen noch ein anderer in Gefahr bringen muss.«
»Sie sehen mich gesund, Molly«, bemerkte Daniel nachsichtig.
»Und was ist mit dem Kind?«
»Mario ist jetzt auf der Insel.«
»Jetzt wäre es aber langsam Zeit, dass die Aufregungen mal aufhören«, meinte Molly. »Ich dachte, dass Sie wenigstens mal richtig ausspannen könnten.«
»Das haben wir nach dem Schrecken auch getan.«
Die Arbeit ging weiter. Er wollte sich mittags mit Isabel treffen.
Sie hatte natürlich gleich wieder in Erfahrung gebracht, dass er derjenige gewesen war, der Mario gerettet hatte, und sie wollte sich auch Informationen besorgen. In diesem Fall war ihm das ganz recht.
Es war ganz angenehm, wenn man gute Beziehungen zur Presse hatte.
Daniel wurde ziemlich pünktlich fertig. Er hatte sich in einem netten kleinen Restaurant mit Isabel verabredet, das nicht weit entfernt von seiner Praxis lag.
Sie begrüßte ihn mit einem hintergründigen Lächeln.
»Du bietest uns ja zeitungsfüllendes Programm, Daniel«, sagte sie.
»Macht bloß nicht zu viel Wind. Nun, was gibt es?«
»Allerhand. Der Arbeitgeber hat sich auf die Beschreibung hin gemeldet. Das Ehepaar hieß Peruzzi. Sie sind erst vor drei Wochen nach Deutschland gekommen. Der Mann war Automechaniker, die Frau wollte als Locherin anfangen. Verwandte scheinen nicht vorhanden zu sein. Was wird mit dem Jungen?«
»Das lassen wir an uns herankommen. Er ist auf der Insel gut untergebracht. Über all den neuen Eindrücken wird er das Unglück wohl rasch vergessen.«
»Aber er hat keine Eltern mehr«, sagte Isabel.
»Wir werden uns bemühen, welche für ihn zu finden.«
»Es ist nicht so einfach.«
»Er ist ein niedliches Kind, und solche Geschichten rühren immer an die Herzen.«
»Möchtest du, dass ich einen Artikel über ihn schreibe und mit seinem Bild bringe?«
»Nein!«, erwiderte er so entschlossen, dass sie ihn erstaunt anblickte. »Lenchen würde es mir verflixt übelnehmen, wenn ich zulassen würde, dass er auf dem Präsentierteller angeboten wird. Es eilt auch gar nicht.«
Eine Weile aß Isabel schweigend, wenn auch nicht gerade mit Appetit. Sie dachte nach.
»Übrigens ist Jürgen Sperber heute auf freien Fuß gesetzt worden«, sagte sie dann zusammenhanglos. »Monika steht wieder in ihrer Boutique.«
»Sonst weißt du nichts?«, fragte Daniel mit leichtem Spott.
»Man ist sehr wenig mitteilsam. Die Rauschgifthändler scheinen geschnappt worden zu sein. Warum grinst du so anzüglich? «
»Weil ich diesmal ein bisschen mehr weiß als du«, erwiderte er lässig.
»Erzähle, Daniel!«, bat sie drängend.
Er winkte ab. »Meine Mission ist beendet. Wende dich an Dr. Arndt. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht bekommst du dann Exklusivrechte. Ich denke, dass jetzt auch bald eine Hochzeit fällig sein wird. Doch wieder mal was für eure Klatschspalte.«
»Ich warte auf den Tag, an dem ich über Dr. Nordens Hochzeit berichten kann.«
»Wen interessiert das schon! Es wird eine ganz bürgerliche Hochzeit werden, ohne Tamtam.«
»Und wann?«
»Da musst du Fee fragen.«
»Du drückst dich immer, und so was nennt man Freundschaft!«
In seinen Augen blitzte der Schalk.
»Du wirst jedenfalls Trauzeugin, wenn es dir recht ist.«
»Musst du da nicht erst Fee fragen?«, spottete sie.
»Dr. Schoeller wird der andere Trauzeuge«, fuhr er im Neckton fort.
Flüchtige Röte stieg ihr in die Wangen.
»Ich lasse mich nicht verkuppeln.«
»Wer will das denn? Du bist eine emanzipierte Frau. Du bist doch mit deinem Beruf verheiratet.«
»So ist es nun auch wieder nicht«, entgegnete Isabel leise. »Kommst du Donnerstag ins Konzert?«
»Das lässt sich heute noch nicht sagen. Man muss immer auf Überraschungen gefasst sein. Weiß ich denn, was mir diese Woche blüht?«
So trennten sich wieder. Jeder ging seiner Arbeit nach. Eigentlich war es nie anders zwischen ihnen gewesen, nur hatte Isabel es sich manchmal anders gewünscht gehabt. Doch darüber war sie hinweg. Verwundert stellte sie es fest, als sie zu ihrer Redaktion fuhr.
Jetzt hatte sie wirklich Abstand gewonnen. Sie dachte nicht mehr daran, dass Dr. Daniel Norden einmal ihr sonst so kühles Herz in Flammen versetzt hatte.
Freundschaft ist der Anfang oder das Ende einer Liebe, hieß es. Für sie war es das Ende. Daniel hatte die Frau gefunden, die ihn glücklich machte. Wie ausgeglichen er war, wie reif geworden in diesen letzten Monaten.
Sie konnte nur gute Gedanken für ihn hegen, und sie wünschte ihm und Fee die Erfüllung ihrer Liebe.
*
Am nächsten Tag traf Daniel am Lift Dr. Arndt. Er kam von Krankenbesuchen, der Anwalt vom Gericht.
Dr. Arndt hatte sich schnell erholt. Seine Miene war zuversichtlich.
»Sie werden schon gelesen haben, dass Jürgen Sperber frei ist«, sagte er.
»Gelesen nicht, aber gehört.«
»Sie scheinen gute Verbindungen zur Presse zu haben«, bemerkte Dr. Arndt lächelnd. »Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit Frau Guntram. Eine charmante Frau. Sie müssen schon einverstanden sein, dass Ihre Verdienste bei der Auflärung dieses Falles nicht unerwähnt bleiben.«
»Muss ich das?«, fragte Daniel seufzend.
»Ohne Sie wäre er nicht so schnell aufgeklärt worden. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen, Herr Norden. Falls Sie mal einen Anwalt brauchen, stehe ich jederzeit zu Ihrer Verfügung.«
»Hoffentlich brauche ich keinen«, scherzte Daniel.
»Wie soll ich dann mein Schuldenkonto bei Ihnen ausgleichen?«
»Vielleicht habe ich mal einen armen Patienten, der juristischen Rat braucht.«
»Sie können jeden zu mir schicken.«
»Und falls Sie mal einen Arzt brauchen …«
»Dann fahre ich eine Treppe höher. Aber vorerst wollte ich mal anfragen, ob Petra sich nicht in Ihrem Sanatorium erholen kann.«
»Das wird sich einrichten lassen.«
»Und wenn ich etwas für den kleinen Italiener tun kann, bin ich gern bereit dazu. Brauchen Sie nach dieser turbulenten Woche nicht auch Erholung?«
»Ich bin ganz munter«, erwiderte Daniel lachend. »Geht es den beiden jungen Damen gut?«
»Wir haben den Schrecken überwunden. Petra lässt sich von Thommy die Zeit vertreiben. Für sie war es ein heilsamer Schock. Sie hat den Wert des Lebens begriffen. Sie wird künftig wählerischer in ihrem Umgang sein. Und der junge Sperber wird seinem Vater wohl auch keine Sorgen mehr bereiten. Die ganze Bande sitzt jetzt hinter Schloss und Riegel.«
»Und wann findet der Prozess statt?«
»Der Termin steht noch nicht fest, aber es wird wohl unvermeidbar sein, dass wir uns auch im Gerichtssaal wiedertreffen, Herr Norden.«
»Solange ich nicht als Angeklagter dort stehen muss, werde ich es in Kauf nehmen. Dann weiterhin erfolgreiche Arbeit, Herr Arndt.«
»Desgleichen.«
Sie verabschiedeten sich mit einem festen Händedruck.
Nun profitiert Isabel wenigstens davon, dachte Daniel. Hoffentlich schreibt sie nicht gleich einen ganzen Roman über mich.
Molly sagte ihm, dass Dr. Behnisch und auch Professor Wiese angerufen hätten. Bei dem Letzteren ging es wohl um Martin Kraft.
Daniel rief gleich zurück und erfuhr, dass der Patient mit Erfolg operiert worden sei. Ein Stein fiel ihm vom Herzen.
Mit gutem Zureden konnte man nicht alle Krankheiten heilen. Manchmal behielt doch der Chirurg das letzte Wort, und es war gut, wenn man sich dann nicht den Vorwurf machen musste, etwas versäumt zu haben.
Was mochte Dieter von ihm wollen? Er vergaß dann doch, ihn anzurufen, weil er ein paar dringende Besuche machen musste, aber Dieter brachte sich in Erinnerung.
Er fragte, ob er am Abend nicht ein Stündchen Zeit für ihn hätte.
»Komm zu mir, dann machen wir es uns gemütlich, wenn du weg kannst«, schlug Daniel vor.
»Ab und zu brauche ich auch mal eine Verschnaufpause«, erwiderte Dr. Behnisch.
Er kam ziemlich pünktlich, aber abgehetzt und hungrig. Nun, Lenchen hatte dafür gesorgt, dass sie nicht darben mussten. Gegen Männerbesuch hatte sie nichts einzuwenden.
»Ich muss einen neuen Assistenzarzt einstellen«, sagte Dieter. »Wir schaffen es nicht mehr zu dritt. Weißt du einen?«
»Aus dem Handgelenk kann ich keinen schütteln, aber ich werde mich umhören.«
»Und eine neue Krankenschwester brauche ich auch. Wenn du mir mal wieder Patienten schickst, Dan, dann bitte nur welche, die mir nicht das Personal reduzieren.«
»Wieso das?«, fragte Daniel betroffen.
»Schwester Annelie hat gekündigt. Sie wird als Betreuerin zu dem kleinen Grothe gehen.«
»Du liebe Güte! Das wird kaum von langer Dauer sein.«
»Wie meinst du das?«
»Mit der Frau unter einem Dach? Das hält niemand lange aus.«
»Grothe lässt sich scheiden. Seine Frau hat das Haus schon verlassen.«
»Wie hat er denn das fertiggebracht?«
»Es wird ihr kaum etwas anderes übriggeblieben sein. Die Treueste war sie wohl nicht.«
»Wem sagst du das, aber dass er endlich die Konsequenzen gezogen hat, wundert mich doch.«
»Er hängt sehr an seinem Kind, und wenn mich nicht alles täuscht, wird Annelie auch nicht allzu lange nur Betreuerin seines Sohnes bleiben. Ich würde es ihr gönnen. Sie hat genug mitgemacht in ihrem Leben.«
»Also trägst du es mir nicht nach, wenn du dir eine neue Schwester suchen musst? «
»In diesem Fall nicht. Jeder Mensch braucht was fürs Gemüt. Man könnte neidisch werden.«
»Dann schau dich doch mal unter den Schönen des Landes um«, meinte Daniel neckend.
»Lieber unter den Guten, aber die sind dünn gesät. Außerdem habe ich keine Zeit.«
Daniel sah ihn forschend an.
»Da fällt mir etwas ein«, sagte er. »Einen Arzt weiß ich im Augenblick nicht, aber eine Ärztin, die ich dir empfehlen könnte.«
»Eine Ärztin in einer chirurgischen Klinik?«
»Ja, es gibt auch Frauen, die diesen Berufszweig wählen, aber es wird ihnen verdammt schwergemacht, in einer Klinik unterzukommen. Unsere lieben Kollegen sind da recht heikel. Du auch?«
»Skeptisch, das gebe ich zu. Aber wenn sie tüchtig ist, könnte man es mal versuchen. Wie heißt sie denn?«
»Jenny Lenz.«
»Hurra, der Lenz ist da!«, spottete Dieter Behnisch.
»So taufrisch ist sie nicht mehr.«
»Ich kann auch keine brauchen, die den Patienten den Kopf verdreht. Wie ist sie zu erreichen?«
»Ich werde sie mal zu dir schicken, wenn du Interesse hast.«
»Tu das, falls sie nicht zu karrieresüchtig ist. Da steht bei mir nichts drin. Bei uns herrscht Teamwork. Wo war sie denn bisher?«
»In einem Entwicklungsland. Ich weiß nicht genau, wo. Mein Vater kannte ihren Vater sehr gut. Sie hat mir vor ein paar Wochen mal einen kurzen Besuch gemacht. Ich lasse morgen von Molly ihre Adresse heraussuchen. Sie weiß besser als ich, wo sie zu finden ist.«
»Aber es ist doch hoffentlich keine alte Liebe von dir?«, fragte Dieter Behnisch.
»Ich habe keine alte Lieben. Ich habe nur eine einzige.«
»Wohl dem, der das sagen kann«, brummte Dieter.
»Trinken wir darauf, dass dir die einzige auch noch begegnet«, sagte Daniel mit einem unergründlichen Lächeln.
*
Molly hatte nach all den Ereignissen beschlossen, sich über nichts mehr zu wundern, und so wunderte sie sich auch nicht, als Dr. Norden nach der Adresse von Jenny Lenz fragte.
Sie brauchte nicht lange zu suchen. Sie war die Korrektheit in Person.
Daniel rief Jenny sofort an, damit es nicht wieder in Vergessenheit geriet.
Sie meldete sich so schnell, dass man meinen konnte, sie hätte auf einen Anruf gewartet. Ihre warme, dunkle Stimme tönte an Daniels Ohr. Er hatte den Eindruck, dass sie bedrückt klang.
»Haben Sie schon eine Stellung gefunden, Jenny?«, fragte er.
Nein, sie hatte nicht. Daher kam wohl ihre Niedergeschlagenheit.
»Vielleicht habe ich etwas für Sie«, sagte Daniel aufmunternd. »Stellen Sie sich mal bei Dr. Behnisch vor. Privatklinik. Er ist ein Studienfreund von mir. Ich habe Sie schon offeriert.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, Daniel. Ich wollte schon meine Koffer packen und das Weite suchen.«
»Nicht so schnell. Setzen Sie sich mit ihm in Verbindung. Ich hoffe, dass es klappt.«
Sie bedankte sich nochmals, und Daniel beschloss, ein gutes Wort für sie einzulegen. Sie schien in einer recht prekären Situation zu sein.
Er verständigte Dieter Behnisch und bat ihn, Toleranz walten zu lassen.
Um was er sich alles kümmert, dachte Molly. Bei ihm klopft wirklich niemand vergeblich an. Ja, sie wäre für
ihren Dr. Norden durchs Feuer gegangen.
Was Isabel Guntram über ihn geschrieben hatte, stimmte haargenau, aber Molly bezweifelte, dass ihm dieser Lobgesang gefallen würde.
Wie sie ihn kannte, hatte er noch keine Zeitung gelesen. Jetzt musste er ja morgens immer mit Fee telefonieren, um sich nach ihrem und Marios Befinden zu erkundigen. Da blieb keine Zeit mehr für die Zeitungslektüre.
Sie selbst nahm sich allerdings sonst auch wenig Zeit dafür, aber heute war sie von ihrer Tochter Sabine, die bei Isabel Guntram als Volontärin arbeitete, extra auf den Artikel aufmerksam gemacht worden.
Liebe Güte, welche wichtige Rolle Dr. Norden im Fall Sperber gespielt hatte, war ihr noch gar nicht richtig bewusst geworden. Jetzt konnte sie es lesen.
Sie war so vertieft, dass sie gar nicht merkte, dass Dr. Norden sie schon eine Weile schmunzelnd beobachtete.
»Was gibt es denn so Interessantes, dass Sie nichts hören und nichts sehen, Molly?«, fragte er freundlich.
»Dr. Norden, der Held des Tages!«, sagte sie enthusiastisch.
»Allmächtiger! Ist das nun gute oder schlechte Publicity?«
»Natürlich gute«, behauptete Molly überzeugt.
»Und wenn sie uns die Bude einrennen, müssen Sie noch mehr arbeiten. Isabel kann es doch nicht lassen.«
»Da hat Sabines Uwe auch mitgemischt«, erklärte Molly stolz. »Der Junge macht sich.«
Daniel warf ihr einen schrägen Blick zu. Vor noch gar nicht langer Zeit hatte Molly allerlei einzuwenden gehabt gegen die Freundschaft ihrer hübschen Tochter mit dem jungen Reporter. Das schien behoben zu sein.
»Mausert sich der zukünftige Schwiegersohn?«, fragte er lächelnd.
»So weit ist es doch noch nicht«, erwiderte Molly leicht verlegen. »Sie sind beide noch so jung und können sich Zeit lassen. Aber ab und zu bringt Sabine ihn mit. Er ist ein netter Junge.«
Daniel wünschte ihr von Herzen einen Schwiegersohn, mit dem sie zufrieden sein konnte, nachdem sie so viel in ihrer Ehe mitgemacht hatte.
Für sich hoffte er jetzt nur, dass nicht jeder Patient von dieser Geschichte anfangen würde, aber das blieb nicht aus.
Er musste sich heute doch höllisch zusammennehmen, damit ihm die Geduld nicht riss. Und dann fing Lenchen am Abend auch noch damit an.
»Verschon mich bitte damit«, sagte er. »Mir dröhnen schon die Ohren, und meine Zunge ist ganz lahm, weil ich dauernd das Gleiche sagen musste.«
»Was recht ist, muss recht bleiben«, meinte sie gekränkt. »Warum soll nicht geschrieben werden, was Sie riskiert haben. Ich muss es erst in der Zeitung lesen. Sie erzählen mir ja nichts.«
»Sei nicht grantig, Lenchen. Ich bin den Burschen doch nicht nachgelaufen. Sie sind uns ins Haus geschneit.«
»So ein Gesindel!«, schimpfte sie. »Hoffentlich kriegen sie wenigstens eine saftige Strafe, aber heutzutage kommen sie ja immer mit einem blauen Auge davon. Demokratie nennt sich so was!«
Wenn Lenchen mit der Politik anfing, war es besser, zu schweigen. Sie legte andere Maßstäbe an. Für sie gab es nur gut oder schlecht und dazwischen nichts, auch keine Entschuldigungen.
Zum Glück gab es jetzt jedoch etwas anderes, was sie mehr interessierte.
»Aber Sie werden doch nicht zulassen, dass unser kleiner Mario zu Leuten kommt, von denen man gar nichts weiß, und erst recht nicht in ein Heim! Das werden Sie doch nicht zulassen?«
»Nein.«
Ihr Gesicht glättete sich.
»Das wäre auch noch schöner! Die meisten Menschen tun doch nur mitleidig, und nachher wird solch armes Würmchen herumgestoßen.«
»Er könnte ja auch Glück haben«, äußerte Daniel.
Lenchens Stirn legte sich schon wieder in tiefe Falten.
»Ich weiß, wie das ist, wenn man herumgestoßen wird«, brummte sie. »Hab’ es ja selbst mitgemacht. Von den einen Pflegeeltern zu den anderen. Viel Tränen gab’s und wenig Brot.«
»Die Zeiten haben sich geändert, Lenchen«, sagte Daniel mitfühlend. »Jetzt werden andere Maßstäbe angelegt, wenn ein Kind zur Adoption freigegeben wird. Wir werden schon aufpassen.«
Damit gab sie sich vorerst zufrieden. Sie wollte ihrem Doktor ja auch nicht auf die Nerven fallen, wenn er mal eine Ruhepause hatte.
Nun, für Mario gab es keine Tränen mehr. Und dass er herumgestoßen wurde, konnte man wahrhaftig nicht sagen.
Er war Hahn im Korbe, aber das Liebenswerte an ihm war, dass er es nicht ausnützte.
Er war dankbar und anhänglich. Er wollte jedem eine Freude machen.
Er hatte sich auch in das Herz von Johannes Cornelius geschmeichelt. Fee konnte nur noch staunen, denn in jeder freien Minute befasste sich ihr Vater mit dem Kleinen.
Die meiste Zeit verbrachte Mario allerdings mit Katja, da alle anderen anderweitig beschäftigt waren.
Er konnte jetzt schon viele deutsche Worte sagen, sogar Sätze. Sie brachte ihm Kinderlieder bei, und die Erwachsenen lauschten entzückt, wenn er mit seiner hübschen, glockenreinen Stimme sang.
So war Isabels Artikel über Mario gar nicht mit Beifall aufgenommen worden, so gern man sie hier sonst hatte.
Eigentlich konnte sich niemand so recht vorstellen, dass Mario einmal nicht mehr bei ihnen sein könnte.
Natürlich hatte man über Daniels Abenteuer auch auf der Insel gelesen. So begehrt war die Zeitung selten wie an diesem Tag. Sie wanderte von einer Hand in die andere.
»Lest nicht alles heraus«, scherzte Dr. Cornelius. »Lasst für mich auch noch was übrig.«
*
Dass Daniel wohl immer den richtigen Riecher hatte, konnte auch Dr. Behnisch feststellen, als er endlich zu seiner Unterredung mit Jenny Lenz kam.
Sie hatte ziemlich lange auf ihn warten müssen, weil ihn mal wieder ein akuter Blinddarm unversehens im Operationssaal festgehalten hatte. Aber das Warten hatte sich gelohnt.
Nicht mehr taufrisch hatte Daniel die junge Ärztin bezeichnet, und das mochte auch stimmen, obgleich sie gerade erst die Dreißig erreicht haben mochte.
Erfahrung und Reife hatte ihre Gesichtszüge geprägt, doch ihre Befangenheit und die geheime Angst in ihren Augen ließen sie jetzt doch mädchenhaft erscheinen.
Ob sie mich jetzt mit Daniel vergleicht, überlegte Dr. Behnisch, als er forschend das schmale kluge Gesicht betrachtete.
Eitelkeit schien Jenny Lenz fremd zu sein. Schlichter und unauffälliger konnte sich eine Frau kaum kleiden. Nicht eine Spur Make-up war zu sehen.
Schweigend hatte sie ihm ihre Referenzen auf den Schreibtisch gelegt.
Er blätterte sie nur flüchtig durch und dachte, dass er nie auf den Gedanken gekommen wäre, eine Ärztin zu engagieren, wenn Daniel sie ihm nicht offeriert hätte.
»In Uganda waren Sie also«, sagte er. »Ich kann mir keine Vorstellung davon machen.«
»Das kann man auch nicht, wenn man nicht dort war«, erwiderte sie.
Sie gewann langsam an Sicherheit. Dr. Behnisch war freundlich. Er musterte sie nicht herablassend; nicht mit jenem Sarkasmus, den sie fürchten gelernt hatte.
»Haben Sie schon selbständig operiert?«, fragte er.
»Selbstverständlich.«
Es klang auch selbstverständlich. Sein Blick wurde nachdenklich.
»Und was alles?«, fragte er.
»Was notwendig war.«
»Warum sind Sie hingegangen?«
»Weil man mir hier keine Chance gab.«
»Und warum sind Sie zurückgekommen?«
»Weil mir das Klima zu schaffen machte.«
Viele Worte schien sie nicht zu lieben. Auch das war ein sympathischer Zug, denn schwatzhafte Frauen ertrug Dr. Behnisch nicht.
»Sie werden mit drei männlichen Kollegen zusammenarbeiten müssen«, erklärte er.
Jetzt lächelte Jenny flüchtig.
»Es schreckt mich nicht, wenn es die Kollegen nicht schreckt.«
»Das wird sich herausstellen. Probieren wir es vier Wochen miteinander. Sind Sie einverstanden?«
»Probezeit ist üblich«, sagte sie freundlich. »Ich danke Ihnen.«
»Wann wollen Sie anfangen?«
»Morgen. Oder gleich, wenn Sie wollen.«
»Gleich? Das wäre nicht übel. Vielleicht kann ich dann doch mal wieder eine Nacht durchschlafen.«
Er konnte es. Er fand nichts an ihr auszusetzen, als sie am nächsten Morgen Bericht erstattete und erst recht nicht, als sie ihm anderntags bei einer Magenoperation assistierte.
Es war Anlass für ihn, Daniel anzurufen und ihm zu sagen, dass er sehr zufrieden mit Jenny Lenz sei.
»Was? Sie arbeitet schon?«, fragte Daniel staunend.
»Und wie! Sie bringt Schwung in den Laden.«
»Keine Skepsis mehr?«, fragte Daniel.
»Man gewöhnt sich schnell daran, so was Hübsches, Sanftes um sich zu haben«, erwiderte Dieter Behnisch.
»Ist sie hübsch und sanft?«
»Du kennst sie doch länger als ich.«
»Aber anscheinend nicht so gut wie du«, konterte Daniel mit einem unergründlichen Lächeln, aber das konnte Dieter nicht sehen.
Komisch, dachte er, ich kenne sie wirklich schon gut.
»Er findet sie hübsch und sanft«, murmelte Daniel vor sich hin.
»Was meinten Sie?«, fragte Molly.
»Habe ich was gesagt? Ich werde wohl schon wunderlich und führe Selbstgespräche.«
»Wundern würde es mich nicht, bei dem Arbeitspensum, das hinter Ihnen liegt. Sie müssen mal ausspannen, richtig ausspannen.«
»Nächstes Wochenende.«
»Nicht nur ein Wochenende! Ferien müssen Sie machen!«, erklärte Molly eindringlich.
»Die muss ich mir für die Flitterwochen aufheben, Molly. Morgen ist wieder ein Monat zu Ende.«
Richtig sehnsüchtig klang es. Molly lächelte mütterlich, als er zum Telefon schielte. Sie ging schnell wieder hinaus.
*
»Was macht Fee?«, fragte Dr. Cornelius den kleinen Mario, der sich wieder mal mühte, ein schweres Wort auszusprechen.
»Te-le-fonieren. Richtig, Paps?«, fragte er schelmisch.
Weil Fee Paps sagte, sagte er es
auch, und Dr. Cornelius ließ es sich gefallen.
»Richtig, Mario. Willst du mit mir in die Stadt fahren?«
»Stadt?«, fragte Mario.
»Ja, in die Stadt. Ich muss etwas besorgen.«
»Kaufen?« Wie gut er schon verstand.
»Ja, kaufen.«
»Du nimmst mit Mario?«
»Willst du?«
»Mario will.« Er nickte eifrig. Er musste es auch gleich Anne Fischer verkünden. »Mario fährt nach Stadt mit Paps. Mit Auto.«
»Na, dann viel Spaß«, sagte Anne liebevoll. Sie lächelte in sich hinein. Wenn das kein Beweis der Zuneigung war, wollte sie nicht mehr Anna Fischer heißen.
»Spaß mit Paps«, jauchzte Mario.
Fee sah gerade noch die Schlusslichter des Wagens, als sie aus dem Haus kam.
»Dein Vater hat Mario mitgenommen«, erklärte Anne.
Fee lächelte. »Er hat wohl Angst, dass ihn jemand stehlen könnte?«
»Das scheint mir auch fast so. Er ist ganz närrisch mit dem Kleinen.«
»Ja, wer hätte das gedacht«, meinte Fee. »Wie schnell man sich an ein Kind gewöhnen kann.« Sie ging zum Schreibtisch. »Wie sieht es denn mit den Zimmern aus, Anne? Daniel hat wieder eine Patientin für uns.«
»Die nächsten vier Wochen ist nichts zu machen. Beim besten Willen nicht, Fee. Herr Moeller und Lissy reisen ab, aber die Räume sind schon wieder belegt.«
»Die beiden werden wir vermissen«, bemerkte Fee.
»Sie haben sich gesucht und gefunden. Ein nettes Pärchen.«
»Und was wird mit unseren Tanztees?«
»Die behalten wir bei. Dabei wird sich wohl noch manches Paar finden.«
»Das gehört eigentlich nicht zu unseren Aufgaben, Anne«, sagte Fee fröhlich.
»Es ergibt sich von selbst. Liebe ist die beste Medizin, meinst du nicht auch, Fee?«
»Nur wenn man die Erfüllung findet. Was ist eigentlich mit Katja los?«
»Sie hat schon eine Woche keine Post von David. Warum kann sie nicht sein wie andere junge Mädchen, Fee? Sie ist doch jetzt gesund, sie ist jung, und sie ist hübsch.«
»Aber sie liebt David, und gegen
Liebe ist nun mal kein Kraut gewachsen.«
»Ich mache mir so viel Sorgen, Fee.«
»Ich weiß, Anne. Du hast ihretwegen schon Sorgen genug gehabt. Ich möchte so gern, dass du auch einmal wieder ganz froh sein kannst.«
Da kam Katja über den Rasen gelaufen.
Man sah ihr nicht mehr an, dass sie noch vor ein paar Monaten im Rollstuhl gesessen hatte. Ganz leicht waren ihre Schritte.
»Wo ist Mario?«, fragte sie.
»Er ist mit Paps in die Stadt gefahren«, erwiderte Fee.
Enttäuschung malte sich auf Katjas reizvollem Gesicht.
»Sie hätten mich doch mitnehmen können«, sagte sie.
»Du hast dich den ganzen Tag nicht blicken lassen«, warf ihre Mutter ein.
»Ich habe doch für Mario etwas gebastelt. Es sollte eine Überraschung sein. Und nun ist er nicht da«, äußerte Katja bekümmert.
»Er bleibt ja nicht ewig weg. Was hast du denn gebastelt?«, fragte Anne ihre Tochter.
»Ein Mobile. Wollt ihr es euch mal anschauen?«
Es war ein besonders hübsches Mobile. Kleine Küken, die aus bunten Eiern schauten, in ein flaumiges Federkleid gehüllt.
Sicher war es eine mühevolle Arbeit gewesen. Nicht für David, für Mario hatte sie so viel Zeit und Geduld aufgewendet.
»Wo soll es seinen Platz haben?«, fragte Fee.
»Über seinem Bett. Damit er nicht immer an die Decke starrt, als fürchte er, dass sie sich auftun könnte«, erwiderte Katja.
»Wie kommst du auf solche Gedanken?«, fragte Anne erschrocken.
»Ich weiß nicht. Es ist so ein Gefühl, Mutti. Er hat Angst, dass er von hier fort muss. Er hat gestern abend gesagt, dass es seinen Eltern wohl bei der Nonna gefalle. Er hat es nicht gesagt, als hätte er Sehnsucht nach ihnen. Er ist hier bei uns glücklich. «
Anne und Fee tauschten einen langen Blick. Dann entfernte sich Fee.
»Bist du auch glücklich hier, Katja?«, erkundigte sich Anne verhalten.
»Zweifelst du daran, Mutti?«, fragte Katja verwundert.
Anne legte ihren Arm um die schmalen Schultern des Mädchens.
»Ich denke so oft, dass deine Gedanken David nacheilen«, sagte sie gepresst.
»Sie sind manchmal bei ihm. Oft sogar. Vielleicht wird er eines Tages wiederkommen, aber wenn es nicht sein soll, geht die Welt auch nicht unter, Mutti. Man erlebt nur das, was einem bestimmt ist.«
»Kleine Weisheit«, bemerkte Anne zärtlich.
»David ist ein großer Künstler«, äußerte Katja gedankenvoll. »Es wäre unrecht, wenn ich egoistisch denken würde. Er bereitet so vielen Menschen Freude, und er ist noch so jung. Es wäre schön, wenn er mich nicht ganz vergessen würde. Ja, es wäre sehr schön«, flüsterte sie. »Ich habe von Isabel viel gelernt.«
»Von Isabel?«
»Sie hat Daniel auch geliebt. Wenn sie es auch nie zugegeben hat, weiß ich es doch. Und so, wie sie über ihn schreibt, ist es ein Beweis für mich. Aber sie würde sich niemals zwischen ihn und Fee drängen. Wahre Liebe beweist sich erst, wenn man auch groß im Verzichten ist.«
Sehr großmütig klang das. Anne unterdrückte ein Lächeln. Ihr konnte es nur recht sein, wenn Katja edelmütigen Verzicht als Ausflucht wählte.
Sie half ihr, das Mobile über Marios Bett zu befestigen.
»Er wird sich freuen«, sagte sie weich.
»Ich mag ihn schrecklich gern, Mutti. Könnten wir ihn nicht behalten?«, fragte Katja.
Anne wusste nicht, was sie erwidern sollte, aber da rief Fee aus dem Büro: »Ein Anruf für dich, Katja.«
»Ein Anruf?« Leichtfüßig eilte Katja ins Haus.
Als sie zurückkam, strahlten ihre Augen und ihre Wangen glühten.
»David kommt nächstes Wochenende für drei Tage! Er hat ein Konzert in Zürich!«, sagte sie atemlos. »Wir können ihn doch unterbringen, Mutti?«
»Wenn du ihm dein Zimmer einräumst«, erwiderte Anne.
»Dann schlafe ich bei Mario. Weißt du, was er gesagt hat? Es sei so gut, wenn es einen Platz in der weiten Welt gäbe, wo man Ruhe finden könne. Mutti, ich liebe die Insel!«
Hier ist unsere Heimat, dachte Anne. Auch sie hatte Ruhe gefunden nach großem Leid auf diesem Stück Erde inmitten des Sees. Ruhe und neue Hoffnung.
*
Was Dr. Cornelius und Mario in der Stadt eigentlich getan hatten, erfuhr niemand. Dass er nur gefahren war, um Mario Schuhe und eine warme Strickjacke zu kaufen, konnte doch nicht der einzige Grund sein.
Fee wusste, dass es zwecklos war, ihren Vater zu fragen, denn was er nicht sagen wollte, brachte niemand aus ihm heraus.
Er saß an diesem Abend auch noch lange mit Anne beisammen. Anscheinend wollten sie nicht gestört werden. Jedenfalls forderte Dr. Cornelius seine Tochter nicht auf, sich doch noch zu ihnen zu setzen, als sie ihnen gute Nacht wünschen wollte.
Mario hatte glückselig sein Mobile betrachtet, bis ihm die Augen zufielen. Katja hatte einen ganz dicken Kuss dafür bekommen.
Tiefster Abendfrieden lag über der Insel, als Fee sich niederlegte.
Ein leichter, linder Wind trug den Duft der letzten Rosen in ihr Zimmer. Lange blühten sie schon in diesem Jahr.
Vielleicht wird Schnee liegen, wenn wir heiraten, dachte Fee. Wie sehnte sie doch den Tag herbei, an dem sie Daniels Frau werden würde. So geduldig, wie sie immer scheinen wollte, war sie gar nicht.
Was wird er jetzt machen, ging es ihr durch den Sinn. Ob auch er an sie dachte?
Dazu hatte Daniel jetzt keine Zeit. Er war zu einem kranken Kind gerufen worden.
Es war nicht nur eine tüchtige Erkältung, wie die Mutter vermutete, sondern eine gefährliche Grippe.
Er verbrachte eine gute halbe Stunde an dem Krankenbett des Kleinen und ging mit der dringenden Ermahnung, ihn sofort zu verständigen, falls das Fieber noch steigen sollte.
Er kam erst zu seiner Nachtruhe, als Fee schon längst schlief.
Es begann bereits ein neuer Tag, ein neuer Monat. Er fuhr mit dem Finger zärtlich über Fees Bild, das auf dem Tisch neben seinem Bett stand. Dann schlief er ein.
*
Die Woche ging zu Ende und auch die nächste. Es geschah nichts Aufregendes, wenn Molly auch meinte, dass man jeden Tag einen Roman schreiben könnte von all den Patienten, die ein und aus gingen.
»Mehrere«, sagte Daniel trocken.
Der Fall Sperber war schon in Vergessenheit geraten. Petra von Schönauer war gesund aus der Klinik entlassen worden.
Es betrübte sie nicht, dass jetzt kein Platz auf der Insel war, denn sie wollte auf Thommys Gesellschaft nicht verzichten.
Daniel hatte Dr. Arndt mehrmals getroffen. Dessen Hochzeit mit Monika stand vor der Tür, und er meinte, dass es an diesem Tag auch noch eine Verlobung geben würde.
Zwei Brüder und zwei Schwestern, das war auch eine hübsche Geschichte. Daniel hatte es gern, wenn es solche Happy Ends gab.
Zufällig hatte er mal Schwester Annelie mit dem kleinen Uli getroffen, der sich schon prächtig erholt hatte. Richtig hübsch sah Annelie aus, und der schwermütige Ausdruck in ihren Augen war verschwunden.
Eines Tages würde sie eine Frau Grothe werden, daran bestand kaum ein Zweifel.
Ein Aschenputtel des Schicksals wurde von der Glücksgöttin Fortuna in reichem Maße für alles entschädigt, was ihm an Leid zugefügt worden war. Man sollte nicht immer an der ausgleichenden Gerechtigkeit zweifeln.
Auch Martin Kraft konnte nun wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Seine Frau und sein Sohn hatten nicht vergessen, sich dafür bei Daniel zu bedanken.
Dank wofür? Er hatte seine Pflicht getan. Dass auch dieses Leben gerettet worden war, stimmte ihn glücklich.
Sie alle, die einmal ihren Eid geleistet hatten, waren Werkzeuge einer höheren Macht, die allein den Anfang und das Ende eines Menschenlebens bestimmte.
Es schmerzte Dr. Norden nur, wenn Menschen achtlos mit ihrem Leben umgingen, wenn sie sich zu einer Kreatur herabwürdigten, sich dem Bösen verschrieben und verantwortungslos andere Menschenleben zu vernichten trachteten, um des Profits willen, wie Kemmler, Baku und ihre Hintermänner, die ihrer Aburteilung entgegenblickten.
Molly hatte ihren Schreibtisch aufgeräumt.
»Es wird hoffentlich diesmal ein Wochenende ohne Aufregung für Sie, Chef«, sagte sie.
»Ohne Sturm und Regen, hoffe ich. Soll ich Ihren Mann grüßen, Molly?«
»Nicht nötig. Er besucht uns. Es ist immer noch mein geschiedener Mann, wenn ich das bemerken darf.«
»Wie lange noch?«
Sie sah ihn verlegen an.
»Soll ich es denn noch mal mit ihm probieren?«, fragte sie stockend.
»Ich denke, dass er das verdient, wenngleich wir auf der Insel schwer einen Ersatz für ihn finden werden.«
»Ach was! Es wird sich schon wieder eine gestrandete Existenz finden, die dort vor Anker geht. Peter hängt halt so an seinem Vater.«
»Und Sie doch auch immer noch, Molly. Vor mir brauchen Sie es doch nicht zu leugnen. Es war eine heilsame Lehre für ihn, dass Sie ihm die Zähne gezeigt haben.«
»Und Angst, dass ich meine Stellung kündige, haben Sie wohl gar nicht?«, fragte Molly anzüglich.
»Das werden Sie doch nicht tun!«, meinte er erschrocken.
»Nein. Da würde mir was fehlen. Lieber kann Hans den Haushalt versorgen. Aber vorerst bleibt es noch bei Wochenendbesuchen. «
»Dann bis Montag«, sagte er. Seine Gedanken waren schon wieder bei Fee.
*
Diesmal hatte er Lenchen nicht fragen müssen, ob sie mitkommen wolle. Sie hatte ganz von selbst diesen Wunsch geäußert. Eine Reisetasche hatte sie gepackt.
»Willst du draußen bleiben?«, fragte er staunend.
»Ich muss doch Mario etwas mitbringen«, erklärte Lenchen.
»Gleich einen ganzen Zentner?«
»Er braucht was zum Anziehen und ein paar Spielsachen. So viel ist es nicht. Jetzt kommt bald der Winter. Da muss er warm angezogen sein. Ich werde doch was für den Kleinen tun dürfen!« Ganz aggressiv sagte sie es.
»Ich habe ja nichts dagegen, Lenchen«, meinte Daniel begütigend.
Nun konnten sie also fahren. Lenchen sagte nicht ein Wort gegen die Autos, die sie sonst als stinkende Ungeheur bezeichnete.
Sie meckerte auch nicht, wenn er das Tempo beschleunigte. Ja, sie konnte gar nicht schnell genug zur Insel kommen.
Ein glückliches Leuchten ging über ihr runzliges Gesicht, als Mario ihr entgegenstürmte.
»Nonna Lenchen!«, rief er mit einem glucksenden Lachen.
»Hast mich nicht vergessen, mein Jungchen?«, fragte sie.
»Nein, nicht vergessen gutes Nonna Lenchen«, erwiderte Mario.
Sie konnte ihn für sich allein haben. Daniel hielt seine Fee in den Armen.
»Schon wieder eine Ewigkeit her, dass ich dich küssen konnte«, bemerkte er zärtlich.
»Bitte, nicht hier! Wir haben Zuschauer!«, flüsterte sie.
Sie holten es nach, allein mit sich, ihrer Liebe und Zärtlichkeit.
»Jetzt kann sich Mario schon mit Lenchen unterhalten«, sagte Fee. »Es ist schön, dass sie mal mitgekommen ist.«
»Sie musste sich doch überzeugen, dass es Mario auch an nichts fehlt«, äußerte Daniel lachend.
»Er würde uns fehlen.«
Er sah sie nachdenklich an. »Uns?«, fragte er.
»Paps, Anne, Katja, mir natürlich auch. Herr Moeller und Lissy hätten ihn am liebsten mitgenommen.«
Daniel versank in Schweigen. Erwartete Fee jetzt eine Erklärung von ihm? Die Erklärung, dass sie ihn behalten wollten? Fee lenkte ab.
»Morgen kommt David. Was sagst du dazu?«
»Dass er auch sehr anhänglich ist. Gibt es hier einen geheimen Zauber, Fee?«
»Vielleicht.«
»Nun ja, wo eine Fee ist, muss es ja einen Zauber geben.«
Er küsste sie wieder. Das fand er angenehmer, als über gewisse Probleme nachzudenken.
*
Doch die Probleme sollten sich bald in Wohlgefallen auflösen.
Mario hatte all die schönen Sachen, die Lenchen ihm mitgebracht hatte, hinreichend bewundert. Sie hatte sich zu ihm ans Bett gesetzt und erzählte ihm Geschichten, die gleichen, die sie vor Jahren einmal Daniel erzählt hatte, als er ein Junge gewesen war wie Mario.
Im Wohnzimmer hatten sich Johannes Cornelius, Anne, Katja, Dr. Schoeller, Daniel und Fee eingefunden.
»Sekt«, rief Fee staunend, »und noch dazu der beste, den der Keller zu bieten hat! Paps, du wirst übermütig!«
»Es besteht ein Anlass, der gewürdigt werden soll«, sagte Johannes Cornelius, und seine Stimme hatte einen feierlichen Klang. »Ich habe euch etwas mitzuteilen.«
»Hast du einen Orden bekommen, Johannes?«, fragte Daniel.
»Was sollte ich damit anfangen? Etwas viel Schöneres habe ich bekommen. Anne und ich werden heiraten.«
»Habe ich es mir doch gedacht«, raunte Fee Daniel zu.
»Wir hätten noch gewartet«, fuhr Johannes Cornelius fort, »aber gewisse Umstände machen unseren Entschluss dringlich. Wir haben uns entschlossen, Mario zu adoptieren.«
Daniel war sprachlos. Fee flüsterte: »Paps!« Und dann fiel sie ihm um den Hals. Katja umarmte ihre Mutter mit Tränen in den Augen.
»Hat jemand etwas dagegen?«, fragte Johannes Cornelius. »Meint ihr vielleicht, dass ich zu alt wäre?«
»Gott bewahre, Johannes!«, sagte Daniel und drückte seinem Freund und zukünftigen Schwiegervater kräftig die Hand. Dann ergriff er Annes Rechte und neigte sich zum Kuss darüber.
»Was sagst du, Fee?«, fragte Anne.
»Ich wünsche euch viel, viel Glück.«
»Und was meint Katja?«, fragte Johannes.
»Es ist einfach schön«, flüsterte das Mädchen.
»Dann wollen wir mal unseren Sekt nicht warm werden lassen.« In Johannes’ Stimme schwang Rührung.
»Erst müssen wir Lenchen holen«, sagte Fee.
Und das gute Lenchen schluchzte vor Freude. Sie trank sogar einen Schluck Sekt mit, obgleich sie doch das kribbelige Zeug gar nicht mochte.
Ganz leise schlichen sich Fee und Daniel später in Marios Zimmer.
Ein seliges Lächeln lag auf seinem kleinen Gesicht, und in seinem Arm lag ein wuscheliger Teddybär.
Ein Kind hatte eine Heimat gefunden. Geliebt und behütet würde es aufwachsen.
»Hoffentlich gibt es keine Schwierigkeiten mit der Adoption«, bemerkte Fee, als sie mit Daniel engumschlungen um die Insel ging.
»Ich habe das Wohlwollen eines glänzenden Anwalts«, erwiderte er. »Er wird mit den größten Schwierigkeiten fertig.«
»Freust du dich auch so, Daniel?«, fragte Fee flüsternd.
»Sehr, mein Liebstes. Ich brauche keine Gewissensbisse mehr zu haben, wenn ich dich weghole von der Insel. Allerdings hätte ich mir nicht träumen lassen, dass mein Schwiegervater noch vor uns Hochzeit feiern würde.«
»Sie sind ja schon ein paar Jährchen älter als wir. Ich bin froh für Paps, dass er eine Frau wie Anne gefunden hat.«
»Und einen kleinen Bruder hast du nun auch noch bekommen.«
»Der dir sein Leben zu verdanken hat. Das werde ich nie vergessen, Daniel.«
Sie waren nicht die einzigen Glücklichen auf der Insel. Johannes Cornelius hatte seine Arme um Anne gelegt.
»Wir werden dem Leben noch die schönen Stunden abgewinnen, Anne«, sagte er leise. »Ich hätte sie auch mit dir teilen wollen, wenn es keinen Mario gäbe.«
Sie lehnte sich an ihn. Sie wollte so gern alles mit ihm teilen, der ihr so behutsam und verständnisvoll die Tür zu einem neuen Leben geöffnet hatte.
Katja dachte an David Delorme. Morgen würde er kommen. Er würde auch wieder in die Welt hinausgehen, die Menschen mit seiner Musik beglücken, die jetzt gedämpft durch ihr Zimmer tönte. So heiß hatte sie einmal gewünscht, dass er sie mitnehmen möge. Vielleicht würde er das eines Tages auch tun. Er hatte es ihr oft geschrieben.
Nicht so bald, dachte Katja. Sie hatte Wurzeln geschlagen hier auf der Insel. Es wäre schön, sich so geborgen fühlen zu können.
Lenchen stand am offenen Fenster. Sie hatte die Hände gefaltet und blickte zum Himmel empor, an dem unzählige Sterne funkelten. Auch sie war glücklich.
– E N D E –