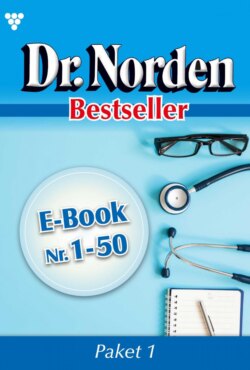Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Insel der Hoffnung«, sagte Dr. Johannes Cornelius zu seiner Begleiterin, »nun geht Friedrich Nordens Traum seiner Erfüllung entgegen.«
»Ein recht kostspieliger Traum«, sagte Anne Fischer gedankenvoll. Mit ihrer schmalen Hand strich sie sich eine aschblonde Haarsträhne aus der hohen Stirn. Sie war Mitte vierzig und noch immer eine anmutige Frau. Ihre Stimme war weich und melodisch.
»Friedrich Norden dachte nur an die Genesungsuchenden«, sagte Dr. Cornelius.
Anne Fischer errötete leicht. »Ich wollte keine Kritik üben«, sagte sie entschuldigend, »ganz im Gegenteil. Ich finde diese Anlage wundervoll. Man denkt dabei nicht an Krankenhaus oder Sanatorium. Eine Oase des Friedens ist diese Insel der Hoffnung.«
»Den Namen hat ihr auch mein Freund Friedrich gegeben«, erklärte Dr. Cornelius. »Wollen wir hoffen, daß er zu einem Symbol wird, und daß hier viele Leidende gesunden, wie es sein Wunsch war. Es ist ein Jammer, daß er selbst es nicht mehr erleben konnte.«
»Und sein Sohn hat keine Neigung, hier mitzuarbeiten?« fragte Anne Fischer. »Das ist mir nicht ganz begreiflich.«
»Daniel will seine Praxis in München noch behalten«, erklärte Dr. Cornelius. »Wir werden dennoch Hand in Hand arbeiten.«
»Und Ihre Tochter, Johannes?«
»Felicitas wird mich unterstützen. Einen Arzt habe ich auch schon gefunden, der viel Idealismus mitbringt, den wir hier brauchen werden.«
Anne Fischer warf ihm einen gedankenvollen Blick zu. »Könnten Sie vielleicht auch mich brauchen, Johannes? In Büroarbeiten bin ich perfekt. Und Idealismus würde ich auch mitbringen. Ich brauche jetzt so nötig eine Lebensaufgabe und –«, sie unterbrach sich und errötete leicht.
»Und Katja könnten wir auch hierherholen«, vollendete Dr. Cornelius verständnisvoll ihren angefangenen Satz. »Daran dachten Sie doch, Anne.«
»Betrachten Sie mich bitte nicht als aufdringlich«, flüsterte sie.
»Aber ganz im Gegenteil. Ich habe auch schon daran gedacht. Ich wollte Sie nicht so direkt fragen, Anne. Wenn alle Spezialisten für Katja nichts tun können, könnten wir hier gemeinsam versuchen, in ihr wieder neuen Lebenswillen zu wecken.«
»Danke, Johannes.« Ihre Augen waren tränenfeucht. »Es war alles zu schrecklich.«
Jetzt wollte Dr. Cornelius nicht über die harten Schicksalsschläge sprechen, die Anne Fischer hatte hinnehmen müssen. Man sollte mit Worten nicht Wunden aufreißen die noch nicht vernarbt waren.
»Dann überlasse ich Ihnen die Verwaltungsarbeiten«, sagte er aufmunternd, »und damit können Sie schon bald beginnen. Am Wochenende werden wir die Insel der Hoffnung offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Dann werden Sie Daniel Norden kennenlernen.«
»Und wann kommen die ersten Patienten?«
»Später, so nach und nach«, erwiderte Dr. Cornelius. »Wir wollen alles ganz langsam anlaufen lassen. Daniel will nicht, daß die Reklametrommel gerührt wird. Neugierige wollen wir nicht heranlocken, auch nicht nur solche mit dicken Bankkonten. Die Insel der Hoffnung soll vor allem jenen offenstehen, die sich in der lauten Welt nicht mehr zurechtfinden und ihren inneren Frieden verloren haben.«
»Wenn sie diesen hier nicht finden, wo sonst?« bemerkte Anne Fischer gedankenverloren. »Sie haben sich ein großes Ziel gesetzt, Johannes.«
»Das ist mir von Friedrich und Daniel Norden gesetzt worden«, sagte der Arzt.
*
Dr. Daniel Norden hatte wieder einmal einen turbulenten Vormittag in seiner Praxis fast hinter sich gebracht.
»Wen haben wir jetzt noch, Molly?« fragte er seine tüchtige Sprechstundenhilfe.
Helga Moll ließ sich von ihm gern Molly nennen, obgleich sie eher mager war. Sie hatte sehr viel übrig für ihren jungen Doktor, ohne daß man ihr mißverständliche Absichten nachsagen konnte.
»Frau Seidel wartet noch«, erwiderte sie. »So was liebes und bescheidenes wie dieses alte Mütterchen gibt es nicht noch einmal.«
Doch Molly wußte, daß Dr. Norden auch mit der alten, bescheidenen Frau Seidel richtig umzugehen verstand.
»Ja, wen haben wir denn da?« begrüßte er die alte Frau herzlich. Sie war vor drei Jahren seine allererste Patientin gewesen und immer noch von einer rührenden Anhänglichkeit.
Er umfaßte die schmalen Schultern der alten Frau. »Wie fesch sie wieder ausschaut, unsere gute Frau Seidel«, sagte er lächelnd.
Ein Leuchten ging über das verhutzelte Gesicht. Auf schneeweißem Haar thronte ein Kapotthütchen, das gut und gerne ein halbes Jahrhundert miterlebt haben mochte, aber kein einziges Stäubchen aufwies.
Mit liebevollem, mütterlichem Blick hingen die immer noch lebhaften Augen hinter der Nickelbrille an dem markanten Gesicht des jungen Arztes. Er wurde immer ein bißchen verlegen, wenn sie ihn so anschaute.
»Na, wo fehlt es denn heute?« fragte er. »Wo tut es weh?«
Er wußte, daß sie sich manchmal mit schrecklichen Schmerzen plagte, für die er ihr nur vorübergehend Linderung verschaffen konnte, aber sie war unglaublich tapfer, und er bewunderte die Zähigkeit dieser fast achtzigjährigen Frau.
»Gar nichts tut mir weh, wenn ich Sie anschaue, Herr Doktor«, sagte sie verschmitzt. »Das Herz hüpft mir vor Freude. Ich darf es wohl sagen. Mir wird man doch nicht mehr nachreden können, daß ich es auf den Dr. Norden abgesehen habe.«
»Weiß man es?« ging er auf ihren Ton mit einem Schmunzeln ein. »Aber Sie kommen doch nicht nur her, um mich anzuschauen und festzustellen, wie ich mich so herausmoppele?«
»Na ja, das Wetter macht mir schon zu schaffen, und mit dem Laufen wird es auch immer schlechter. Aber wer weiß, wie lange ich überhaupt noch gehen kann, und Sie haben doch mehr zu tun, als zu mir zu kommen, um mir die Spritzen zu verpassen. Und ich schaue mir auch gern mal die Leute an, die in Ihrem Wartezimmer sitzen.«
»Sind Sie zufrieden mit meinen Patienten, Frau Seidel?« fragte Dr. Norden.
»Staunen muß ich immer wieder, daß Sie so gar keine Ausnahmen machen wie die anderen Ärzte. Und nie sind Sie grantig. Sie sind sogar nett zu einem alten Mutterl, von dem niemand mehr was wissen will, das niemand mehr anschaut. Daß mir die Medikamente nicht mehr helfen können, weiß ich doch selbst, wenn Sie sich auch noch so viel Mühe geben. Wenn man so alt geworden ist, ist jeder Tag ein Geschenk, und wenn Sie so nett zu mir sind, geht es gleich wieder viel besser.«
In diesem Augenblick kam Dr. Norden blitzartig ein Gedanke.
»Wissen Sie was, Frau Seidel, es gibt auch andere nette Menschen. Sie sollen solche kennenlernen, wenn Sie sich zutrauen, eine kleine Reise zu machen.«
»Eine Reise?« fragte sie staunend. »Dazu habe ich doch gar kein Geld.«
»Es kostet Sie auch nichts. Ich werde Sie mitnehmen zur Insel der Hoffnung, wenn ich am Samstag zur Eröffnung fahre.«
»Zur Insel der Hoffnung?« fragte sie staunend.
»So soll unser Sanatorium heißen. Es sind nur zwei Stunden Fahrt. Willigen Sie ein?«
»Mich wollen Sie dorthin mitnehmen, Herr Doktor?« fragte sie mit Tränen in den Augen. »Ausgerechnet mich?«
»Sie sind mein Talisman«, sagte Daniel lächelnd. »Sie waren hier meine erste Patientin und sollen es dort auch sein. Es wird uns Glück bringen. Und so wäre es ganz im Sinne meines Vaters.«
Ja, dachte er für sich weiter. So hätte Vater es gewollt. Einem armen Menschen, der immer auf der Schattenseite des Lebens gestanden hatte, eine Freude zu bereiten.
»Das kann ich gar nicht glauben«, murmelte Frau Seidel mit erstickter Stimme.
»Ich hole Sie ab«, sagte er. »Sie werden ganz bequem sitzen. Molly kommt auch mit. Soll sie Ihnen beim Kofferpacken helfen?«
»Das kann ich schon allein«, stammelte Frau Seidel. »Ich darf wirklich mitfahren?« Immer noch schaute sie ungläubig drein.
»Abgemacht«, sagte Dr. Norden aufmunternd. Molly wischte sich ganz geschwind und unauffällig ein paar Tränen aus den Augen. Er hat genau solch ein gutes Herz wie sein Vater, dachte sie.
Molly mußte es wissen. Als junges Mädchen war sie Sprechstundenhilfe bei Dr. Friedrich Norden gewesen. Sie hatte diesen wunderbaren Arzt und Menschenfreund in all seiner Seelengröße kennengelernt.
Sie hatte auch Daniel schon als Jungen gekannt, der nur ein Lebensziel hatte: Arzt zu werden, wie sein Vater.
Molly hieß damals noch Helga Schneider. Sie hatte geheiratet und war Mutter von drei Kindern geworden, aber ihre Ehe mit Heinz Moll war nicht von Bestand gewesen. Wieder mußte sie Geld verdienen, weil ihr Mann seine Familie nicht ernähren konnte. Wieder kam sie zu Dr. Friedrich Norden und mußte es nun miterleben, daß auch diesem gütigen Mann Schicksalsschläge nicht erspart blieben. Seine von ihm so sehr geliebte Frau litt an einer unheilbaren Krankheit. Für ihn, den Arzt, der immer nur helfen und heilen wollte, war es entsetzlich, dem liebsten Menschen, den er besaß, nicht helfen zu können.
Nach dem Tode seiner Frau zog er sich auf die kleine Roseninsel zurück, in das alte Bauernhaus, das schon seine Großeltern bewohnt hatten. Auf der Insel im Rosensee kam Dr. Friedrich Norden die Idee, hier ein Sanatorium zu erbauen, in dem Kranke und am Leben Verzweifelte Genesung finden könnten, jene, die die Hoffnung verloren hatten und solche, die unglücklich waren.
Insel der Hoffnung, dieser Begriff hatte Dr. Friedrich Norden fasziniert.
Alles durchdachte er in seiner Einsamkeit, und er plante und plante, wobei sein Herz jedoch müder und müder wurde.
Der junge Daniel Norden, der nun seine eigene Praxis eröffnet hatte, stand den Plänen seines Vaters anfangs skeptisch gegenüber. Auch das wußte Helga Moll, denn jetzt war sie seine Sprechstundenhilfe, geschieden von ihrem Mann, mußte sie allein für ihre Kinder sorgen.
Indessen hatte Friedrich Norden in seinem langjährigen Freund, Dr. Johannes Cornelius, einen Partner gefunden, der mit der gleichen Intensität und Leidenschaft an die Verwirklichung dieser Idee ging. Und als Friedrich Norden starb, war auch Daniel bereit, das Vermächtnis seines Vaters zu erfüllen.
Nun kam der Tag heran. Die Pforten zur Insel der Hoffnung sollten sich öffnen. Für sich aber hatte Daniel Norden eine eigene Entscheidung getroffen.
Er wollte seine Praxis behalten und die Leitung des Sanatoriums Dr. Cornelius überlassen. Daniel hatte seine Gründe dafür, denn er dachte realistischer als sein Vater. Der Unterhalt eines Sanatoriums verschlang viel Geld. Wollte man die Idee seines Vaters verwirklichen, auch mittellosen Patienten eine Kur zu ermöglichen, brauchte man andere, denen es nicht schwerfiel, ihre Rechnungen zu bezahlen. Er hatte solche Patienten. Er hatte gute Verbindungen. Er galt sogar als Modearzt. Dr. Daniel Norden wollte vor allem nicht, daß Dr. Cornelius seine Freundschaft und Loyalität mit einem Defizit büßen mußte.
Darüber verlor er kein Wort. Er schluckte es sogar, daß Felicitas Cornelius, die bildhübsche Tochter des väterlichen Freundes, ihn verächtlich einen Playboy schalt, der nicht auf das Großstadtleben verzichten wolle.
»Wir wissen, daß es Vaters Vermächtnis ist«, hatte er zu Dr. Cornelius gesagt, als sie ihre Vereinbarungen trafen. »Ich will mein Bestes tun, daß alles so wird, wie er es sich vorstellte, aber es soll nie ein Wort darüber fallen, was ich dazu beitrage.«
Mit einem Handschlag hatten sie dieses Übereinkommen besiegelt.
Wird alles so werden, wie Vater es sich vorgestellt hat? Ich will mein Bestes tun, Vater, sagte er leise vor sich hin. Den Anfang habe ich gemacht, indem ich dieser armen alten Frau noch ein wenig Freude in den Lebensabend bringe.
Es tat ihm weh, daß sein Vater die Verwirklichung seines Wunschtraumes nicht mehr erleben konnte. Er dachte auch an seine Mutter, der alle ärztliche Kunst keine Hilfe bringen konnte. Er dachte aber auch an die vielen anderen, denen noch zu helfen war.
Jetzt gönnte er sich ein paar Minuten der Besinnung und ließ seinen Blick auf der Fotografie seines Vaters ruhen, die auf seinem Schreibtisch stand. Dann kam Molly.
»Sie haben Frau Seidel eine große Freude bereitet«, sagte sie. »Sie haben ein gutes Herz. Sie sollten es nicht immer verleugnen.«
»Nun stimmen Sie nur nicht in Mutter Seidels Lobgesänge ein, Molly. Sie hat einen Narren an mir gefressen und ich mag sie auch. Es war doch eine gute Idee? Sind Ihre Kinder gut untergebracht über das Wochenende?«
»Meine Mutter kommt«, erwiderte Helga Moll. »Jedenfalls ist sie energischer als ich.«
»Und Ihnen tut es gut, wenn Sie mal Tapetenwechsel haben«, sagte Dr. Norden.
Helga Moll wollte ihm jetzt nicht mit ihren Sorgen kommen, denn frei von solchen würde sie an diesem Wochenende gewiß nicht sein, obgleich sie ihre drei Kinder in der Obhut ihrer resoluten Mutter zurücklassen konnte.
Sabine, die Älteste, war achtzehn und hatte seit einem Jahr einen festen Freund. Er war ein netter Junge, aber er ging noch zur Schule, und für Helga Moll, die geschiedene Frau, die allein für ihre Kinder sorgen mußte, gab es da schwere Bedenken. Dazu gesellten sich andere, doch Dr. Norden entriß sie diesen Gedankengängen.
»Na, Molly, dann wollen wir mal die Bude zumachen«, sagte er. »Ich gehe heute abend ins Konzert. Vorher muß ich noch ein paar Krankenbesuche machen. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen?«
»Iwo, mit der S-Bahn ist es viel bequemer«, erwiderte sie. »Lassen Sie sich von Frau Brehmer nicht zu lange aufhalten, sonst verpassen Sie die Hälfte vom Konzert.«
Sie sagte es mit einem hintergründigen Lächeln, und er erwiderte es mit einem spöttischen.
»Was uns nicht umbringt, macht uns stärker«, sagte er heiter. Dann winkte er ihr zu und verschwand.
Ein Wunder ist es ja nicht, daß die Frauen hinter ihm her sind, dachte Helga Moll.
Marion Brehmer hegte allerdings ähnliche Gedanken. Sie litt nicht umsonst in letzter Zeit so häufig an Magenbeschwerden. Sie hatte eine fast erwachsene Tochter. Allerdings war Kirsten selbst für einen so attraktiven Mann wie Dr. Norden nicht zu begeistern und ganz so selbstlos war Marion Brehmer als Mutter auch nicht.
Sie hatte es zwar ganz geschickt zu verbergen vermocht, aber sie hätte durchaus nichts dagegen gehabt, mit Dr. Norden einen heftigen Flirt anzufangen, wenn sie die geringste Resonanz gespürt hätte. Die jedoch blieb aus.
Marion Brehmer war mit ihren achtunddreißig Jahren noch immer eine recht verführerische Frau. Eine gute Kosmetikerin und ein sehr gekonntes Make-up machten sie sogar noch um einige Jahre jünger, wenn man ihr Geburtsdatum nicht kannte. Kirsten dagegen war alles andere als reizvoll. Sie war ein supermodernes Mädchen, und sie fand es »in«, so lässig wie nur möglich zu wirken.
In verwaschenen Jeans und viel zu weitem Pullover lehnte sie an der Tür zum Schlafzimmer ihrer schönen Mutter.
»Ich würde an deiner Stelle ein Bein herausstrecken, Mama«, sagte sie anzüglich, »und dann die Bettdecke noch etwas weiter herabziehen, damit dein Dr. Norden auch gleich deinen Busen sieht. Und dann –«
»Sei nicht so unverschämt«, fiel ihr Marion heftig ins Wort. »Wenn du nur ein wenig mehr Wert auf dein Äußeres legen würdest, müßte ich nicht –«
»Müßtest du nicht in ständiger Sorge leben, daß ich eine alte Jungfer werde«, wurde sie jetzt von ihrer Tochter unterbrochen. »Aber sei unbesorgt, das kann ich gar nicht mehr werden. Wenn du jedoch nicht willst, daß du bald Großmutter wirst, könntest du mir mal von deinem Leib- und Magenarzt Antibabypillen für mich verschreiben lassen.«
»Kirsten«, schrie Marion Brehmer auf, »das ist unerhört. Wenn das dein Vater wüßte.«
»Sag es ihm doch«, sagte Kirsten frech. »Ich sehe ihn ja kaum.«
Die Debatte wurde unterbrochen. Es hatte geläutet. Kirsten ging zur Tür, da das Hausmädchen Ausgang hatte.
»Na, da ist ja der Heißersehnte«, begrüßte sie Dr. Norden in frivolem Ton und so laut, daß auch ihre Mutter sie hören konnte. »Mama leidet schon Höllenqualen.«
Dr. Daniel Norden kannte Kirsten Brehmer. Er nahm ihren Ton nicht tragisch. Er war noch nicht so weit von dieser Generation entfernt, daß er sie in Grund und Boden verdammt hätte. Er wußte nur zu gut, daß die Teenager ihre Aggressionen auf verschiedene Weise abreagierten.
Durch einen Tränenschleier hindurch blickte Marion Brehmer ihn an. Die Tränen waren sogar echt. Kirsten brachte sie zur Verzweiflung. Sie hätte so
gern eine Tochter gehabt, mit der sie in der Gesellschaft Furore machen könnte.
»Ich komme mit diesem Kind einfach nicht mehr zurecht«, stöhnte sie. »Da muß man ja magenkrank werden.«
»Kirsten ist kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen, Frau Brehmer«, sagte Daniel Norden. »Sie ist einfach unreif, weil noch nie Anforderungen an sie gestellt wurden. Nehmen Sie es nicht gar so tragisch. Sprechen Sie lieber mal im gleichen Ton mit ihr.«
»Im gleichen Ton?« fragte Marion empört und ganz vergessend, daß sie ihre dekorative Haltung aufgab. »Jetzt verlangt sie schon, daß ich mir Antibabypillen verschreiben lasse. Für sie natürlich, nicht für mich«, fügte sie pikiert hinzu.
»Dann verschreiben wir ihr eben welche«, erklärte er. »Allerdings müßte sie sich dazu lieber von einem Gynäkologen untersuchen lassen, damit es nicht die falschen sind.«
»So einfach sagen Sie das?« stöhnte Marion Brehmer.
»Kirsten ist doch achtzehn, soviel ich weiß. Anbinden können Sie sie nicht mehr und vorschreiben läßt sie sich sowieso nichts. Antibabypillen sind noch das kleinere Übel. Sind damit Ihre Magenschmerzen wenigstens teilweise behoben?«
Er hatte seine eigene Art, mit seinen Patientinnen umzugehen. Frau Brehmer kannte er jetzt schon ziemlich genau. Er mokierte sich nicht darüber, daß sie so jugendlich wie nur möglich wirken wollte. Er mochte das sogar, denn ihm waren gepflegte Frauen lieber als solche, die sich gehenließen.
»Wenn ich mit meinem Mann doch sprechen könnte, wie mit Ihnen«, sagte Marion Brehmer seufzend.
»Versuchen Sie es mal. Vielleicht ist es ihm lieber, als wenn Sie ihm etwas vorjammern. Nehmen Sie sich nicht alles so zu Herzen«, fuhr er dann besänftigend fort, denn er wußte genau, wann der Zeitpunkt kam, daß er den verständnisvollen Arzt herauskehren mußte. »Sonst bekommen Sie wirklich noch Magengeschwüre, und damit kann man sich verflixt herumplagen. Das gibt auch Falten, und das wollen wir doch nicht.«
Sein Charme war faszinierend. Man konnte ihm nicht widerstehen. Allerdings wußte er auch in solchen Augenblicken Distanz zu wahren.
»Sie meinen also, daß man Kirsten wirklich Antibabypillen geben soll?« fragte Marion Brehmer.
»Vorbeugen ist besser, als ein Fiasko«, erklärte er. »Ich werde nachher selbst mal mit ihr sprechen.«
Nebenbei hatte er ihren Puls gefühlt und den Blutdruck gemessen. »Temperatur haben wir auch nicht«, meinte er lächelnd. »Ich bin drei Tage abwesend. Falls etwas sein sollte, müßten Sie mit Dr. Feldmann vorliebnehmen.«
»Fahren Sie weg? Ach ja, ich habe gelesen, daß das Sanatorium eröffnet wird. Insel der Hoffnung, das klingt vielversprechend. Vielleicht kann ich meinen Mann auch mal zu einer Kur bewegen.«
»Das wäre gar nicht schlecht«, sagte Dr. Norden freundlich.
Dieser Besuch war harmloser verlaufen, als er erwartet hatte, und er hatte nicht lange gedauert. Heute schien Marion Brehmer tatsächlich mehr mit ihrer Tochter beschäftigt zu sein, als Eindruck auf ihn machen zu wollen.
Draußen flegelte sich Kirsten in einem Sessel, die Füße auf den kostbaren Marmortisch gelegt.
»Eigentlich sind Sie in Ordnung«, sagte sie lässig. »Verraten Sie mir mal, wie Sie mit allen Versuchungen fertig werden?«
»Mit welchen Versuchungen?« fragte er gleichmütig. »Ich bin Arzt. Die Anatomie des weiblichen Körpers birgt keine Rätsel für mich.«
»Haha«, machte sie.
»Und auf die Verpackung kommt es auch nicht an«, fuhr er gleichmütig fort. »Ihre Mutter sagte mir, daß Sie Antibabypillen haben wollen. Gehen Sie doch in den nächsten Tagen mal zu Dr. Kent. Wenn Sie wollen, melde ich Sie an.«
Kirsten wurde knallrot. Mit einem Ruck nahm sie die Beine vom Tisch.
»Können Sie mir denn keine verschreiben?« fragte sie mit sehr gekünstelter Forschheit.
»Das überlasse ich lieber dem Facharzt. Er kann besser entscheiden, welches Medikament angebracht ist. Da gibt es nämlich auch verschiedene Sorten, und jeder Körper reagiert verschieden.«
»Ich mag mich aber nicht ausziehen«, stieß Kirsten hervor.
Dr. Norden lächelte. »Dann brauchen Sie ja auch keine Antibabypillen«, sagte er gelassen. »Wiederschauen, Fräulein Brehmer.«
*
Dr. Norden kam eben noch rechtzeitig zum Konzert. Die Türen wurden gerade geschlossen. Aber er hatte ohnehin seinen Platz ganz am Rande, weil er meist zu spät kam und manchmal auch mitten aus einem Konzert herausgeholt wurde. Aber wenn es nur irgendwie möglich zu machen war, ließ er sich keines mit einem guten Solisten entgehen.
Der Saal verdunkelte sich schon. Eine schmale gepflegte Hand legte sich auf Daniels Arm, als er sich niederließ.
»Hast es ja gerade wieder mal geschafft, Dan«, raunte ihm eine weibliche Stimme zu.
Er nahm die Hand und drückte sie flüchtig. Er hatte gewußt, daß Isabel Guntram neben ihm sitzen würde. Das war schon seit mehr als sieben Monaten so.
Er sah nur ganz rasch zu ihr hinüber.
Sie sah apart aus wie immer. Er kannte dieses herbe, eigenwillige Gesicht ganz genau. Isabel war Journalistin, ganz eine Frau dieser Zeit, ohne Sentimentalität mitten im Leben stehend, emanzipiert und nicht darauf bedacht, die Bewunderung der Männer zu erregen. Sie hatten sich im Tennisklub kennengelernt und auf Anhieb gemocht. Intime Beziehungen gab es zwischen ihnen nicht.
Jetzt ließ Daniel sich von den Tönen einfangen und die Umwelt mitsamt Isabel war für ihn versunken. Die Liebe zur Musik hatte er von seinem Vater mitbekommen. Wenn ihm Zeit blieb, setzte er sich auch gern selbst an den Flügel, der in seiner modernen Penthousewohnung einen besonderen Platz einnahm.
Der Solist dieses Abends, der junge Pianist David Delorme, übertraf alle seine Erwartungen. Hingerissen lauschte ihm Daniel, nicht ahnend, wie bald er ihm in einer ganz anderen Situation begegnen sollte.
Die Pause kam, und eigentlich wollte Daniel jetzt gar nichts anderes mehr hören. Er war noch immer völlig in der Faszination dieses jungen Genies gefangen.
»Er ist wirklich phantastisch«, sagte Isabel. »Hoffentlich wird man ihn nicht bald zu Tode managen.«
»Ich möchte gehen«, sagte Daniel rauh.
»Habe ich deine empfindsame Seele verletzt, Dan?« fragte Isabel.
»Den Rest kann ich mir schenken. Das Orchester habe ich schon besser gehört. Gehen wir noch ein Glas Wein trinken?«
»Unter Menschen?« fragte sie mit leichtem Spott.
»Wir können auch zu mir fahren, wenn du willst.«
Sie war überrascht. Diesen Vorschlag hatte er noch nie gemacht, und sie war schon lange neugierig, wie er lebte.
»Wenn nicht eine andere bereits sehnsüchtig wartet«, sagte sie burschikos.
»Sei doch nicht albern. Wer sollte denn warten? Ich habe keinen Harem.«
Nicht um die Welt hätte Isabel es zugegeben, aber sie hatte sich oftmals Gedanken gemacht, mit wem er seine freien Abende verbringen mochte. Gleichgültig war Daniel ihr nämlich nicht, aber sie war nicht die Frau, die sich einem Mann anbot. Sie war viel zu selbstbewußt und zu klug, um sich eine Freundschaft zu verscherzen wegen einer augenblicklichen Stimmung.
Sie fuhren in seinem Wagen. Sie fuhr bei Nacht grundsätzlich nicht, weil sie nachtblind war.
Niemand begegnete ihnen, als sie das moderne Hochhaus betraten.
»Ein Riesenhaus und keine Menschenseele«, bemerkte Isabel, als sie mit dem Lift aufwärts fuhren.
»Ärzte und Büros«, erklärte Daniel in seiner knappen Art. So leger er sich mit seinen Patienten unterhielt, so lakonisch war er im persönlichen Gespräch.
Doch seine Wohnung war hinreißend gemütlich, wie Isabel schnell feststellen konnte.
»Du hast Geschmack«, stellte sie fest.
Daniel lächelte. »Hast du daran gezweifelt?« fragte er.
»Nein, aber ich habe dich in eine kühlere Umgebung hineingedacht.«
»Die habe ich in der Praxis«, lachte er.
Sein Lachen war bezwingend, mitreißend. Isabel hätte auf der Stelle schwach werden können. Sie mußte sich arg zusammennehmen, um ihm nicht um den Hals zu fallen und diesen lachenden Mund mit den schneeweißen gleichmäßigen Zähnen zu küssen.
»Machen wir uns ein bißchen was zu essen«, sagte Daniel. »Ich hatte vorhin keine Zeit mehr.«
Die Küche war supermodern und blitzblank.
»Du scheinst eine Perle zu haben«, stellte Isabel fest. »So ordentlich sieht es bei mir nicht aus.«
»Ich habe mehrere Perlen«, sagte Daniel. »Lenchen, die Papa schon versorgt hat, für die Wohnung, und Molly für die Praxis. Lenchen wohnt auf der anderen Seite.«
Er deutete über den Gang.
»Kann sie uns hören?«
»Nein, sie ist schwerhörig. Du hast doch nicht etwa Komplexe?«
»Vielleicht ist sie eifersüchtig«, scherzte Isabel.
»Da magst du nicht so unrecht haben. Sie wacht wie ein Zerberus über meine Unschuld«, spottete er. »Mosel- oder Rheinwein?«
»Das überlasse ich dir. Kann ich was herrichten?«
»Mach ein paar Toasts«, sagte er. »Schinken, Käse, Ananas. Wenn du was anderes möchtest, bediene dich.«
»Ich bin eine ganz schlechte Köchin«, sagte Isabel kleinlaut.
»Dann mache ich es selbst. Ich bin ein guter Koch.«
Sie sah sich in der Wohnung um. Schöne, wertvolle Teppiche, wenig Bilder an den Wänden, dafür aber um so kostbarere. Die Möbel waren modern, aber ebenso individuell, der Eßraum war jedoch mit herrlichen alten Bauernmöbeln ausgestattet.
»Mach es dir bequem, Isabel«, sagte Daniel, einen Servierwagen vor sich herschiebend.
»Bist du ein Zauberer?« fragte sie, die appetitlichen Toasts betrachtend.
»Der perfekte Junggeselle«, sagte er.
»Mit Lenchen als Perle.«
»Sie braucht nur aufzuräumen. Sie läßt sich auch gern mal von mir verwöhnen.«
»Das würde wohl manche andere auch gern haben«, sagte Isabel. »An Heiraten denkst du wohl nicht, Dan?«
»Wenn ich mal daran denke, möchte ich mich verwöhnen lassen«, erwiderte er.
Es traf Isabel wie ein Stich. In diesem Augenblick wünschte sie, eine ganz andere Frau zu sein, eine, die seinen Vorstellungen entsprach. Daß dies nicht
der Fall war, wußte sie jetzt ganz genau.
Sie war achtundzwanzig Jahre, erfolgreich im Beruf und nicht unvermögend. Sie konnte sich alles leisten, und sie hätte jeden Mann haben können, der ihr gefiel.
Nur Daniel Norden nicht. Das wurde ihr jäh bewußt.
»Wie stellst du dir deine Frau vor?« fragte sie.
»Gar nicht«, erwiderte er. »Es müßte wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommen. Die oder keine! Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.«
»Und nebenher sammelt man Erfahrungen«, bemerkte Isabel beiläufig.
»Man gibt ab und zu Stimmungen nach«, erwiderte Daniel mit umwerfender Offenheit. »Du bist ein guter Kamerad, wenn ich es so nennen darf. Weißt du, daß du die einzige Frau bist, vor der ich Respekt habe?«
Wenn es ein anderer gesagt hätte, sie hätte sich geehrt gefühlt. Ihr wäre es jedoch lieber gewesen, wenn Daniel keinen Respekt vor ihr hätte.
Er hob sein Glas. »Auf unsere Freundschaft, Isabel. Wenn der Blitz mich nicht trifft, werde ich am Ende meines Lebens wenigstens sagen können, daß ich eine phantastische Freundin hatte. Wird es so bleiben?«
»Okay, Dan«, erwiderte sie, obgleich sie gern etwas anderes gesagt hätte.
»Und wenn du den Mann fürs Leben findest, wird unsere Freundschaft dann auch halten?« fragte er.
»Ich würde ihn nicht heiraten, wenn er etwas dagegen hätte«, sagte Isabel.
Er sah sie nachdenklich an. »Einen anderen Mann würde ich dir auch nicht wünschen. Du brauchst einen, der alles akzeptiert. Einen, der Format hat und dem du doch um einen Hauch überlegen bist. Sonst wärest du nicht glücklich,
Isabel.«
»Meinst du? Du kennst mich anscheinend besser, als ich mich selbst kenne«, sagte sie ironisch. »Vielleicht möchte ich auch nur eine Frau sein.«
»Du bist viel zu gescheit, um nicht alles abzuwägen.«
Ob er jede Frau so nüchtern beurteilt? ging es Isabel durch den Sinn. Gibt es denn wirklich keine, die ihn aus seinem Gleichgewicht bringen kann? Sieben Monate kannte sie ihn nun schon. Sie hatte ihn auf dem Tennisplatz erlebt und manchmal auch auf Parties, umgeben von reizvollen Mädchen und verführerischen Frauen. Er hatte eine ganz besondere Art zu flirten, aber seltsamerweise konnte sie sich ihn nicht als glühenden Liebhaber vorstellen.
Er schien es gar nicht zur Kenntnis zu nehmen, daß sie nun schon geraume Zeit schwiegen.
»Ich werde mir morgen gleich einige Schallplatten von David Delorme kaufen«, sagte er plötzlich unmotiviert, und sie konnte daraus nur entnehmen, daß er mit seinen Gedanken wieder bei dem Konzert war.
»Wenn es schon welche gibt«, sagte sie. »Hoffentlich ist er nicht schon fertig, bevor es überhaupt zu Aufnahmen kommt.«
»Du hast schon vorhin so eine Andeutung gemacht. Worauf spielst du an? Was weißt du von ihm?«
»Ausnahmsweise wohl etwas mehr als du. Sein Aufstieg begann raketenschnell. Das fasziniert natürlich die Zeitungsschreiber. Ich habe in England einige Artikel über ihn gelesen. Er stammt aus kleinsten Verhältnissen. Er hat sich sein Studium mit schwerster Arbeit verdient. Für einen Pianisten nicht so gut, möchte man meinen, aber die Empfindsamkeit seiner Finger scheint darunter nicht gelitten zu haben. Jedenfalls fand er dann eine Mäzenin. Die Frau ist doppelt so alt wie er, und da er nicht nur ein guter Pianist ist, sondern auch ein ganz interessanter Junge, wird sie ihn wohl nicht aus reinster Nächstenliebe an sich fesseln.«
»Sei nicht so frivol, Isabel«, warf Daniel ein.
»Ich nenne die Dinge beim Namen. Meiner Ansicht nach ist der Aufstieg für ihn ein bißchen zu rasch gekommen. Man wird ihn umschwärmen, und Ruhm ist schon manchem in den Kopf gestiegen.«
»Es wäre schade um dieses Talent«, sagte Daniel nachdenklich, »aber du magst recht haben.«
»Und dann ist da noch die Frau, die ihn so ziemlich als ihr Produkt betrachtet. Sie heißt übrigens Lorna Wilding.«
»Der Name sagt mir nichts.«
»Witwe des englischen Stahlmagnaten«, erklärte Isabel, »schwerreich. Es wird ihr aber nicht gefallen, daß sich jetzt auch noch junge, hübsche und reiche Mädchen um David Delorme scharen.«
»Gesellschaftsklatsch«, bemerkte Daniel anzüglich.
»Das bleibt nicht aus, aber zufällig weiß ich ziemlich genau Bescheid. Ich habe es kürzlich in Paris erlebt, wie sie ihm eine Szene gemacht hat. Dieser begabte junge Mann ist ihr in bezug auf Selbstbewußtsein nicht gewachsen. Ich könnte mir auch vorstellen, daß es gewaltig auf die Nerven geht, von einem Konzert zum andern gejagt zu werden. Der englische Konsul gibt übermorgen einen Empfang für ihn. Du könntest kommen und dir David Delorme aus der Nähe begucken. Wie wär’s?«
»Ich fahre zur Einweihung des Sanatoriums«, erklärte Daniel.
»Übermorgen schon?«
»Du bist doch sonst immer bestens informiert«, sagte er lächelnd.
»Ich bin gestern erst aus Paris zurückgekommen, und alles weiß ich eben auch nicht. Die Presse ist wohl unerwünscht?« fragte sie hintergründig.
»Einen Wirbel wollen wir nicht gleich veranstalten. Die Insel der Hoffnung soll kein Treffpunkt der Snobs werden, sondern eine Oase des Friedens.«
Diesmal machte sie keine spöttische Bemerkung.
»Du willst, daß der Lebenstraum deines Vaters verwirklicht wird«, sagte sie, »aber hättest du das nicht besser gekonnt, wenn du die Leitung selbst übernommen hättest?«
»Cornelius hat mehr Erfahrung«, sagte Daniel kurz.
»Wäre es dir unangenehm, wenn ich kommen würde, Dan?« fragte Isabel.
»Durchaus nicht, aber willst du denn auf den Empfang verzichten? Berühmte Leute wirst du bei uns auch nicht antreffen.«
»Immerhin könnte eine diskrete Werbung doch recht nützlich sein. Für wieviel Patienten ist dort Platz?«
»Achtzig, aber es ist kein Sanatorium im üblichen Sinn. Es steht dir frei, es dir anzusehen.«
»Bedarf es denn keiner offiziellen Einladung?« fragte Isabel.
»Doch nicht für die engsten Freunde. Ich nehme Molly und eine Patientin mit.«
Das nahm sie als Hinweis, daß er sie nicht auch mitnehmen könne. Ein diskreter Hinweis. Was für eine Patientin mochte das sein?
Ob er auch Gedanken lesen konnte? »Die Patientin ist übrigens ein altes Mütterchen, achtzig Jahre, und sie war meine erste Patientin«, erklärte er beiläufig.
Unwillkürlich errötete Isabel. »Vormittags könnte ich sowieso noch nicht weg. Vielleicht wird mir die besondere Ehre zuteil, David Delorme interviewen zu dürfen, falls Mrs. Wilding einen weiblichen Journalisten akzeptiert. Mich interessiert unser Genie auch.«
»Der Pianist oder der Mann?« fragte Daniel.
»Der Pianist natürlich. Aber ich denke, daß es jetzt schon reichlich spät ist. Bestellst du mir ein Taxi, Dan?«
»Ich bringe dich selbstverständlich heim.«
»Zum andern Ende der Stadt? Das ist doch Unsinn. Nein, ich fahre mit dem Taxi.«
»Wie du willst«, sagte er.
Wenn er doch nur zu durchschauen wäre, dachte Isabel, als sie auf der Heimfahrt im Taxi über diesen Abend nachdachte.
Dr. Daniel Norden dachte über David Delorme nach, dessen Spiel ihn so ungeheuer beeindruckt hatte. Verinnerlicht hatte dieser junge Mann gewirkt, scheu und ungelenk, jeden Effektes abhold, hatte er sich verbeugt.
Daniel konnte sich nicht vorstellen, daß ein solcher Künstler sich von einer Frau abhängig machte. Mit den berauschenden Tönen in den Ohren schlief er ein. An Isabel dachte er nicht mehr.
*
»Beeilung, Kinder«, rief Helga Moll, »es ist halb acht Uhr. Ihr müßt zur Schule.«
Katrin, die Zwölfjährige, kam kauend in die Diele. Sie aß für ihr Leben gern, was sich auch äußerlich bemerkbar machte, denn sie war ein richtiger kleiner Pummel.
Der fünfzehnjährige Peter dagegen war mager und hoch aufgeschossen. Er maulte vor sich hin.
»Sei doch nicht immer so mürrisch, Peter«, sagte Helga.
»Diese dämliche Schule«, knurrte er. »Wenn ich mir vorstelle, was Oma wieder rummeckern wird, wenn sie erfährt, daß ich in Latein nicht mitkomme. Muß das denn sein, Mutti?«
»Später würdest du mir mal Vorwürfe machen, wenn ich dich nicht auf die Oberschule geschickt hätte«, sagte Helga. »Jetzt jammere nicht herum, sondern geh.«
»Und nimm dir ein Beispiel an mir«, sagte Sabine, »ich habe mein Abi mit achtzehn gemacht. Du bist sowieso schon ein Jahr hinterher.«
»Das gnädige Fräulein«, brummte er, »wenn sie sich bloß nicht so aufspielen würde. Tschüs«, und er war draußen.
»Mach dir nichts draus, Mutti«, sagte Katrin. »Morgens ist er immer ungenießbar.«
Sie war eher phlegmatisch. Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Kommst du heute nicht, kommst
du morgen«, rief Sabine hinter ihr
her, aber Katrin nahm keine Notiz davon.
»Du mußt auch nicht ständig an den beiden herumnörgeln«, ermahnte Helga ihre Älteste, die ein bildhübsches Mädchen war und seit zwei Wochen als Volontärin in einer Zeitungsredaktion beschäftigt war.
»Du bist schon geplagt mit den Kleinen«, sagte Sabine.
»Und du machst mir wohl gar keine Sorgen«, bemerkte Helga leicht gereizt.
»Wenn du wieder auf Lutz anspielst, verziehe ich mich auch schleunigst«, sagte Sabine trotzig.
»Ich fahre heute sowieso nicht in die Praxis«, meinte Helga.
Sonst verließen sie immer gemeinsam das Haus. »Warum nicht?« fragte Sabine überrascht.
»Weil Dr. Norden mir freigegeben hat. Morgen fahren wir doch zur Insel, falls dir das entfallen sein sollte.«
»Es ist mir nicht entfallen«, sagte Sabine spöttisch. »Du freust dich wohl mächtig, daß du uns ein paar Tage nicht zu genießen brauchst.«
Manchmal hatte sie einen Ton an sich, den Helga nicht mochte, aber es war besser, sich mit Sabine nicht anzulegen. Bei ihr wechselten die Stimmungen rasch.
»Du mußt nicht alles gleich so tragisch nehmen, Mutti«, sagte sie jetzt auch versöhnlich. »Es ist jetzt nun mal anders, als in eurer Jugendzeit.«
Sabine verschwand nochmals im Bad. Als sie wieder erschien, hatte sie Lidschatten und Make-up aufgelegt, die Wimpern schwarz getuscht und eine Parfümwolke umwehte sie.
Sie trug helle Jeans und einen hautengen Pulli, was sie sich allerdings auch leisten konnte, denn sie hatte im Gegensatz zu Katrin eine knabenhaft schlanke Figur. Das hellblonde, seidige Haar fiel weit über den Rücken herab.
Ohne Make-up gefiel sie ihrer Mutter besser, aber Helga hatte es sich abgewöhnt, daran Kritik zu üben.
»Dann ade, Mutti«, sagte Sabine, die wohl doch auf solche Kritik gewartet hatte.
»Komm heute bitte pünktlich«, sagte Helga. »Du weißt doch, daß Omi kommt.«
»Ich weiß, ich weiß«, und dann war auch sie draußen.
Helga war froh, daß sie Zeit zum Aufräumen hatte. In jedem Zimmer herrschte die gleiche Unordnung. Wieder einmal war sie froh, daß die Wohnung wenigstens so groß war, daß jeder seinen eigenen Raum hatte. Dank der großzügigen Unterstützung ihrer Eltern hatte sie die verhältnismäßig teure Wohnung auch nach ihrer Scheidung behalten können.
Sie hätte nicht zu arbeiten brauchen, wenn sie sich bereitgefunden hätte, zu ihren Eltern zu ziehen, die in einem ländlichen Vorort ein sehr schönes, großes Haus besaßen. Aber sie hatte noch weit größere Schwierigkeiten vorausgesehen, wenn sie alle unter einem Dach lebten, ganz abgesehen davon, daß es für die Kinder wegen der Schulen ungünstig gewesen wäre.
Sie wollte auch ihre persönliche Freiheit wahren, nachdem sie damals, vor fünf Jahren, endlich die Konsequenzen aus einer mißglückten Ehe gezogen hatte, in der sie immer draufzahlte, mit Geld und mit Gefühlen. Heinz Moll war ein Traumtänzer gewesen, mit großen, hochfliegenden Plänen, von denen er nie einen verwirklicht hatte. Ohne großen Einsatz schnell zu viel Geld zu kommen, war sein Traum gewesen, für Helga war es ein Alptraum geworden.
Er war nicht ganz aus ihrem Leben verschwunden. Er kam regelmäßig, um die Kinder zu sehen, und manchmal auch, um sie anzupumpen; und sie ärgerte sich, daß sie dann immer wieder nachgiebig wurde und ihm aushalf, ohne jemals einen Pfennig wiederzubekommen.
Bis sie die Wohnung aufgeräumt hatte, war es mittag geworden. Die Kinder mußten bald aus der Schule kommen. Das Essen hatte sie schon vorbereitet.
Mittags war sie immer daheim. Dr. Norden sorgte dafür, daß sie pünktlich heimkam, auch wenn in der Praxis Hochbetrieb war. Er war froh, eine so tüchtige und zuverlässige Kraft zu haben, und er hatte auch Verständnis für ihre häuslichen Sorgen.
Es läutete, und Helga blickte schnell auf die Uhr. Eigentlich war es noch ein bißchen zu früh, als daß es die Kinder schon sein könnten.
Doch vor ihr stand ihr geschiedener Mann. Heinz Moll sah noch immer recht annehmbar aus, und heute auch besonders gepflegt.
»Fein, daß ich dich antreffe«, sagte er. »Sind die Kinder schon zu Hause?«
»Nein, was willst du? Geld kann ich dir nicht geben, diesmal nicht.«
»Sei doch nicht so böse«, sagte er schmeichelnd. »Ich will dir was bringen, Helgalein.«
Sie starrte ihn an. »Bist du schon am Vormittag betrunken?« fragte sie, denn das gehörte auch zu seinen Schwächen.
»Daß du immer nur schlecht von mir denken mußt«, sagte er. »Ich will dir wirklich Geld bringen, Helga.«
»Woher hast du es?« fragte sie mißtrauisch.
»Du wirst zwar wieder was dran auszusetzen haben, aber ich habe es beim Pferderennen gewonnen. Große Dreierwette, über dreizehntausend Mark. Na, ist das was?«
Er war unverbesserlich. Er würde sich nie ändern. Aber was sollte sie ihm Vorhaltungen machen. Sie war geschieden.
»Ich dachte, wir könnten uns ein schönes Wochenende machen, wir alle zusammen«, fuhr er fort.
»Halt das Geld zusammen und fang etwas Vernünftiges damit an«, sagte Helga. »Außerdem bin ich am Wochenende nicht da.«
Er kniff die Augen zusammen. »Hast du dir einen andern angelacht?« fragte er gereizt.
»Das fehlte noch. Ich habe für alle Zeiten genug. Ich fahre mit meinem Chef zur Einweihung des Sanatoriums. Übrigens kommt Mutter. Sie wird bald hier sein.«
Damit konnte sie ihn abschrecken. Vor seiner ehemaligen Schwiegermutter hatte er einen höllischen Respekt.
»Da hast du einen Tausender«, sagte er großmütig. »Kauf den Kindern was Schönes. Ich komme nächste Woche mal vorbei. – Helga, wenn ich nun was auf die Beine bringe, könnten wir es dann nicht noch mal versuchen?«
»Hör auf damit«, sagte sie abweisend. »Wie gewonnen, so zerronnen. Ich kenne dich.«
»Gib mir doch eine Chance«, sagte er kleinlaut.
»Nein!«
Es klang so energisch, daß er zusammenzuckte. »Na dann, ein schönes Wochenende und sag’ den Kindern schöne Grüße.«
Aber die Kinder hatte er dann auf der Straße noch getroffen. Sie kamen mit Verspätung angestürmt. Er hatte jedem zwanzig Mark geschenkt, und das konnten sie nicht fassen.
Irgendwie hingen sie noch an ihm, obgleich sie mit der Trennung ihrer Eltern durchaus einverstanden gewesen waren. Sie hatten zuviel mitbekommen von seinen Schwächen, und solange er mit ihnen lebte, war er kein fürsorglicher Vater gewesen.
»Wenn er Geld bringt und nicht immer von dir holt, Mutti, kann er ruhig öfter kommen«, sagte Katrin, und dann legte sie ihren Zwanzigmarkschein auf den Tisch. »Nimm du es«, erklärte sie.
»Behalte es ruhig«, sagte Helga, »aber teile es dir ein.«
Peter sagte nichts. Er war überhaupt merkwürdig still, aber Helga war mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Nun hatte Heinz mal wieder Geld in den Taschen, und wieder würde er sich in Träumen verlieren. Plötzlich verspürte sie eine jähe Angst, daß Peter ihm nachgeraten könnte. Er hatte auch so wenig Ausdauer und gar keinen Ehrgeiz, dabei hatten die Lehrer ihr bestätigt, daß er überdurchschnittlich intelligent sei.
Ja, sie hatte ihre Sorgen, aber sie schluckte sie tapfer in sich hinein.
*
Dr. Norden hatte an diesem Tag nur drei Privatpatienten bestellt, für die er sich viel Zeit nehmen mußte. Offiziell war die Praxis heute schon geschlossen, und sein Kollege Dr. Günter Feldmann war seine Vertretung, wie Anrufende durch den Anrufbeantworter erfahren konnten.
Daniel Norden hatte noch so viel zu erledigen, wozu ihm sonst einfach keine Zeit blieb, aber den Vormittag hatte er doch für diese drei Patienten freigehalten. Es waren schwierige Fälle.
Schon gegen neun Uhr war Franz Glimmer gekommen, Besitzer einer Tankstelle und Autoreparaturwerkstatt. Dr. Norden kannte ihn schon seit Jahren, da Franz Glimmer seine jeweiligen Wagen vorbildlich betreute. Daß der Mann nicht gesund war, hatte Daniel schon lange vermutet, aber wenn er ihn nach seinem Befinden fragte, hatte er immer abgewinkt.
»Ich habe keine Zeit, krank zu sein, Herr Doktor«, war seine ständige Erwiderung. Aber vor ein paar Tagen war er dann doch mal gekommen, sich krümmend vor Schmerzen.
Dr. Norden hatte ihn gründlich untersucht, und heute morgen hatte er die Befunde von den einzelnen Instituten bekommen, mit denen er zusammenarbeitete. Sie waren erschreckend genug.
»Ja, Herr Glimmer, es wird wohl nicht zu umgehen sein, daß Sie sich einer Magenoperation unterziehen«, sagte Daniel Norden vorsichtig, denn eigentlich hätte er ihn sofort in eine Klinik schicken müssen.
»Operieren kommt gar nicht in Frage, Herr Doktor«, sagte Glimmer aggressiv. »Ich lasse kein Messer an mich heran.«
Daniel Norden kannte solche Reaktionen. Er hatte eine ganze Anzahl von Patienten, die so eingestellt waren.
Er sah den Mann forschend an. Er mochte ihn. Er war einer von jenen, die nicht nur profitgierig waren, sondern ihre Arbeit noch außerordentlich gewissenhaft erledigten. Er war mit einer netten Frau verheiratet und hatte zwei erwachsene Kinder.
»Sie sind siebenundvierzig Jahre, Herr Glimmer«, sagte er, »und wenn Sie sich bald operieren lassen, können Sie noch mal so alt werden, sonst –«, er machte eine Pause, denn der Mann sah ihn entsetzt an.
»Sonst?« fragte er heiser. »Wollen Sie sagen, daß das mein Tod sein kann?«
»Ich werde mich hüten«, erklärte Dr. Norden. »Aber Sie werden die Schmerzen nicht mehr loswerden. Im Gegenteil, sie werden immer schlimmer. Ich weiß nicht, welches Medikament ich Ihnen geben sollte. Ihr Sohn ist doch ein tüchtiger Bursche. Ihm können Sie doch die Werkstatt anvertrauen, und die Uschi macht sich doch sehr nett an der Tankstelle.«
»Reden Sie nicht herum«, sagte Franz Glimmer. »Ich sage Ihnen auch, wenn der Motor Ihres Wagens nichts mehr taugt, Herr Doktor.«
»Der Motor des Menschen ist das Herz. Es bestimmt den Rhythmus. Ihr Herz ist gut. Noch ist es gut, aber ewig wird es nicht standhalten, wenn Sie sich ständig mit Schmerzen plagen. Sperren Sie sich nicht gegen eine Operation.
Ich muß Ihnen eindringlichst dazu raten.«
»Ich will die Wahrheit wissen«, sagte Franz Glimmer. »Ist es diese verfluchte Krankheit, dieser Krebs?«
»Es könnte Krebs werden«, sagte Dr. Norden zögernd. Die Untersuchungsbefunde ließen darauf schließen, aber auch das wollte er ihm noch verschweigen. Wenn er sich zu einer Operation entschließen könnte, sollte er mit Zuversicht in die Klinik gehen.
»Und wenn ich mich operieren lasse, geben Sie mir eine Chance?« fragte Franz Glimmer tonlos.
»Eine Chance hat man immer. Ich würde Sie zum besten Chirurgen schicken, den ich kenne, zu Professor Manzold.«
»Als ob der einen Mechaniker nehmen würde«, sagte Franz Glimmer bitter. »Und wenn auch, sein Honorar bezahlt doch keine Versicherung.«
»Haben Sie eine so schlechte Meinung von den Professoren?« fragte Dr. Norden im scherzhaften Ton. »Sie sind doch sehr gut versichert, außerdem Privatpatient, wenn Ihnen das so wichtig erscheint.«
Franz Glimmer sah ihn verlegen an. »Ich weiß ja, wie Sie sind, Herr Doktor, und wenn Sie Chirurg wären, würde ich es mir nicht lange überlegen. Warum sind Sie eigentlich keiner?«
»Ehrlich gesagt, weil mir der ganze Mensch lieber ist, aber ohne Chirurgen geht es nun mal nicht. Wir können froh sein, daß wir sie haben. Und Professor Manzold wird Ihnen gefallen. Mit ihm können Sie reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und später können Sie sich bei ihm auch mal revanchieren, denn er hat dauernd Scherereien mit seinem Wagen.«
»Sie beschwatzen mich ja doch«, sagte Franz Glimmer seufzend. »Gegen Sie kommt man nicht an. Aber wie soll ich es meiner guten Hilde beibringen, da sie sich doch gleich immer so aufregt?«
»Soll ich es ihr sagen?« fragte Dr. Norden.
»Wenn Sie das tun würden? Na, und wenn es dann sein muß, beiße ich in den sauren Apfel.«
Dr. Norden atmete erleichtert auf. »Ich komme mittags vorbei und spreche mit Ihrer Frau«, sagte er. »Und bei Professor Manzold melde ich Sie an. Ich sage dann gleich Bescheid, wann Sie einrücken können in die Klinik.«
Franz Glimmer runzelte die Stirn. »Pressiert es denn gar so?« fragte er.
»Ich wäre dafür«, sagte Dr. Norden.
»Na, wenn Sie es sagen, ergebe ich mich in mein Schicksal. Sie wissen ja auch ganz genau, wie lange man ein Auto beanspruchen kann.«
»Nur ist ein Menschenleben wertvoller, und Sie sind für Ihre Familie sehr wertvoll.«
»Und wenn es schiefgeht?« fragte Franz Glimmer stockend.
Das darf nicht sein, dachte Dr. Norden. »Der Patient kann viel dazu beitragen, daß es gutgeht«, sagte er. »Ich kann Ihnen jedenfalls sagen, daß schon sehr viele nach einer solchen Operation sehr alt geworden sind.«
»Hand aufs Herz, stimmt das auch?«
»Ich sage die Wahrheit.«
Franz Glimmer ging, und Frau Neuner kam. Sie war ein neurotischer Fall. Sie bildete sich viele Krankheiten ein, aber diese Einbildung war schon so ausgeprägt, daß sie in organische Beschwerden ausartete. Sie war fünfzig und trauerte der entschwundenen Jugend nach.
Dr. Norden kannte ihre ganze Lebensgeschichte. Auch aus dem geduldigen Zuhören konnte man seine Diagnose stellen, das hatte er von seinem Vater gelernt.
Ihr Mann betrog sie, ihr einziger Sohn war rauschgiftsüchtig. Es war zu verstehen, daß diese Frau langsam aber sicher in sich zerbröckelte. Sie litt unter den Wechseljahren, und es fehlte ihr an Lebensmut, mit den Anforderungen, die an sie gestellt wurden, fertig zu werden.
Geduldig hörte er sich ihre Klagen an. Daß ihr Sohn jetzt in einer Entziehungsanstalt war, hatte sie Dr. Norden zu verdanken.
»Ich habe mich schon erkundigt«, sagte er ihr. »Rainer macht Fortschritte, und wenn er herauskommt, packen Sie Ihre Sachen und gehen ein paar Wochen mit ihm ins Sanatorium. Zeigen Sie Ihrem Mann doch mal die Zähne, Frau Neuner. Rainer braucht Ihre Hilfe.«
»Sie haben für alles Verständnis, aber wer bringt das sonst schon auf«, sagte sie schluchzend.
»Dr. Cornelius bestimmt, und die Roseninsel soll doch gerade für die zu einer Insel der Hoffnung werden, denen das Schicksal so übel mitgespielt hat wie Ihnen.«
»Mein Mann hat den Jungen doch schon abgeschrieben«, sagte sie leise.
»Dann müssen Sie ihm eben mal klarmachen, daß er nicht ganz schuldlos an Rainers Einstellung zum Leben ist. Und wenn er Einwände erhebt, schicken Sie ihn mal zu mir.«
»Jedesmal, wenn ich von Ihnen weggehe, habe ich wieder ein bißchen Mut«, sagte Frau Neuner.
Der dritte Patient kam nicht, und darüber machte sich Dr. Norden Gedanken.
Dr. Neubert war Witwer, pensionierter Schulrat. Er lebte allein in seinem Häuschen, das nicht weit entfernt von Dr. Nordens Praxis lag.
Er rief bei ihm an, als aber keine Antwort kam, folgte er einer inneren Stimme und fuhr zu dem Haus in der stillen Villenstraße. Es wurde ihm nicht geöffnet. Er ging um das Haus herum. Die Terrassentür stand einen Spalt offen.
Dr. Norden vernahm ein Stöhnen, und als er in das Zimmer trat, sah er den alten Herrn am Boden liegen. Er verlor keine Sekunde, ging zum Telefon und rief den Sanitätswagen, dann das Kreiskrankenhaus an.
»Zum Donnerwetter, es ist ein Notfall«, fauchte er den Gesprächspartner an.
Dann kniete er neben dem Kranken nieder. Daß es ein Schlaganfall war, sah er sofort.
»Dr. Neubert, hören Sie mich«, rief er laut.
Ein undefinierbares Murmeln kam über die bläulichen Lippen.
»Ich bin es, Daniel Norden«, sagte er.
Ein Augenlid hob sich etwas, und es sah fast so aus, als gleite ein flüchtiges Lächeln über das zerknitterte Gesicht.
Dann hörte Daniel die Sirene des Krankenwagens und eilte hinaus. Aber als man Dr. Neubert auf die Bahre gehoben hatte und hinaustrug, wußte er, daß dieser alte Herr nicht mehr in sein Haus zurückkehren würde.
»Ich komme nach«, sagte er zu den Sanitätern. Dann verschloß er die Terrassentür, nahm den Hausschlüssel vom Schlüsselbrett und schloß auch diese Tür hinter sich zu. Er ging noch einmal um das kleine, rosenumrankte Haus herum und schaute nach, ob auch alle Fenster geschlossen seien.
Er war oft in diesem Haus gewesen, manchmal auch nur, um eine Stunde mit diesem klugen, alten Mann zu verplaudern, der mit seinem Vater eng befreundet gewesen war.
Muß es nicht schrecklich sein, am Ende seines Lebens so allein zu sein, ging es ihm durch den Sinn. Dr. Neubert hatte seine Frau und seine beiden Kinder überlebt. Er hatte den Tod dann als einen Freund betrachtet, der ihm willkommen war. Dr. Norden wünschte ihm, daß dieser Tod nun gnädig mit ihm sein würde. Das war alles, was er diesem gütigen Menschen noch wünschen konnte. Es wurde ihm dann vom Chefarzt des Krankenhauses auch bestätigt. Dr. Norden versprach, am Abend noch einmal vorbeizukommen.
Weil er jetzt an Dr. Neubert denken mußte, der sich so sehr gewünscht hatte, die Insel der Hoffnung noch kennenzulernen, hätte er fast vergessen, bei den Glimmers vorbeizufahren.
Schon auf dem Weg zur City fiel es ihm dann doch noch ein und er kehrte um.
Uschi Glimmer stand im blauen
Jeansanzug an der Tanksäule. Ihr karottenrotes Haar leuchtete weithin. Ihr jungenhaftes, sommersprossiges Gesicht hatte heute nicht den fröhlichen Ausdruck, den er gewohnt war.
»Gut, daß Sie kommen, Herr Doktor«, sagte sie überstürzt. »Papa geht es wieder ganz schlecht.«
»Hat er noch nichts gesagt?« fragte Dr. Norden.
»Was denn?« fragte Uschi.
»Daß er in die Klinik muß, Uschi. Es bleibt nichts übrig als eine Operation.«
»O Gott«, sagte sie bebend.
»Macht ihm Mut«, sagte Dr. Norden. »Ihr zwei, der Maxi und du, werdet es doch schaffen.«
Sie nickte und unterdrückte die aufsteigenden Tränen.
»Sagen Sie es der Mama, Herr Doktor?« fragte sie.
»Deswegen bin ich gekommen. Kopf hoch, Mädchen, es wird schon wieder.«
Hilde Glimmer war eine hübsche rundliche Frau. Sie sah immer wie aus dem Ei gepelit aus. Jetzt war auch ihr Gesicht sorgenvoll.
Aber sie war tapfer, als er es ihr sagte. »Ich habe mir schon so was gedacht, Herr Doktor«, murmelte sie. »Als der Franz gesagt hat, daß Sie mit mir reden würden, habe ich es mir gedacht. Wenn er nur wieder gesund wird. In drei Monaten haben wir Silberhochzeit. Fünfundzwanzig Jahre glücklich verheiratet. Er war zweiundzwanzig und ich neunzehn, und jeder hat gesagt, daß das nicht gutgeht. Und kein böses Wort hat es in unserer Ehe gegeben. Er ist der beste Mann auf der Welt.«
»Ja, das glaube ich Ihnen gern, Frau Glimmer«, sagte Daniel Norden. »Ich gebe ihm eine Spritze, und nachher spreche ich gleich persönlich mit Professor Manzold. Richten Sie schon alles her. Solche Operation muß vorbereitet werden. Ich denke, daß er heute noch geholt werden kann.«
»Holen dürfen sie ihn nicht«, sagte Hilde Glimmer entsetzt. »Dann dreht er durch. Der Maxi kann ihn fahren. Nur nicht mit dem Krankenwagen, dann gibt er sich gleich auf.«
Das sagte ihm Franz Glimmer auch. Er ließ sich widerstandslos die Spritze geben, und das sagte schon viel.
Als Dr. Norden zu seinem Wagen ging, kam Max aus der Werkstätte. Er wischte sich die Hände an der Hose ab. Er war ein hübscher Bursche, dreiundzwanzig und seinem Vater sehr ähnlich.
»Danke, daß Sie den Papa überredet haben, Herr Doktor«, sagte er. »Wir werden ihm schon keine Schande machen. Mein Freund Eugen hilft mir. Er geht ja auf das Technikum, um Ingenieur zu werden, aber Uschi zuliebe macht er sich auch mal die Hände dreckig. Aber Papa wird doch wieder gesund werden?«
So mutig er sich gab, stand doch Angst in seinen Augen.
»Das wollen wir doch sehr hoffen, Max«, sagte Dr. Norden. Er drückte die harte, schmutzige Hand des jungen Mannes, und gleichzeitig schickte er ein Stoßgebet zum Himmel, daß er nicht falsche Hoffnungen weckte.
Er fuhr zur Universitätsklinik, und er hatte Glück, daß Professor Manzold Zeit für ihn hatte.
»Es ist ein bißchen schwierig, mit den Betten im Augenblick«, sagte der Professor, »aber Ihnen kann ich ja nichts abschlagen, Dan. Ich wäre gern am Sonntag hinausgekommen zu eurer Insel. Vielleicht klappt es noch. An Patienten wird es euch sicher nicht mangeln. Schade, daß Friedrich das nicht mehr erleben konnte.« Er strich sich durch das schüttere weiße Haar. »Dann werden wir Ihren Patienten mal holen lassen«, sagte er.
»Er wird gebracht«, sagte Daniel schnell. »Sein Sohn bringt ihn. Und ich bringe Ihnen die Befunde und die Anamnese nachher noch vorbei. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Seien Sie bitte nett zu Herrn Glimmer.«
Der Professor lachte leise auf. »Wie der Vater«, sagte er gedankenvoll. »Friedrich sagte auch immer: Sei nett, Arno. Aber ich bin auch nur ein Mensch, Dan. Ich tue, was in meiner Macht steht, aber über mir steht ein anderer, der unsere Geschicke lenkt.«
*
Dr. Norden hatte bei den Glimmers angerufen, dann endlich konnte er die wichtigen Behördengänge erledigen. Gegen einen seiner Patienten lief ein Entmündigungsverfahren, zu dem er persönlich gehört werden wollte; dann mußte er noch zur Bank. Noch im letzten Augenblick kam er dorthin. Die Zeit verrann wieder einmal viel zu schnell, und er hatte keine Ahnung, was indessen passiert war, und wer ihn mit brennender Ungeduld schon seit Stunden zu erreichen versuchte.
Für Isabel Guntram war es ganz überraschend gekommen, als man sie an diesem Vormittag damit beauftragte, David Delorme zu interviewen. Sie war kaum in ihrer Redaktion eingetroffen, als sie deswegen schon zum obersten Chef beordert wurde. Aber solche Überraschungen war sie ja gewohnt.
Das hübsche blonde Mädchen in ihrem Vorzimmer dagegen war ihr noch unbekannt, da sie fast drei Wochen abwesend gewesen war.
Irgendwie kam ihr der Name Moll bekannt vor, aber augenblicklich dachte sie dabei nicht an Daniels Sprechstundenhilfe. David Delorme hatte ihr ganzes Interesse.
»Wir werden uns ja noch näher kennenlernen«, sagte sie zu der jungen Volontärin, die sie mit einem schwärmerischen Augenaufschlag bedacht hatte, dann war sie schon wieder aus der
Tür.
»Nun krieg dich mal wieder, Sabine«, sagte der Reporter Uwe Winter. »Bis du mal soweit bist wie die Guntram, wird noch viel Wasser die Isar hinabfließen.«
»Sie ist eine tolle Frau«, sagte Sabine.
Das allerdings fand Uwe Winter auch, obgleich er sich keinerlei Hoffnung machte, daß Isabel dies zur Kenntnis nehmen würde.
»Wenn du sie dir als Vorbild nimmst, wirst du es weit bringen«, sagte er kameradschaftlich. »Allerdings hat sie an ihr Privatleben bisher kaum Zeit verschwendet.«
Das klang ein bißchen anzüglich, denn Uwe war es nicht entgangen, daß Sabine immer von einem jungen Mann abgeholt wurde.
Glühende Röte schoß in ihre Wangen. »Ein bißchen Privatleben kann man doch wohl noch haben«, sagte sie trotzig.
»Ein bißchen schon, aber in dem Beruf muß man immer am Drücker bleiben. Na, das ist dein Bier«, meinte er gleichmütig.
Zu diesem Zeitpunkt betrat Isabel schon die Hotelhalle. Aber zu David Delorme gelangte sie nicht so rasch. Sie mußte erst die Barriere überwinden, die Lorna Wilding um ihn aufgerichtet hatte.
Sie war eine bemerkenswerte Frau, wie Isabel nun feststellen konnte. Sie sah blendend aus und war äußerst geschickt im Umgang mit Menschen.
Isabel fühlte sich von einem forschenden Blick aus stahlgrauen Augen durchbohrt, nachdem sie ihren Presseausweis genau angesehen hatte.
»Zehn Minuten«, sagte sie gnädig. »Mr. Delorme braucht Ruhe.«
Das sah man ihm allerdings an. David Delorme wirkte sehr erschöpft. Nervös strich er sich ständig durch das volle blauschwarze Haar. Seine weit auseinanderstehenden Augen hatten einen schwermütigen Ausdruck.
»Darf ich Ihnen einige Fragen über Ihre Pläne stellen?« fragte Isabel nach der üblichen Einleitung.
Er sah an ihr vorbei. »Ruhe, Ruhe und noch mal Ruhe«, stieß er hervor. »Diese Empfänge gehen mir auf die Nerven, wenn Sie es genau wissen wollen.«
Er sprach schnell, und obgleich Isabel die englische Sprache perfekt beherrschte, konnte sie ihm kaum noch folgen, und alles, was danach kam, war wie ein böser Traum, denn Lorna trat ein, und auf ihre sanfte Frage, ob es ihm auch gutgehe, wurde er nahezu hysterisch.
Isabel blieb dann nichts übrig, als sich zurückzuziehen, aber als sie die Hotelhalle erreicht hatte, wurde sie von einem Kollegen aufgehalten, der für ein Konkurrenzblatt tätig war. Sie wimmelte ihn ab und steuerte dem Ausgang zu. Doch kaum hatte sie diesen erreicht, fühlte sie einen festen Griff an ihrem Arm, und als sie sich umwandte, sah sie in David Delormes verzerrtes Gesicht.
»Bringen Sie mich weg von hier, und ich sage Ihnen, was ich wirklich will«, stieß er hervor.
Isabel überlegte nicht lange. Sie war lange genug in diesem hektischen Metier tätig. Sie witterte eine Sensation, und sie war realistisch genug, diese für sich auszuwerten.
»Kommen Sie«, sagte sie kurz. Er folgte ihr wie ein anhänglicher Hund, der eben von seinem Herrn verstoßen worden war, zu ihrem Wagen.
Sie sah noch Lorna Wilding in der Tür des Hotels stehen, wild gestikulierend und rufend, aber sie startete ihren Wagen schnell.
»Thank you«, sagte David Delorme. »Ich glaube, ich wäre eines Totschlags fähig.«
»Nanana«, sagte Isabel, aber das verstand er nicht.
»Bringen Sie mich an einen Platz, wo niemand mich findet«, sagte David Delorme.
Warum gerade ich, fragte sich Isabel, aber dabei überlegte sie schnell.
»Fühlen Sie sich nicht wohl?« fragte sie.
»Überhaupt nicht«, erwiderte er. »Mit Ihnen kann ich mich wenigstens verständigen. Ich spreche nicht deutsch.«
»Möchten Sie einen Arzt aufsuchen?« fragte Isabel.
Er nickte. Sie fühlte es mehr, als sie es sehen konnte, denn sie mußte sich auf den Verkehr konzentrieren.
Er sprach wieder schnell und undeutlich, aber sie konnte verstehen, daß ihm das Wetter nicht bekomme und die Hetze ihm zuviel sei.
»Und dann sie, dieser Vampir«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Ich will Gladys sprechen.«
Gladys, nicht Lorna! Es gab da also eine andere Frau.
Im Nachdenken war Isabel noch nie langsam gewesen.
»Wo ist Gladys?« fragte sie. »Kann ich Sie hinfahren, Mr. Delorme?«
»Sie ist doch nicht hier. Sie ist in England«, sagte er, »und wo sie augenblicklich ist, weiß ich nicht. Lorna hat alles kaputtgemacht. Sie hat mich zerstört!«
Es klang resigniert.
»Wie alt sind Sie eigentlich?« fragte sie.
»Zweiundzwanzig. Warum fragen Sie?«
»Es gehört eigentlich zu einem Interview«, erwiderte sie. »Noch niemand hat geschrieben, wie alt Sie genau sind.«
»Wenn Sie mich nur interviewen wollen, lassen Sie mich aussteigen«, sagte David. »Ich hasse diese Fragerei.«
»Warum sind Sie mir dann nachgelaufen? Sie wissen doch, daß ich Journalistin bin«, sagte Isabel, die so viel Respekt nun auch wieder nicht vor einem aufstrebenden Genie hatte.
»Sie waren so kühl und sachlich«, sagte er nun wie ein eingeschüchterter Junge. »Sie haben nicht die Augen verdreht und Süßholz geraspelt. Wer bin ich denn schon? Lorna Wildings Produkt.«
»Oh, das möchte ich nicht sagen«, erklärte Isabel. »Ich habe Sie gestern im Konzert gehört. Sie sind David Delorme, ein sehr begabter Pianist. Ich war mit einem Freund in Ihrem Konzert«, fuhr sie nach einer kleinen Pause fort, »er ist Arzt. Er versteht von Musik mehr als ich. Er war begeistert von Ihrem Spiel. Sie brauchen also nicht zu sagen, daß Sie Lorna Wildings Produkt sind.«
»Sie kennen diese Frau nicht. Ich bin ihr Gefangener. Sie hat mich gemanagt. Sie will den Erfolg für sich verbuchen. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Das ertrage ich nicht. Wissen Sie, wie ich mir diesen Weg erkämpft habe?«
»Ja, das weiß ich. Zumindest, was man darüber lesen konnte«, sagte Isabel.
»Mein Vater war Bergarbeiter. Wir waren sechs Kinder. Eine Schwester ist gestorben vor einem Jahr. Lorna hat mir nicht gestattet, ihr zu helfen. Sie rechnet mir Tag für Tag vor, was sie in mich investiert hat.«
»Wie kam es dazu?« fragte Isabel.
David versank in Schweigen. Seine Hände verkrampften sich ineinander.
»Meinetwegen können Sie es schreiben«, stieß er hervor. »Alles können Sie schreiben. So kann ich nicht weiterleben. Wohin fahren wir?« fragte er dann aber ängstlich.
»Zu Dr. Norden, das ist mein Freund, mit dem ich im Konzert war. Sie sind wirklich am Ende, Mr. Delorme.«
»Sie können ruhig David zu mir sagen«, murmelte er.
Als sie vor Daniels Praxis standen und Isabel das Schild sah, auf dem zu lesen war, daß Dr. Feldmann Vertreter von Dr. Norden sei, erinnerte sie sich, daß er heute keine Praxis mehr abhielt. Aber sie erinnerte sich auch daran, daß er erst morgen früh zur Roseninsel fahren wollte.
»Fahren wir ein paar Stockwerke höher, da hat Dr. Norden seine Privatwohnung«, sagte sie kurz entschlossen.
Lenchen öffnete ihnen die Tür. Sehr erstaunt schaute sie drein, ziemlich klein und schmal in ihrem grauen Kleid mit der schwarzen Schürze.
»Sie sind Lenchen«, sagte Isabel burschikos, nachdem sie tief Atem geholt hatte. »Ich bin eine Bekannte von Dr. Norden und bringe einen Herrn mit, für den Daniel große Sympathie hegt.«
Um Worte war sie nie verlegen. Sie buchte es zu ihren Gunsten, daß Lenchen sie wohlwollend musterte.
»Dr. Norden ist noch unterwegs«, sagte Lenchen. »Eigentlich wollte er schon früher zurück sein. Wenn Sie warten wollen?«
Mit ihr würde ich schneller klarkommen als mit Dan, dachte Isabel. Und als David sich mit einem tiefen Seufzer in einem der weichen Sessel niedergelassen hatte, folgte Isabel Lenchen in die Diele.
»Der Herr ist ein berühmter Pianist«, erklärte sie. »Er braucht ärztliche Hilfe, sonst hätte ich Daniel nicht in seiner Privatwohnung aufgesucht.«
Lenchen blinzelte. »Ist schon gut«, meinte sie. »Ich hoffe, daß Dr. Norden bald kommt. Kann ich Ihnen etwas bringen?«
»Vielleicht Kaffee?« fragte Isabel. »Aber ich würde Ihnen gern helfen.«
»Iwo, das ist gleich getan. Vielleicht möchte der Herr Klavier spielen? Ich höre es gern.«
Als Isabel wieder den Wohnraum betrat, hatte sie das Gefühl, daß David Delorme nichts mehr hasse, als einen Flügel, so verdrossen starrte er diesen an. Nein, nicht verdrossen, sondern geradezu haßerfüllt.
»Da hat man einen Wunschtraum«, sagte er mit monotoner Stimme. »Man will ihn um jeden Preis verwirklichen, und dann erkennt man, daß der Preis zu hoch war.«
Isabel dachte sich in seine Stimmung hinein. Sie setzte sich und schlug die Beine übereinander.
»Hier wird Sie jedenfalls niemand suchen«, sagte sie. »Und Lorna Wilding wird Sie auch nicht finden. Allerdings werden wir warten müssen, bis Dr. Norden kommt.«
»Was kann ich von ihm erwarten?« fragte er.
»Sehr viel Verständnis«, erwiderte
Isabel. »Mehr, als von mir, denn er versteht mehr von Musik, als ich.«
»Hier ist es so ruhig«, flüsterte er. »Ahnen Sie, wie sehr ich mich nach Ruhe gesehnt habe? Ich möchte nicht ständig auf dem Präsentierteller herumgereicht oder wie ein Wundertier angestarrt werden. Warum ist eine Begabung so schwer mit einem normalen Leben vereinbar, Miß –, wie ist doch gleich Ihr Name?«
»Nennen Sie mich ruhig Isabel«, erwiderte sie. »Wovon träumten Sie, Mr. Delorme, als Sie zum ersten Mal ein Klavier sahen?«
Ein flüchtiges Lächeln legte sich um seinen Mund.
»Als ich zum ersten Mal ein Klavier sah«, wiederholte er sinnend. »Ach ja, Sie sind Journalistin, und ich habe gesagt, daß Sie alles schreiben können. Gut, meinetwegen, Sie sollen die erste sein, die alles erfährt. Ich war sechs Jahre, als Professor Chandelor mich mit in seine Wohnung nahm. Ich hatte ihm ein paar Besorgungen erledigt. Er war Klavierlehrer, schon ein alter Herr. Ich war fasziniert, als ich den Flügel sah. Ich glaube, es war zuerst die Decke, die sehr bunt und exotisch aussah. Der Deckel war aufgeschlagen, und ich griff in die Tasten. Der Professor sagte mir, daß ich mir erst die Hände waschen müßte. So begann es. Es war überwältigend, daß Töne unter meinen Fingern hervorquollen. Chandelor mochte Kinder. Er war alt und einsam. Er sagte, daß ich so oft zu ihm kommen könne, wie ich nur wolle. Er gab mir Unterricht.« Er machte eine Pause. »Dann sprach er mit meinen Eltern. Mein Vater wurde sehr zornig. Er sagte, daß ich besser etwas Gescheites lernen solle, weil die Lehrer sagten, daß ich intelligent sei. Aber meine Mutter war stolz, weil der Professor meinte, ich sei ein Naturtalent.«
Isabel sah, wie er sich entspannte, wie er in Erinnerungen versank und immer ungehemmter erzählte. Sie unterbrach ihn nicht. Er merkte anscheinend gar nicht, wie Lenchen den Kaffee hereinbrachte.
Er trank einen Schluck und fuhr fort. »Ich ging jeden Tag zu Chandelor. Mein Vater wußte es nicht, bis ich einmal in der Schule spielen durfte. Da war er auch stolz auf mich, weil die Eltern so begeistert waren.«
Er ist ja noch ein richtiger Junge, dachte Isabel. Ein geniales Kind.
David war in Schweigen versunken. Er hatte die Augen geschlossen.
»Und wann lernten Sie Gladys kennen?« fragte Isabel.
»Als ich achtzehn war«, erwiderte er gedankenverloren. »Da verdiente ich mir mein Geld damit, daß ich in Cafés spielte, in Teestuben, um es richtig zu sagen. Ihr Vater hatte eine solche Teestube. Er kann mich nicht leiden. Er wollte nicht, daß wir uns trafen. Genau wie Lorna. Sie haßt Gladys. Sie sagt, daß sie meine Karriere verderben würde. Lorna betrachtete mich als ihren Sohn. Sie hat ihren eigenen Sohn verloren, als er zehn Jahre alt war. Er spielte auch Klavier. – Sie ist verrückt, Isabel. Ihr Sohn hieß auch David. Sie bildet sich ein, daß ich ihr Sohn bin.«
Er sank plötzlich in sich zusammen und schlug die Hände vor sein Gesicht.
»Ich habe doch nicht gedacht, daß sie sich so in diese Idee verrennen würde«, murmelte er. »Ich habe nie gedacht, daß man mich mal als ihren Geliebten bezeichnen könnte. Das ist Wahnsinn, und wenn es so weitergeht, werde ich auch wahnsinnig.«
Isabel staunte und war bestürzt. Das schien ja ganz anders zu sein, als alle Welt vermutete, oder legte er es nur so aus, um den Schein zu wahren?
Nein, man konnte, man mußte es ihm glauben. Irgendwie war er zu naiv, um so überzeugend lügen zu können, aber immerhin war er ein Künstler, vielleicht nicht nur ein guter Pianist, sondern auch ein guter Schauspieler.
Sie wollte jetzt noch mehr über Gladys herausbekommen, aber sie ließ ihm erst ein paar Minuten zur Besinnung.
Er hob den Kopf und sah sie mit seinen nachtdunklen, schwermütigen Augen an.
»Was denken Sie von mir?« fragte er. »Daß ich hysterisch bin, daß mir der Erfolg zu Kopf gestiegen ist? Ich wollte doch nur wegen Gladys berühmt werden. Damit ihr Vater nichts mehr gegen unsere Verbindung einwenden könnte.«
»Wann haben Sie zuletzt von ihr gehört, David?« fragte Isabel, die sich plötzlich in die Rolle einer Beichtmutter gedrängt sah und so schnell nicht damit fertig wurde, denn dazu hatte sie, die alles so nüchtern sah, eigentlich kein Talent. Aber sein Vertrauen rührte sie.
»Seit ich auf Tournee bin, gar nichts mehr«, erwiderte er tonlos. »Aber ich glaube, daß Lorna es verhindert hat. Ich war ja kaum eine Minute unbewacht. War ich in meinem Hotelzimmer, wurde das Telefon abgestellt. Damit ich angeblich nur ja Ruhe hätte. Ach, es läßt sich nicht schildern. Manchmal hasse ich Lorna, dann tut sie mir leid. Sie hat so viel Geld. Sie weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Es ist doch traurig für solch eine Frau, wenn sie das einzige Kind verliert.«
Isabel dachte an die eiskalten Augen dieser Frau und empfand augenblicklich kaum Bedauern. Aber vielleicht waren diese Augen nicht immer so kalt, vielleicht nur dann, wenn jemand in Erscheinung trat, der etwas von David wollte, der etwas von seiner Zeit beanspruchte.
Gewiß war auch David Delorme augenblicklich ein Fall für einen Arzt, aber Lorna Wilding war dies möglicherweise viel mehr.
Hoffentlich kam Daniel nun bald. Sie wußte nicht mehr, was sie mit David reden sollte. Sie konnte ihn doch nicht am laufenden Band ausfragen!
Da war sie ganz unerwartet in eine verflixte Situation geraten. Sie hatte gemeint, ein interessantes Exklusivinterview von David zu bekommen, und nun saß er vor ihr wie ein hilfloses, verlorenes Kind, nicht wie ein Genie, wie ein Star, der raketenhaft am Himmel aufgegangen war.
*
Daniel sah Isabels Wagen vor dem Hause stehen. Er erkannte ihn sofort. Er war in seinem kräftigen Gelb kaum zu übersehen, und im Rückfenster klebte das Schild »Presse«.
Er runzelte die Stirn. Was wollte Isabel von ihm?
Wenige Sekunden später schloß er seine Wohnungstür auf und Lenchen, die doch so schwerhörig war, kam sogleich aus der Küche.
»Es ist Besuch da«, sagte sie, »ein Herr und eine Dame.«
Ein Herr und eine Dame, also war Isabel nicht allein gekommen. Es beruhigte ihn. Und Lenchen schien auch nicht pikiert. Das beruhigte ihn noch mehr. Sie hatte sehr moralische Ansichten.
Fassungslos blickte er dann aber David Delorme an.
»Endlich bist du da«, sagte Isabel erleichtert. »Wir warten schon lange. Das ist Dr. Norden, David!«
Es überraschte Daniel, daß sie ihn schon beim Vornamen nannte. David hatte sich erhoben und machte eine linkische Verbeugung, die deutlich seine Unsicherheit verriet.
»David braucht Hilfe«, sagte Isabel. »Er ist mit den Nerven am Ende.«
Er sah sie mißtrauisch an. Das hatte sie ihm doch gestern schon einzureden versucht. Man würde ihn fertigmachen, hatte sie behauptet.
»Soll ich erst allein mit Dr. Norden sprechen, David?« fragte Isabel.
Er nickte geistesabwesend. »Excuse me, Sir«, sagte er entschuldigend.
»Möchten Sie vielleicht ein paar Minuten auf die Dachterrasse gehen?« fragte Daniel, der sich von seiner Überraschung noch immer nicht erholt hatte.
»Sehr gern.« Als er so dahinging, wirkte er fast unscheinbar. Faszinierend wurde er wohl nur durch sein Spiel.
In ihrer kurzen, prägnanten Ausdrucksweise schilderte Isabel, was geschehen war. Es war unmißverständlich.
»Das kann ja wirklich zu einer Psychose ausarten, bei ihm wie auch bei Lorna Wilding«, sagte Daniel nachdenklich. »Aber was soll ich mit ihm machen? Ich kann ihn doch nicht einsperren? Verbergen kann ich ihn auch nicht.«
»Oh, ich hätte da aber schon eine Idee«, sagte Isabel. »Die Insel der Hoffnung!«
»Sollen wir gleich mit einem Skandal beginnen?« fragte er irritiert.
»Ärzte haben Schweigepflicht, und du hast mir erzählt, daß dort niemand unter seinem Namen in Erscheinung treten soll. Allein der Mensch gilt.«
»Er ist aber doch schon ein bekannter Mann«, wendete er ein
»Auf dem Podium. Aber wenn er einem auf der Straße, in einem gewöhnlichen Anzug begegnet, erkennt man ihn doch kaum«, erklärte Isabel. »Ich wäre bestimmt an ihm vorbeigelaufen.«
»Erst werde ich mich mit ihm unterhalten«, sagte Daniel. »Meine Zeit ist heute aber sehr begrenzt. Ich muß noch viel erledigen. Das ist ein Tag«, fügte er seufzend hinzu. »Ich gehe jetzt zu ihm.«
»Kannst du dich allein mit ihm verständigen?« fragte Isabel.
»Na, hör mal, soviel englisch werde ich doch noch zusammenbringen«, lächelte er. »Ganz einseitig bin ich ja auch nicht begabt.«
Aber David war vor allem davon angetan, daß Daniel soviel von Musik verstand. Seine Miene lockerte sich, und er war plötzlich wie umgewandelt.
»Sie glauben ja nicht, was es bedeutet, mal wieder mit einem Menschen reden zu können.«
»Es reden doch sicher viele Menschen mit Ihnen«, sagte Daniel.
»Menschen? Ich weiß nicht. In mir sehen sie doch auch keinen Menschen. Ich passe nicht in diese Welt. Man wird so schnell hineinprogrammiert und dann ebenso schnell wieder fallengelassen.
»Aber jetzt machen Sie doch viele Menschen mit Ihrer Musik glücklich«, sagte Daniel.
»Die sie wirklich verstehen, wie ich sie verstehe, fallen nicht über mich her«, sagte David. »Ja, für diese Menschen spiele ich. Ich sage es mir immer wieder, bevor ich mich an den Flügel setze, sonst hätte ich gleich nach den ersten Konzerten kapituliert. Man will mich zu einem Star machen, aber ich werde nie einer werden. Ich bin in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und selbst mein Vater konnte mich nicht verstehen. Wie sollte er es auch. Für ihn war ich auch ein Wundertier. Und ich möchte doch nur gern so spielen, wie ich fühle.«
»Das müssen Sie auch, sonst werden Sie unglücklich, David«, sagte Daniel. »Sie können gar nicht glücklich sein ohne Ihre Musik.«
»Aber es darf niemand hinter mir stehen und mich hetzen. Ich ertrage
diesen Zwang nicht. Ich war Lorna dankbar, als sie Interesse an mir nahm, aber ich konnte doch nicht ahnen, daß es in ein Besitzergreifen ausarten würde.«
»Vielleicht empfindet sie es gar nicht so. Man muß es ihr begreiflich machen.«
»Ich kann das nicht. Sie ist mir so überlegen. Ich möchte auch nicht undankbar erscheinen. Ich brauche einfach Ruhe, um nachzudenken und wieder zu mir selbst zu kommen.«
Und da machte ihm Daniel doch den Vorschlag, die Insel der Hoffnung aufzusuchen.
»Es klingt gut«, sagte David gedankenvoll. »Aber was wird Lorna sagen?«
»Jemand wird es ihr klarmachen. Vielleicht Isabel. Aber zuerst werden wir ihr nur eine Mitteilung übersenden. Wie lange haben Sie Zeit bis zum nächsten Konzert?«
»Zwei Wochen.«
»Das geht ja schon.«
»Aber Lorna wollte mit mir an die Riviera fahren«, sagte David leise. »Sie hat dort ein Haus.«
»Das wäre nun gerade nicht das Richtige«, meinte Daniel. »Aber entscheiden müssen Sie.«
»Ja, ich bedenke es und danke Ihnen. Ich möchte diese Insel der Hoffnung kennenlernen. Ich brauche Hoffnung. Es könnte doch ein langes Leben vor mir liegen. Wie soll ich es durchstehen, wenn ich jetzt schon auf schwankendem Boden stehe.«
Das sah er wenigstens klar. Daniel fand das gut.
»Wenn Sie wollen, können Sie bei mir bleiben«, sagte er. »Sie können morgen mit mir oder mit Isabel fahren, sofern sie Zeit hat. Und Isabel muß halt mit Mrs. Wilding sprechen. Ich muß mich noch um Patienten kümmern, aber Lenchen wird sich um Sie kümmern, wenn ich es ihr sage.«
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Dr. Norden«, sagte David. »Ich habe jetzt wirklich schon etwas mehr Hoffnung.«
*
Sehr erbaut war Isabel von dem Vorschlag nicht, daß sie Lorna Wilding informieren sollte. »Natürlich sagst du ihr nicht, wo er hinfährt«, sagte Daniel.
»Da habe ich mir etwas Schönes eingebrockt«, seufzte sie.
»Das hattest du schon, als du ihn mitnahmst, aber du gehörst doch nicht zu denen, die etwas nur anfangen und nicht zu Ende führen, Isabel.«
»Du kennst Lorna Wilding noch nicht.«
»Schüchtert sie sogar dich ein, Isabel?« fragte er anzüglich. »Dann muß ich sie aber kennenlernen.«
»Wenn ich nicht mit ihr fertig werde, schicke ich sie zu dir.«
»Heute aber nicht. Ich habe keine Minute mehr übrig und morgen bin ich Gott sei Dank über alle Berge.«
»Feigling«, sagte sie.
»Nein, Isabel. Dr. Neubert liegt im Sterben und mein guter Franz Glimmer hat eine schwere Operation vor sich.«
»Und du leidest mit, Daniel«, sagte Isabel leise.
»Ja, da leide ich mit. Ich kann es nicht ändern.« Seine Stimme klang rauh und wieder einmal dachte Isabel, was er doch für ein seltsamer, unergründlicher Mensch sei.
»Dann will ich nicht klein erscheinen«, sagte sie. »Ich übernehme Mrs. Wilding. Meinst du, daß David durchhält?«
»Gut wäre es natürlich, wenn man seine Gladys auftreiben könnte, aber weiß man denn, ob dies nicht auch nur eine Vorstellung ist?«
»Wieso Vorstellung?«
»Er denkt an das Mädchen, das seine erste Liebe war, aber er hat sich seither sehr verändert. Vielleicht hat Gladys auch längst einen andern. Frauen haben doch so wenig Geduld.«
»Wirfst du alle in einen Topf, Daniel?«
»Nein, es gibt Ausnahmen, aber das sind keine Lieben, sondern Freunde, so wie du.«
Und damit habe ich mich abzufinden, dachte Isabel resigniert. Dabei hatte sie ihn noch nie so sehr gemocht wie an diesem Tag. Vielleicht war es auch Liebe, von ihrer Seite. Sie wollte sich in solche Gedanken nicht hineinvertiefen. Vielleicht war Daniel ein Mann, der gar nicht nur einen Menschen lieben konnte, weil er mit so vielen fühlte, weil er die Hilflosen, Kranken und zum Sterben Verdammten liebte.
Jedenfalls hatte sie zum ersten Mal richtig begriffen, daß er zum Arzt geboren war, daß er seinen Beruf nicht als Broterwerb betrachtete sondern als eine Aufgabe, für die ihn eine höhere Macht auserwählt hatte.
»Ich mag dich sehr, Daniel«, sagte sie leise. »Du bist ein Mensch«, und die Betonung legte sie auf das letzte Wort.
»Ich mag dich auch sehr, Isabel«, sagte Daniel. »Jetzt lerne ich dich erst richtig kennen.«
*
Daniel fuhr zuerst ins Kreiskrankenhaus zu Dr. Neubert.
»Es geht zu Ende«, sagte der Chefarzt. »Die Lähmung wäre zu beheben gewesen, aber das Herz will nicht mehr. Es ist müde.«
»Es hat zuviel gelitten«, sagte Daniel.
Der Chefarzt sah ihn verwundert an.
»Er stand Ihnen nahe, Herr Kollege?« fragte er.
Daniel störte es, daß er schon in der Vergangenheitsform sprach, obgleich noch Leben in Dr. Neubert war.
»Er steht mir nahe«, berichtigte er. Er setzte sich an das Bett und ergriff die Hand des Greises. Jetzt mußte man ihn so nennen, obgleich er nie greisenhaft gewesen war. Aber halb war er schon von dieser Welt entfernt. Doch seine Augenlider hoben sich, und er sah Daniel an.
»Dr. Neubert, erkennen Sie mich?« fragte Daniel.
Der Kranke neigte leicht den Kopf.
»Daniel, mein Junge«, sagte er recht deutlich. Daniel spürte den schweren Atem des Chefarztes in seinem Nacken. Es störte ihn.
»Ich lasse Sie allein«, sagte der nun jedoch.
»Es wird wieder aufwärts gehen, Dr. Neubert«, sagte Daniel. »Sie haben mich erkannt.«
»Es geht zu Ende. Ich will noch etwas sagen, Daniel.« Mühsam kamen die Worte über die blassen Lippen. »Dein Vater war mein Freund und ein wunderbarer Mann. Werde so wie er, mein Junge. Alles, was ich besaß, soll dir gehören, damit du sein Lebenswerk vollenden kannst. Ich habe es so bestimmt. Hab Dank, daß du noch immer für mich Zeit hattest. Es waren schöne Stunden. Werde glücklich, mein Junge. Glücklicher als dein Vater und ich.«
Dann schlossen sich die Lippen, und die Lider senkten sich. Kraftlos war die Hand, die Daniel hielt. Stumm saß er da. Er hatte den alten Herrn gern gehabt, aber er hatte nicht geahnt, daß Dr. Neubert ihm so tiefe väterliche Zuneigung entgegengebracht hatte.
Frohen Herzens würde er morgen nun nicht zur Insel der Hoffnung fahren können. Er fragte sich, warum gerade an diesem Vortag soviel auf ihn eingestürmt war.
Abermals traf ihn dann ein verwunderter Blick aus den kühlen Augen des Chefarztes, als er erklärte, daß er sich um Dr. Neuberts Beerdigung kümmern werde.
»Er hat keine Angehörigen mehr«, sagte er geistesabwesend.
Der Rest des Tages wurde eine einzige Hetze. Fahrt zur Universitätsklinik, um die Unterlagen von Franz Glimmer Professor Manzold zu bringen, dann mußte er zu dem Beerdigungsinstitut. Die Zeit rannte nur so davon. Zu Frau Krüger, die Dr. Neuberts Haushalt versorgt hatte, mußte er er noch fahren. Auch dort gab es Tränen.
Es war zehn Uhr, als er endlich heimkam. Aus seiner Wohnung tönte ihm leises Klavierspiel entgegen.
Die »Pathetique« von Beethoven, Töne voller Melancholie, und doch fühlte Daniel sich dadurch wie erlöst. Für einen Freund, den er an diesem Tage verloren hatte, gab ihm das Schicksal einen andern. David Delorme war geblieben. Mit einem Blick voller Dankbarkeit wurde er von ihm begrüßt, während er weiterspielte.
»Isabel wird mich morgen zu Ihrer Insel der Hoffnung bringen«, sagte David dann. »Sie hatten einen anstrengenden Tag, Dr. Norden.«
»Sagen Sie ruhig Daniel.« Er reichte ihm die Hand. »Und nun werden wir zu Bett gehen.«
Er wollte jetzt gar nicht mehr wissen, was Isabel erreicht oder nicht erreicht hatte. David wußte auch noch nichts. Lenchen hatte das Gästezimmer schon hergerichtet.
Sie wollte morgen nicht mitfahren, das war schon längst abgemacht. Einer müsse hierbleiben, hatte sie gesagt. Später einmal würde sie sich alles ansehen.
Sie hatte den Tod Dr. Friedrich Nordens noch nicht verwunden. Sie schmerzte es, daß er die Verwirklichung seines Wunschtraumes nicht mehr erleben konnte.
Aber das Leben geht weiter, dachte Daniel. Es ist unausbleiblich, daß wir manchen zu Grabe tragen müssen, der uns nahesteht, bis wir einmal selbst an der Reihe sind.
*
Isabel hatte sich vorerst nicht mit Lorna Wilding in Verbindung gesetzt. Schließlich war David ein erwachsener, mündiger Mann, der über sich selbst bestimmen konnte.
Doch kaum hatte sie ihre Wohnung betreten, läutete das Telefon. Ihr höchster Chef verlangte erregt sie zu sprechen. Isabel konnte sich denken, daß Lorna Wilding bereits Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatte.
»Kommen Sie in meine Privatwohnung, Isabel«, verlangte Johannes Peltzer. Dieser Ton duldete keinen Widerspruch. Sie kannte ihn zur Genüge.
Nun gehörte sie gewiß nicht zu jenen, die einer scharfen Auseinandersetzung ängstlich aus dem Wege zu gehen gedachten, aber im Interesse von David war es ihr doch ein wenig ungemütlich.
Johannes Peltzer bewohnte einen supermodernen Bungalow. Isabel mochte das Haus nicht. Ihm fehlte all die Wärme, die sie in Daniels Heim gefunden hatte.
Johannes Peltzer, ein hagerer, hochgewachsener Mann, der Prototyp des Intellektuellen, machte den Eindruck eines gereizten Tigers.
»Was ist Ihnen da nur eingefallen,
Isabel?« fauchte er sie an. »Mrs. Wilding ist hier. Meine Frau versucht sie zu beruhigen. Was glauben Sie, was uns diese Geschichte für Schwierigkeiten bereiten wird.«
»Will Mrs. Wilding solche machen?« fragte Isabel ironisch. »Sie können mich entlassen. Dann gehe ich zur Konkurrenz und verkaufe ihnen eine Geschichte, nach denen sich alle die Finger schlecken werden.«
Das war scharfes Geschütz. Bestürzt starrte Peltzer sie an.
»Mrs. Wilding ist außer sich. Sie fühlt sich für David Delorme verantwortlich.«
»Er ist erwachsen«, erklärte Isabel gelassen. »Ich kann es verstehen, daß er nicht als Gefangener leben will. Ich habe ihn nicht beeinflußt. Er hat mich gebeten, ihn mitzunehmen. Er war am Ende mit seinen Nerven. Er wäre auch ohne meine Hilfe davongelaufen und wer weiß, wo er dann gelandet wäre.«
»Und wo befindet er sich jetzt?« fragte ihr Chef.
»Darüber Auskunft zu geben, bin ich nicht berechtigt, aber ich bin gern bereit, mit Mrs. Wilding zu sprechen. Ich glaube nicht, daß sie einen Skandal heraufbeschwören will, wenn ihr jemand mal vernünftig klarmacht, was sie da eigentlich anrichtet.«
»Immerhin hat sie David Delorme berühmt gemacht«, sagte Peltzer.
»Er wäre auch ohne sie berühmt geworden, etwas langsamer vielleicht, dafür aber ohne seines inneren Friedens beraubt zu werden. Das werde ich Mrs. Wilding gern erklären, falls ich nicht fristlos entlassen bin.«
»Sie bringen es fertig und gehen zur Konkurrenz«, knurrte Johannes Peltzer gereizt.
»Gewiß, ich kann es mir noch nicht leisten, mich zur Ruhe zu setzen. Ich muß mir meine Brötchen verdienen«, erklärte Isabel kühl. »Ich lasse mich jedenfalls auch von einer Lorna Wilding nicht einschüchtern.«
Das bewies sie. Lorna Wilding, die sogleich eine Flut von Anklagen auf sie häufte, schwieg dann ganz erschrocken, als Isabel ihr das Wort abschnitt.
»Wir wollen bei den Tatsachen bleiben, Mrs. Wilding«, sagte sie. »Ich habe Mr. Delorme in keiner Weise beeinflußt, das Hotel und Sie zu verlassen. Es ist sein freier Wille, sich in ärztliche Behandlung zu begeben, und er braucht vor allem Ruhe. Er ist nun mal kein Partylöwe. Ihn macht es krank, auf dem Präsentierteller herumgereicht zu werden. Wenn Ihnen so viel an diesem Jungen liegt, sollten Sie vor allem um seine Gesundheit besorgt sein.«
»Ich habe alles für ihn getan, alles«, sagte Lorna Wilding bebend.
»Was das Geld anbetrifft, wird er Ihnen alles auf Heller und Pfennig zurückzahlen, aber Sie können ihn doch nicht als Ihr Produkt betrachten. Seine Begabung ist ihm von Gott gegeben. Er ist dankbar, daß Sie ihn gefördert haben, aber er möchte sich frei entfalten können. Wenn Sie auch zu dieser Einsicht kommen, werden Ihre Beziehungen vielleicht besser sein als je zuvor.«
»Für mich war er wie ein Sohn«, sagte Lorna Wilding bebend.
Isabel blickte sie nachdenklich an. »Hätten Sie Ihren Sohn auch so von sich abhängig gemacht, meinen Sie nicht, daß er dann auch eines Tages aufbegehrt hätte? Jeder Mensch hat das Recht auf ein eigenes Leben, Mrs. Wilding. David ist unerhört begabt, aber er ist kein Schlagersänger, der Publicity braucht. Er ist zu sensibel.«
»Was hat er vor?« fragte Mrs. Wilding.
»Er wird in ein Sanatorium gehen, wo er die Ruhe findet, die er braucht. Er wird seine Verträge einhalten. Wenn Sie so mütterlich für ihn empfinden, sollten Sie dafür Verständnis haben.«
»Hätte er nicht selbst mit mir darüber sprechen können?« begehrte Lorna nochmals auf.
»Hätten Sie ihm Verständnis entgegengebracht? Sie haben doch bereits vorgeplant, nicht nur für die Ferien, sondern für sein künftiges Leben. Er ist in seinem Innern ein schlichter Mensch geblieben. Lassen Sie ihm das doch. Er braucht keine äußeren Eindrücke. Seine Impulse kommen aus seinem Innern. Denken Sie doch einmal daran, daß er ein Kind aus einer Arbeiterfamilie ist. Niemand hat ihn gefördert, als er ein Kind war. Niemand hat ihn an ein Klavier gesetzt. Von selbst ist er dorthin gegangen.«
»Und daraus wollen Sie jetzt wohl eine interessante Story machen?« fragte Lorna.
»Nur, wenn Sie ihm jetzt keine Ruhe lassen. Dann wird er nämlich nicht mehr auf dem Podium erscheinen und sein Publikum müßte erfahren, warum es dazu gekommen ist. Überlegen Sie sich das einmal, Mrs. Lorna Wilding.«
Dann verabschiedete sich Isabel. Johannes Peltzer begleitete sie hinaus.
»Sie haben auch vor nichts und niemandem Respekt«, stellte er fest, aber das klang eher anerkennend als verweisend. »Sprechen wir morgen in aller Ruhe miteinander.«
»Wochenende, Chef«, sagte Isabel. »Ich bin nicht da.«
»In Sachen David Delorme?« fragte er.
»In Privatangelegenheiten«, erwiderte Isabel.
»Aber das mit der Konkurrenz war doch nur ein Schreckschuß?«
»Das muß ich mir allerdings noch reiflich überlegen«, erwiderte Isabel mit einem hintergründigen Lächeln. »Ich lasse mich auch nicht gern bevormunden, genau wie David.«
»Sie haben sich doch nicht etwa in ihn verliebt?« fragte Peltzer.
»Gott bewahre.« Dann verschwand sie endgültig.
*
An sich war Daniel Norden ein Frühaufsteher, aber ausgerechnet heute gelang es ihm nur mit aller Anstrengung, den Schlaf abzuschütteln.
Da er nicht daran dachte, daß er einen Gast in der Wohnung hatte, rumorte er recht lautstark im Bad herum.
Ein noch verschlafener David erschien in der Diele. Er sah ein bißchen verschüchtert und sehr verlegen aus.
»Sie brauchen sich nicht zu beeilen«, sagte Daniel. »Isabel holt Sie gegen elf Uhr ab. Sie hat gestern abend noch mal angerufen. Sie holt noch Ihre Koffer aus dem Hotel.«
»Und was sagt Lorna dazu?« fragte David.
»Das wird Isabel Ihnen schon erzählen. Nur keine Aufregung. Jetzt wird hübsch langsam getreten.«
Mit dem zerzausten Haar wirkte David wirklich noch wie ein Junge. Lenchen hatte in ihm ein Objekt gefunden, das sie so richtig bemuttern konnte.
Mit ihrer üblichen Ermahnung, nicht zu schnell zu fahren und vorsichtig zu sein, verließ Daniel das Haus. Pünktlich halb neun Uhr holte er Helga Moll ab. Er wechselte ein paar freundliche Worte mit ihrer resoluten Mutter, die das Regiment hier schon übernommen hatte. Peter und Katrin waren schon in der Schule, und Sabine schlief noch. Sie hatte samstags frei.
»Sabine hat einen neuen Schwarm«, erzählte Molly auf der Fahrt zu Frau Seidel.
»Nicht mehr ihren Lutz?« fragte Daniel ziemlich überrascht.
»Eine Dame«, lächelte Molly. »Sie kennen sie. Isabel Guntram.«
»Ist es die Möglichkeit. Immerhin hat sie da ein gutes Vorbild«, sagte Daniel.
»Gestern war allerhand los in der Redaktion. Sabine war ganz hingerissen, wie souverän Frau Guntram die Situation beherrschte. Eine Frau von Format.«
»Ja, das ist sie«, sagte Daniel. »Sie bringt heute auch noch einen Patienten zur Insel.«
»Doch nicht etwa diesen David Delorme?« fragte Molly überrascht.
»Genau den. Er war heute nacht mein Gast. Heute werde ich ihn dem guten Cornelius anvertrauen.«
»Das ist doch aber noch ein ganz junger Mann«, sagte Molly fassungslos.
»Das Lebensalter allein ist nicht ausschlaggebend, Molly«, meinte Daniel nachsichtig.
»Hoffentlich gibt es da keinen Ärger«, überlegte Molly. »Dr. Cornelius ist doch sehr korrekt.«
»Aber in erster Linie Arzt, Molly. So, nun wollen wir mal unsere gute Frau Seidel einladen.«
Sie wartete schon, aber dennoch schien sie es noch immer nicht glauben zu können, daß sie mitgenommen wurde.
Daniel Norden nahm ihren Arm. »Haben Sie gedacht, ich würde Sie auf Ihren Koffern sitzen lassen?« fragte er lächelnd.
»Sie sind so gütig«, murmelte sie. »Womit habe ich das nur verdient.«
Daniel wurde ein bißchen rot. Gütig, du lieber Himmel, das war wohl doch ein zu großartiges Wort
»Sie haben sich doch Ferien wirklich verdient, Frau Seidel«, sagte er, während er ihre beiden Koffer im Wagen verstaute. »Wann waren Sie denn das letzte Mal verreist?«
»Liebe Güte, das ist wohl vierzig Jahre her«, erwiderte sie. »Im Bayerischen Wald war ich da mit meinem Mann. Es kann auch schon länger zurückliegen.«
»Dann wird es ja Zeit, daß Sie mal in eine andere Umgebung kommen«, meinte er.
Wie sie sich freute, konnte man von ihrem Gesicht ablesen. Ganz still saß sie und blickte unentwegt zum Fenster hinaus. Als die Berge vor ihnen auftauchten, machte Frau Seidel zum ersten Mal den Mund auf.
»So schön ist die Welt«, sagte sie andächtig. »Einmal müßte man so hoch da droben stehen können.«
»Sie können ja mal mit der Bergbahn hinauffahren, wenn Sie sich getrauen«, sagte Daniel. »Aber von unten sieht es auch ganz hübsch aus.«
Nach zwei Stunden Fahrt kamen sie zur Roseninsel. Der Dunst hatte sich aufgelöst. Unter strahlendem Sonnenschein lag sie vor ihnen.
Auch Daniel hielt den Atem an und fuhr ganz langsam über die schmale Landzunge. Die Insel der Hoffnung, ein wahres Paradies! Malerisch eingefügt in diese romantische Landschaft lagen die Häuser.
»Himmlisch«, flüsterte Molly.
Frau Seidel fuhr sich mit dem Taschentuch über die Augen. Und Daniel dachte jetzt nur an seinen Vater.
*
»Sie kommen, Fee«, sagte Dr. Cornelius zu seiner Tochter.
»Pünktlich ist er wenigstens«, sagte Felicitas spöttisch.
»Worauf beruhen deine Vorurteile gegen Daniel eigentlich?« fragte er sinnend.
»Vielleicht darauf, daß er alles dir überlassen hat, Paps«, sagte sie. »Im Erfolg wird er sich dann sonnen.«
»So ist es nicht. Du siehst es falsch«, sagte Dr. Cornelius.
»Na, wir werden es ja sehen«, sagte Felicitas. »Soll ich die Belegschaft zusammentrommeln, damit er auch gebührend begrüßt wird?«
»Unsinn, das mag Daniel doch gar nicht«, sagte ihr Vater.
Er ging den Ankommenden entgegen. Felicitas blieb zurück, aber sie warf doch einen verstohlenen Blick aus dem Fenster. Ihre Augen weiteten sich, als Daniel der alten Frau Seidel aus dem Wagen half.
»Hier bringe ich dir die erste Patientin, Hannes«, sagte er zu dem Älteren. Früher hatte er noch Onkel gesagt, aber das hatte er dann eingestellt. So gewaltig war der Altersunterschied zwischen ihnen nicht, und wenn man Dr. Cornelius betrachtete, nahm man ihm seine sechzig Jahre ohnehin nicht ab.
»Das freut mich aber«, sagte Dr. Cornelius, als er in das liebe Gesicht der alten Frau blickte. Frau Seidel lächelte verschämt. »Es ist zuviel der Ehre«, murmelte sie.
Dr. Cornelius begrüßte Molly, die ihm wohlbekannt war.
»Ich bin hingerissen«, sagte sie. »Das ist eine ganz andere Welt.«
»Erst anschauen«, sagte Dr. Cornelius, »dann loben oder kritisieren.«
Eine Kritik konnte nur wohlwollend sein. Das mußte auch Daniel zugeben, der alles nur im Rohbau gesehen hatte und damals noch nicht den richtigen Eindruck gewinnen konnte. Doch jetzt war wirklich alles traumhaft schön. Nicht nur die Seerosen blühten, sondern auch die Rosenstöcke in bunter Farbenpracht.
Noch zeigte sich kein Mensch. Daniel war erleichtert, daß ihnen kein offizieller Empfang bereitet wurde. Dafür hatte er nichts übrig. Aber daß auch Felicitas sich noch nicht blicken ließ, kränkte ihn doch ein wenig, wenn er es sich auch nicht eingestehen wollte. Es war ja nicht so, daß sie sich fremd waren. Ihre Väter waren die engsten Freunde gewesen, und sie kannten sich von Kindheit an. Vielleicht war der Altersunterschied von neun Jahren doch ein bißchen groß, aber Daniel konnte sich noch gut an die Zeit erinnern, als er fünfzehn und Felicitas sechs gewesen war. Da war sie zutraulich gewesen, da hatte sie ihn ihren besten Freund genannt. Und es war einige Jahre auch so geblieben, bis sie dann heranwuchs und sie sich nur noch manchmal sahen, weil sie im Internat war und er schon auf der Universität.
»Wir brauchen nicht gleich alles auf einmal anzusehen«, sagte Molly. »Vielleicht möchte Frau Seidel sich ein wenig ausruhen.«
Sie fühlte, daß Daniel gern mit seinem väterlichen Freund allein sprechen wollte. Er mußte ihn auch auf David Delormes Kommen vorbereiten.
Während sich Frau Seidel auf einer Bank niederließ, gingen die beiden Herren auf das langgestreckte Gebäude zu, in dem sich die Behandlungsräume befanden.
»Es wird dir hoffentlich nicht unangenehm sein, daß heute gleich noch ein Patient kommt«, sagte Dr. Norden.
»Du hast es aber eilig«, schmunzelte der Ältere. »Aber mir soll es recht sein.«
»Es hat sich so ergeben«, sagte Daniel. »Frau Seidel wollte ich eine Freude machen. Sie war meine erste Patientin, und ich betrachte sie als eine Art Maskottchen.«
»Immerhin lobenswert, daß du dir dafür ein altes Mütterchen ausgesucht hast«, sagte Johannes Cornelius.
»Ihr Aufenthalt geht natürlich auf meine Kosten«, sagte Daniel.
Dr. Cornelius warf ihm einen schrägen Blick zu. »Hast du deswegen gleich auch einen zahlenden Gast hergeschwatzt?« fragte er belustigt. »Von kommerziellen Dingen wollten wir unsere Tätigkeit doch nicht bestimmen lassen.«
»Aber draufzahlen sollst du auch nicht, Hannes«, sagte Daniel.
»Wer zahlt denn bis jetzt drauf? Doch nur du. Ich verstehe nicht ganz, warum das unerwähnt bleiben soll.«
»Ohne dich wäre Vaters Wunschtraum nicht zu verwirklichen gewesen. Ich habe einfach nicht das Format, ein Sanatorium zu leiten.«
»Daß du dein Licht immer unter den Scheffel stellen mußt. Okay, Dan, wir haben uns geeinigt. Jeder tut auf seinem Platz seine Pflicht, aber es wäre doch eine große Freude für mich, wenn ich es noch erleben könnte, daß du mit mir zusammenarbeitest. Wer also ist der zahlende Gast?«
»David Delorme.«
»Waaas?« fragte Dr. Cornelius gedehnt. »Donner und Doria, wie hast du das fertiggebracht?«
»Er ist mir sozusagen zugelaufen«, erwiderte Daniel lächelnd.
Nachdenklich blickte ihn Dr. Cornelius an. »Fee wird staunen«, sagte er. »Delorme ist ihr Schwarm.«
»Soso«, sagte Daniel, doch da stand schon Felicitas in der Tür.
Lässig reichte sie Daniel die Hand. »Was ist mit Delorme?« fragte sie.
»Er wird heute noch hier eintreffen«, erklärte Daniel mit einem sarkastischen Unterton. »Zu deiner Freude, wie ich soeben vernahm.«
»Ausgerechnet hierher? Wieso?« fragte sie verwirrt.
Sie sah bezaubernd aus. Glatt und seidig umfloß das silberblonde Haar ihr feines Gesicht, in dem große violette Augen leuchteten. Dieses Leuchten galt wohl Delorme, dachte Daniel. Felicitas gab ihm viele Rätsel auf. Hastig begann er zu erzählen, wie es zu der Bekanntschaft mit Daniel gekommen war. Natürlich mußte er dabei auch Isabel erwähnen.
»Wird deine Freundin auch über Nacht hierbleiben?« fragte Felicitas anzüglich.
»Das weiß ich nicht. Isabel trifft ihre Entscheidungen allein«, erwiderte Daniel im gleichen Ton.
Warum gehen sie nur immer wie Kampfhähne aufeinander los, dachte Dr. Cornelius. Früher haben sie sich doch gut verstanden. Gab es da etwas zwischen den beiden, von dem er nichts wußte?
»Ich werde dich jetzt mit meinen Mitarbeitern bekannt machen«, lenkte er schnell ab.
Da war zuerst Dr. Jürgen Schoeller, einunddreißig Jahre, nur ein paar Zentimeter kleiner als Daniel, schlank, mittelblond und sehr sympathisch. Er hatte eine leise, angenehm dunkle Stimme, ging aber sparsam mit seinen Worten um.
Allerdings hatte er sich den Dr. Daniel Norden auch etwas anders vorgestellt. So, wie er vor ihm stand, wirkte er mehr wie ein Sportsmann und nach
Felicitas’ Bemerkungen hatte Jürgen Schoeller einen Salonlöwen erwartet. Dadurch war er wohl etwas irritiert.
Dann lernte Daniel Anne Fischer kennen, die Sekretärin von Dr. Cornelius, deren Erscheinen.Wärme verbreitete.
Daniel war überrascht, als Dr. Cornelius sagte, daß sie eine alte Bekannte von ihm sei.
Aber in der nächsten halben Stunde lernte er so viele Gesichter kennen, daß er über den einzelnen nicht nachdenken konnte.
Und dann versammelten sie sich alle in der Halle und gedachten Daniels Vater. Mit warmen, zu Herzen gehenden Worten würdigte Dr. Cornelius Dr. Friedrich Norden als einen wahren Menschenfreund.
Dann enthüllte er dessen Büste, die er hatte anfertigen lassen. Auch dies war für Daniel eine Überraschung. Seine Kehle war wie zugeschnürt.
Er ging auf Dr. Cornelius zu und sagte: »Ich danke dir, Hannes.« Dann wandte er sich um und fuhr fort: »Ich danke Ihnen allen, die dazu beitragen wollen, daß ein großer Gedanke verwirklicht wird.«
*
David Delorme hatte es nicht begreifen wollen, als Isabel tatsächlich mit seinen Koffern gekommen war.
»Wie haben Sie das fertiggebracht,
Isabel?« fragte er.
»Ich habe mich mit Mrs. Wilding geeinigt. Sie will natürlich nicht, daß Ihre Karriere allzu schnell wieder beendet wird, David. Aber ich denke, daß sie jetzt auch nachdenken wird.«
»Es wäre gut, sehr gut für mich«, sagte David leise. »Ich bin ihr sehr zu Dank verpflichtet. Auch dann, wenn ich ihr das Geld zurückgezahlt habe.«
»Wissen Sie, David, ich bin da anderer Ansicht. Man soll doch nicht geben, wenn man zeitlebens dafür Dank erwartet.«
»Aber ist das nicht selbstverständlich?« fragte er irritiert.
»Vielleicht habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt. Ich meine es so, daß man sich weder mit Großzügigkeit, noch mit persönlichem Opfer einen ganzen Menschen kaufen kann. Mrs. Wilding hat wohl erwartet, daß Sie sich ihr für alle Zeiten verpflichtet fühlen. So ist es doch?«
»Ich weiß nicht. Ich will gerecht sein. Ja, ich habe mich in meinen Entscheidungen eingeengt gefühlt. Aber sie hat es doch gutgemeint.«
Das wird sich herausstellen, dachte Isabel und wechselte das Thema. Sie sprachen über Daniel Norden. David fragte, ob sie das Sanatorium kenne.
»Nein, Dan hat mir nur davon erzählt. Lassen wir uns überraschen, David!«
Und wie waren sie überrascht, als sie dorthin kamen. Selbst die so realistisch denkende Isabel wurde eingefangen von der Atmosphäre. David konnte gar nichts sagen. Mit geweiteten Augen nahm er in sich auf, was sich seinen Augen darbot.
Dann kam ihnen Felicitas entgegen. Sie hatte den Wagen kommen hören, als Daniel und ihr Vater noch vor Friedrich Nordens Büste standen.
Isabel betrachtete das bezaubernde junge Mädchen verblüfft. Daniel hatte nie von Felicitas Cornelius gesprochen und Felicitas merkte, wie überrascht Isabel war, als sie ihren Namen nannte.
»Daniel hat Ihr Kommen bereits angekündigt. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Mr. Delorme«, sagte sie. »Sie natürlich auch, Frau Guntram«, fügte sie dann überstürzt und verlegen hinzu, weil es ihr doch gar zu unhöflich erschien, Isabel in die Begrüßung nicht einzubeziehen.
Aber ein unerklärliches Gefühl hatte von Felicitas Besitz ergriffen, denn unbeeindruckt von dieser Frau konnte sie nicht bleiben.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Fräulein Cornelius«, sagte Isabel, doch alle Höflichkeit, alle Verbindlichkeit konnten nicht darüber hinwegtäuschen, daß zwischen ihnen eine Wand stand. Warum, wußte Isabel nicht zu sagen.
Bei dem Sektfrühstück wurden Gegensätzlichkeiten überbrückt. Nicht nur zwischen Daniel und Felicitas, zwischen ihr und Isabel bestanden solche, auch Dr. Schoeller war plötzlich merkwürdig reserviert. Das aber fiel eigentlich nur Dr. Cornelius auf, der seine Blicke gedankenvoll umherschweifen ließ.
Anne Fischer unterhielt sich mit Molly, Daniel bemühte sich um Frau Seidel, die noch immer wie ein verschüchtertes Vögelchen wirkte.
Isabel blickte in Gedanken versunken auf das blankgeputzte Messingschild, das neben dem Eingang befestigt war. »Dr. med. Johannes Cornelius.« Sie lachte plötzlich leise auf.
Dr. Cornelius sah sie erstaunt an. »Warum lachen Sie?« fragte er.
»Weil mein Chef auch Johannes heißt«, erwiderte Isabel, »und weil ich nie zwei verschiedenere Männer kennengelernt habe, als Sie und ihn.«
»Den Vornamen bestimmen die Eltern«, sagte Dr. Cornelius, »nicht der Charakter.«
»Sie haben ganz gewiß auch nur den Vornamen mit ihm gemeinsam«, sagte sie gedankenvoll.
»Kann man das nach so kurzer Zeit des Kennens bereits verbindlich sagen?« fragte er.
»Nun ja, ich möchte einräumen, daß mein Chef auch seine guten Seiten hat«, erklärte Isabel.
»Wenn ich dies als Kompliment für mich betrachten kann, bedanke ich mich«, sagte Johannes Cornelius mit einem feinen Lächeln.
»Das können Sie. Sie haben etwas ganz Wunderbares geschaffen. Wenn mich die Hetze zu sehr beansprucht, werde ich mich auch einmal hier ausruhen.«
»Es war ganz allein die Idee von Daniels Vater«, sagte Dr. Cornelius sinnend. »Und Dan hat das meiste dazu beigetragen, daß diese Idee auch verwirklicht werden konnte.«
»Das wußte ich nicht«, sagte Isabel leise. »Er hat immer nur von Ihnen gesprochen.«
»Und das ist mir gar nicht recht. Nein, es gefällt mir nicht. Auch wenn er es nicht will, muß es erwähnt werden, daß Daniel den größeren Beitrag geleistet hat.«
Er hatte es voller Leidenschaft ausgesprochen und Felicitas, die mit David Delorme langsam herangekommen war, blieb wie angewurzelt stehen. Dr. Cornelius bemerkte seine Tochter zu spät.
»Es wäre doch besser, hätte ich es nicht gesagt«, murmelte er. »Daniel wollte es nicht.«
»Und warum nicht, Paps?« fragte Felicitas.
»Ich glaube, den Grund zu kennen«, sagte Isabel. »Er hat viel mehr Gemüt, als man ihm zutraut. Er wird zu sehr nach seinem Äußeren eingeschätzt.«
Dunkle Glut schoß in Felicitas’ Wangen. Aha, dachte Isabel, sie gehört auch zu jenen, die ihn als Playboy oder Modearzt einstufen. Doch dann geriet sie ins Nachdenken. Es konnte auch möglich sein, daß Felicitas Cornelius ihm aus unerfindlichen Gründen nicht mehr zutrauen wollte. Ob Eifersucht der Grund war? Eifersucht vielleicht auch auf sie, Isabel? Unwillkürlich mußte Isabel lächeln.
»Gefällt es Ihnen hier, Mr. Delorme?« fragte Dr. Cornelius.
»Es ist wundervoll. Ich bin schon weit weg von der lauten Welt«, erwiderte David. »Ich fühle mich wie im Paradies.«
*
»Vielleicht wäre der Name Paradies noch mehr ins Ohr gegangen«, sagte Felicitas, als sie sich am Abend im Speisesaal wieder versammelten.
Ihr Vater warf ihr einen fast erschrockenen Blick zu.
»In seinen Gedanken hat mein Freund Friedrich Norden dieses Stück Erde ›Insel der Hoffnung‹ genannt«, sagte er, »und wir dachten nie daran, ihm einen anderen Namen zu geben.«
Felicitas erblaßte. Das war ein deutlicher Verweis.
»Und zu dieser Stunde möchte ich auch einmal ganz offiziell zur Kenntnis geben, daß mir nicht das Verdienst zugeschrieben wird, daß diese Insel der Hoffnung mit dem heutigen Tage jedem offen steht, der fernab von allem Getriebe Ruhe und Genesung sucht. Mein lieber Daniel, du mußt es mir verzeihen, daß ich dies erkläre, aber ich kann meine Arbeit nicht aufnehmen, ohne dir für dein Vertrauen zu danken.«
»Muß das sein, Hannes?« warf Daniel mit heiserer Stimme ein.
»Ja, das muß sein. Dein Vater war mein Freund. Leider konnte er diesen Tag nicht erleben. Aber du bist auch mein Freund, und ich kann deine Verdienste nicht schmälern. Es würde mich Tag für Tag verfolgen, daß ein Mensch, ein Patient oder wer immer es sein mag, denken könnte, daß ich allein dies vollbracht hätte. Und jetzt möchte Frau Seidel, unsere erste Patientin, ein paar Worte sagen.«
Da stand sie, schmal und klein und jetzt doch nicht mehr so verschüchtert.
»Was soll ich anderes sagen, als daß ich Dr. Norden so unendlich viel zu verdanken habe«, tönte ihre Stimme vernehmbar durch den Raum. »Welcher Arzt kümmert sich heutzutage schon um eine alte Frau, die nichts besitzt und keine hohen Rechnungen bezahlen kann. Dr. Norden hatte immer Zeit für mich. Und nun hat er mir auch noch diese große Freude bereitet.«
Tränen rannen über ihre Wangen und vor Rührung und Ergriffenheit konnte sie nicht mehr weitersprechen.
Daniel war aufgestanden und ging zu ihr. »Sie haben es gut gemeint, Frau Seidel«, sagte er leise, dann ging er mit schnellen Schritten hinaus.
»Mußte das sein, Paps?« fragte Felicitas ihren Vater.
»Frau Seidel wollte ihre Dankbarkeit ausdrücken«, erwiderte Dr. Cornelius. »Aber ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei, Fee. Wir werden uns noch einmal sehr ernsthaft unterhalten müssen. Es mag sein, daß dir die Reife oder das Verständnis fehlt.«
»Frau Guntram bringt es ihm sicher entgegen«, sagte Felicitas mit bebender Stimme, denn sie sah, daß nun auch
Isabel hinausging.
»War das falsch?« fragte Frau Seidel Molly, die neben ihr saß. »Ist Dr. Norden mir jetzt böse?«
»Aber nein, Frau Seidel«, sagte Molly tröstend. »Unser Doktor mag nur keine Ovationen.«
*
Isabel war Daniel gefolgt. Sie legte ihre Hand auf seine Schulter.
»So kenne ich dich gar nicht, Dan«, sagte sie sanft. »Warum sollte unausgesprochen bleiben, was wahr ist?«
»Warum muß gesagt werden, was selbstverständlich sein sollte, Isabel?« fragte Daniel leise.
»Ich verstehe Dr. Cornelius und ich verstehe auch Frau Seidel. Ich bin ganz ihrer Meinung, auch wenn es dir nicht behagt. Idealismus ist gut, aber allzu edel brauchst du auch nicht zu sein.«
»Ich bin nicht edel«, sagte Daniel aggressiv. »Fang du bloß nicht auch noch damit an. Herrgott, Isabel, nennen wir doch die Dinge mal beim Namen. Ich bin als Kind wohlhabender Eltern geboren worden. Ich habe nie zu kämpfen brauchen, wie zum Beispiel David Delorme, oder auch du. Mußtest du kämpfen?«
»Und wie«, erwiderte Isabel.
»Na, siehst du. Du und David habt es in jungen Jahren zu etwas gebracht. Die gute Frau Seidel nie. Die Güter des Lebens sind ungerecht verteilt.«
»Du bist ein seltsamer Zeitgenosse, Dan«, sagte Isabel nachdenklich.
»Wieso denn? Weil ich nach einem Ausgleich strebe? Soll es mir noch besser gehen, als jetzt? Ich habe doch alles. Ich führe ein sehr angenehmes Leben und brauche keine Opfer zu bringen.«
»Aber du vergißt die Ärmeren nicht«, sagte sie.
»Und das muß an die große Glocke gehängt werden? Das ist doch Unsinn. Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr. Warum mußte Hannes davon anfangen?«
»Vielleicht, um seiner Tochter einen Nasenstüber zu geben«, sagte Isabel.
Daniel sah sie bestürzt an. »Er liebt Fee doch über alles.«
»Deshalb muß er doch nicht alles akzeptieren, was sie tut und denkt.«
»Du magst Fee nicht?« fragte Daniel.
»Ich finde sie reizend«, erklärte Isabel lächelnd, »aber sie verkennt dich. Allerdings gäbe es auch noch eine andere Erklärung fiir ihre Widerspenstigkeit.«
»Welche?«
»War einmal etwas zwischen euch?«
Daniel sah sie bestürzt an. »Du liebe Güte, nein. Sie ist doch kein Mädchen, mit dem man flirtet und es wieder beiseite schiebt.«
»Nein, das ist sie gewiß nicht.«
»Ich kenne sie von Kindheit an, aber du darfst nicht übersehen, daß ich neun Jahre älter bin als sie.«
»Vielleicht gefällt es ihr nicht, daß du sie noch immer als Kind betrachtest.«
»Das ist übertrieben. Sie hat ihr Medizinstudium bereits beendet. Für ein Mädchen wahrhaft eine Leistung. Aber lassen wir das Thema, Isabel.«
Es war ihm unbequem. Er hatte heute ohnehin schon mehr als je zuvor über Felicitas nachdenken müssen, als er sie neben David sitzen sah. Er schien ihr sehr zu gefallen, und obgleich es kaum einen größeren Kontrast im Äußeren zwischen zwei Menschen geben konnte, er wirkte neben ihrer blonden Schönheit fast wie ein Zigeuner, schien es manche Gemeinsamkeiten zwischen ihnen zu geben.
Vielleicht brauchte sie einen Partner, der sensibel war wie sie selbst und der ganz auf sie einging.
»Na, hoffentlich verliebt sich unser Schützling nun nicht in die blonde Fee vom Rosensee«, sagte Isabel mit leichtem Spott.
Sie wußte nicht, daß Fee diese Worte hörte und auch Daniels Erwiderung darauf. »Warum nicht?« sagte er betont gleichmütig.
Felicitas ballte ihre schmalen Hände zu Fäusten, so fest, daß sich die Fingernägel schmerzhaft in ihre Handflächen gruben.
Wäre sie noch ein paar Sekunden stehengeblieben, hätte sie hören können, wie Isabel sagte: »Ich denke, daß dir das gar nicht so gleichgültig wäre, wie du tust, Dan.«
»Und was denkst du noch?« fragte er sarkastisch.
»Daß du eifersüchtig bist.«
»Jetzt muß ich aber wirklich lachen.« Doch das Lachen klang ziemlich gequält, und dann ging er wieder hinein.
Man konnte es als unhöflich bezeichnen, daß er Isabel einfach stehen ließ, aber sie nahm es ihm nicht übel. Sie hatte in dieser Stunde jede Hoffnung begraben, daß sie Daniel einmal mehr sein könnte als nur eine Freundin. Nur? War Freundschaft nicht etwas Wunderschönes? Konnte sie am Ende nicht wertvoller sein als eine Liebe, die doch keinen Bestand hatte?
Gedankenverloren ging sie durch den Park. Die Stille umfing sie, teilte sich ihr mit und brachte ihre zwiespältigen Empfindungen zum Schweigen.
Noch jemand suchte diese Ruhe. Ganz plötzlich stand Dr. Schoeller vor Isabel. Sie war richtig erschrocken, als er hinter dichten Büschen vor ihr auftauchte.
»Verzeihung«, sagte er höflich, »ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich dachte nicht, daß noch jemand hier draußen wäre.«
»Es ist ein herrlicher Abend«, sagte Isabel. »Ich wollte ihn genießen, bevor ich morgen in die laute, dunstige Stadt zurückkehre.«
»Die Sie aber brauchen«, sagte Dr. Schoeller.
Verwundert sah sie ihn an. »Ja, sicher brauche ich sie. Auf dem Lande passieren keine aufregenden Dinge, über die man schreiben könnte.«
»Müssen es denn aufregende Dinge sein?« fragte er. »Wollen Sie nicht über die Insel der Hoffnung schreiben?«
»Wenn Daniel es mir erlauben würde, gern. Aber ich fürchte, er wird es nicht erlauben. Die Neugierde würde wohl allzuviele hierhertreiben und der eigentliche Zweck wäre dann verfehlt.«
»Wir werden keine Neugierigen hier aufnehmen. Nur solche, die wahrhaft Hilfe brauchen. Darf ich mir übrigens die Frage gestatten, ob Mr. Delorme tatsächlich zu jenen gehört, die Hilfe brauchen?«
Etwas in seinem Tonfall ließ sie aufhorchen. In der warmen, dunklen Stimme des Arztes klang eine gewisse Aggressivität.
»O doch, er brauchte Ruhe und Entspannung. Ich will nicht sagen, daß er krank ist, nicht organisch krank, aber die menschliche Seele braucht manchmal auch Hilfe.«
»Gewiß, in erster Linie sogar«, erwiderte Dr. Schoeller. »Allerdings macht Mr. Delorme einen recht ausgeglichenen Eindruck.«
Was hat er gegen ihn, dachte Isabel. Dann kam ihr blitzartig ein Gedanke. Gefiel es ihm nicht, daß Felicitas sich so mit David beschäftigte?
»Doch, ich kann Ihnen rechtgeben. Schon die ersten Stunden auf der Insel der Hoffnung wirken sich günstig auf sein Seelenleben aus. Er ist der Hetze entflohen.«
»Die Menschen haben selbst schuld, wenn sie sich hetzen lassen. Wofür denn? Die Jagd nach Geld und Ruhm kann doch keine innere Zufriedenheit bringen.«
Isabel betrachtete ihn forschend.
»Waren Sie jemals arm?« fragte sie nachdenklich.
Er lächelte flüchtig. »Arm an Geld schon«, erwiderte er. »Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, Reichtümer zu sammeln. Allerdings sehe ich auch nicht den Sinn meines Lebens darin.«
»Dann sind Sie zufrieden, mit dem, was Sie haben«, sagte Isabel.
»Ich bin glücklich, daß ich jetzt hier sein darf. Etwas Schöneres konnte ich mir gar nicht wünschen. Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden?«
»Doch, natürlich«, erwiderte Isabel, aber als sie es ausgesprochen hatte, wußte sie, daß es nicht stimmte. Aber was ging das diesen Dr. Schoeller an. Außerdem hatte sie denn Grund, unzufrieden zu sein?
Hatte sie nicht erreicht, was sie wollte? Nein, das Ziel, das sie sich gesteckt hatte, war noch immer nicht erreicht. Einmal wollte sie ganz unabhängig sein und nur das tun, was ihr Spaß machte. Aber auf die Annehmlichkeiten des Lebens wollte sie dafür nicht verzichten.
Als sie dann später in einem der hübschen, anheimelnden Häuser, in einem gemütlich eingerichteten Zimmer, das gar nichts mit der Nüchternheit eines Krankenzimmers gemein hatte, in einem breiten bequemen Bett lag, wanderten ihre Gedanken zurück zu jenem Tag, als sie als Volontärin ihren Weg begonnen hatte, wie jene Sabine Moll. Und ganz plötzlich kam es ihr in den Sinn, warum ihr der Name so bekannt vorgekommen war. Molly, Daniels treue Molly hieß Moll. Sollte Sabine ihre Tochter sein? Das wäre schon ein seltsamer Zufall. Und damit zerflossen ihre Gedankengänge auch schon, und Isabel sank in tiefen, traumlosen Schlummer.
Auch Frau Seidel war gleich eingeschlafen. Für sie war dieser Tag zugleich aufregend, himmlisch schön und beglückend gewesen. Ihr Dr. Norden hatte sie höchstpersönlich zu diesem wundervollen Zimmer geleitet, das sie nun vier Wochen bewohnen durfte. Vier Wochen im Paradies, worauf sollte sie noch hoffen am Ende eines Lebens? Etwas Schöneres konnte ihr nicht mehr widerfahren.
David Delorme hing anderen Gedanken nach. Auch er fühlte sich frei, aber er dachte an Lorna Wilding. Vielleicht würde auch sie hier, fern von Hektik und Betriebsamkeit, ihre innere Ruhe finden. Er wünschte sie nicht herbei, aber es wurde ihm bewußt, daß sie eine zu bedeutungsvolle Rolle in seinem Leben gespielt hatte, als daß er sich von einem Tag zum andern von ihr befreien konnte. Selbsterkenntnis sei der erste Schritt zur Besserung, hatte Isabel auf der Fahrt zu ihm gesagt; doch das hatte sie in bezug auf Lorna gemeint. Auch für ihn würde es gut sein, zur Selbsterkenntnis zu gelangen, denn schuldlos war er wohl nicht daran, daß Lorna soviel Macht über ihn gehabt hatte.
Hatte es ihm anfangs nicht gefallen, daß er sich nicht mehr Schritt für Schritt vorankämpfen mußte, daß sie ihm alle Erschwernisse aus dem Wege räumte, daß ihr Name, ihr Ansehen ihm Türen und Tore öffnete?
Was hatte denn Gladys gesagt? Was hatte sie ihm zugetraut? Doch nicht allzuviel. Er sei ein Phantast, hatte sie gesagt, und sie hatte ihn nicht gehen lassen wollen. Hatte nicht auch sie ihn auf ihre Weise zu einem Leben zwingen wollen, in dem er nicht glücklich geworden wäre?
Ja, Selbsterkenntnis allein konnte ihm nützen und ihn befähigen, den goldenen Mittelweg einzuschlagen, an sich zu arbeiten, langsam und stetig voranzuschreiten, zu lernen, die Menschen und die Welt mit klaren Augen zu sehen.
*
Während alle schon schliefen, saßen Dr. Cornelius und Daniel noch beisammen. Sie hatten schließlich auch einige geschäftliche Dinge zu besprechen.
»Im Laufe der nächsten Woche werden zwanzig Patienten eintreffen«, erklärte Dr. Cornelius. »In vier bis sechs Wochen werden wir voll belegt sein.«
»Du mußt mich auf dem laufenden halten, Hannes, damit ich auch disponieren kann. Ich habe einige Fälle, die ich dir anvertrauen möchte.«
»Das ist doch selbstverständlich«, sagte Dr. Cornelius.
»Wirst du mit einem Assistenten zurechtkommen?« fragte Daniel.
»Vorerst schon. Später kann man noch einen dazu nehmen. Aber Schoeller ist sehr zuverlässig, und ein zweiter Arzt müßte auf seiner Linie liegen. Gefällt er dir?«
»Schoeller. Gewiß. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck.«
»Er ist ein guter Psychologe, das ist sehr wichtig. Ich hoffe, daß ich mit der Auswahl unserer Mitarbeiter die richtige Nase hatte. Es genügt schon, wenn die Patienten kommen und gehen. Wechsel im Personal mag ich nicht besonders.«
»Es sind immerhin ein paar junge hübsche Schwestern darunter. Sie werden nicht ewig bleiben. Und Fee?« Er unterbrach sich und blickte auf den Teppich.
»Sie freut sich auf die Aufgaben, die hier auf sie warten. Sie verspürt nicht den Drang nach der großen weiten Welt.«
»Wenn nicht einer kommt, der sie entführt in die große weite Welt«, sagte Daniel nachdenklich. Wenn er nicht jetzt schon gekommen ist, dachte er für sich weiter. Und ich, ausgerechnet ich, habe ihn auch noch hergebracht.
»Warum seid ihr eigentlich wie Hund und Katze?« fragte Johannes Cornelius sehr direkt.
»Frage mich nicht. Ich weiß nicht, was Fee gegen mich hat.«
»In gewisser Beziehung ist sie noch ein bißchen unreif«, sagte Dr. Cornelius. »Sie trägt es dir nach, daß du lieber deine Stadtpraxis behältst. Da hat sie irgendwas aufgeschnappt, daß du ein Modearzt seiest. Und gegen solche ist sie voreingenommen.«
»Das ist doch Blödsinn. Ich schicke keinen Patienten weg. Meint sie vielleicht auch, daß es ein Gag von mir war, daß ich Frau Seidel hergebracht habe? Dann kann ich ja nur froh sein, daß David Delorme zur gleichen Zeit gekommen ist. An ihm scheint sie ja tatsächlich einen Narren gefressen zu haben.«
Dr. Cornelius blinzelte zu Daniel hinüber. Ein rätselhaftes Lächeln legte sich um seinen schmalen Mund.
»Eines hat sie jedenfalls mit dir gemeinsam, Dan, die Liebe zur Musik. Du bist doch auch begeistert von seinem Spiel. Das ist Fee ebenfalls.«
»Er ist ein faszinierender junger Mann«, sagte Daniel, »und Fee ist ein bezauberndes Mädchen.«
»Aber zu klug, um sich Hals über Kopf zu verlieben.«
»Dagegen ist der Klügste nicht gefeit«, sagte Daniel.
»Darf ich mal fragen, wie du zu der sehr attraktiven Isabel stehst?« fragte der Ältere.
»Wir sind Freunde. Du brauchst mich gar nicht so skeptisch anzuschauen, Hannes. So unklug bin ich nicht, mit einer solchen Frau einen heißen Flirt anzufangen. Sie imponiert mir. Sie steht mit beiden Beinen fest im Leben. Ich habe wirklich nicht die Absicht, mich zu binden. Lenchen versorgt mich gut. Warum sollte ich heiraten?«
Dr. Cornelius lachte leise. »Nun, vielleicht deshalb, um eine Familie zu haben«, meinte er.
»Für die ich keine Zeit hätte?«
»Immerhin bist du jetzt vierunddreißig. Ich finde, daß es das richtige Alter ist, sich nach einer Frau umzusehen. Nach der richtigen Frau, meine ich, denn ganz achtlos wirst du an ihnen ja nicht vorübergehen.«
»Es kann ja auch sein, daß diejenige, die ich für die Richtige halte, gegenteiliger Ansicht ist«, sagte Daniel gedankenvoll. »Was soll’s, Hannes. Mein Beruf füllt mich aus. Ich nehme ihn ernst, wenn man es mir auch nicht glauben will.«
»Ich glaube es dir«, sagte Johannes Cornelius voller Wärme.
*
Es schien, als solle es auf der Insel der Hoffnung einen turbulenten Anfang geben. Der nächste Morgen fing jedenfalls gleich so an.
Es kam ein Anruf für Molly. Sie hatte für alle Fälle ihre Telefonnummer daheim zurückgelassen. Sabine war am Telefon. Sie konnte kaum sprechen, so erregt war sie, aber schließlich begriff Helga Moll doch, daß Peter nicht nach Hause gekommen war, nachdem er sich am Nachmittag mit seinem Vater getroffen hatte.
Molly war einer Ohnmacht nahe. Sie ließ sich selbst von Daniel nicht beruhigen.
»Ich muß nach Hause, ganz egal wie«, sagte sie. »Meine Mutter dreht durch.«
»Ich bringe Sie heim, Molly«, sagte Daniel, obgleich es hier noch Wichtiges zu besprechen gegeben hätte.
»Nein, ich bringe Frau Moll zurück«, sagte Isabel. »Ich habe ohnehin nicht vorgehabt, den ganzen Tag hierzubleiben. Ich habe noch zu tun.«
Felicitas warf ihr einen erstaunten Blick zu. Dann trat David an Isabel heran.
»Darf ich Sie bitten, Lorna Grüße von mir auszurichten?« fragte er leise.
Isabel war betroffen. War er wankelmütig? Wußte er nicht, was er wollte? Fürchtete er gar, seine Mäzenin für immer zu verlieren?
»Ich muß ihr doch danken, daß sie meine Sachen herausgegeben hat«, erklärte er scheu. »Und dann ist mir schon vieles durch den Kopf gegangen. Die Zeit der Selbstbesinnung ist gut, aber nicht ganz so gut ist es, einfach davonzulaufen und sich vor einer Aussprache zu drücken.«
»Wollen Sie eine Aussprache, David?« fragte Isabel. »Soll Lorna Sie besuchen?«
»Ich möchte so gern, daß sie mich versteht. Denken Sie nicht, daß ich es bereue, diesen Schritt getan zu haben. Hier sehe ich alles nur ganz anders. Aber es mag ja sein, daß sie mich schon abgeschrieben hat.«
»Und wenn sie versöhnlich gestimmt ist, falls Sie sofort zu ihr zurückkehren?« fragte Isabel.
»Nein, das tue ich nicht. Ich bleibe hier. Ich fühle, daß es gut für mich ist.«
»Es tut mir so leid, daß ausgerechnet ich alles durcheinander bringen muß«, sagte Molly zu Dr. Norden.
»Sie doch nicht«, sagte er beschwichtigend. »Eine Mutter hat es wahrhaftig nicht leicht.«
»Wenn die Kinder so einen verantwortungslosen Vater haben, gewiß nicht«, flüsterte sie. »Ich weiß nicht, wozu ich fähig bin, wenn er Peter auf die schiefe Bahn bringt, oder wenn dem Jungen gar etwas zugestoßen ist.«
»Ruhe bewahren, Molly«, sagte Daniel Norden. »Wenn ich heute abend zurück bin, rufe ich an.«
»Mach du dir keine Gedanken, Dan«, sagte Isabel. »Ich kümmere mich um Frau Moll.«
*
Insel der Hoffnung, eine Oase des Friedens, ein Paradies, und doch wurde es jedem jäh bewußt, daß eine Vielzahl menschlicher Schicksale den Alltag beherrschen würden. Froh würde kaum ein Mensch sein, der diese Insel betrat. Kranke, Verzweifelte und am Leben Verzagte würden hier Genesung suchen, und so zufrieden und glücklich wie Frau Seidel würde kaum einer den ersten Tag genießen können.
Mit ihrem lieben, dankbaren Wesen erwarb sie sich gleich aller Sympathie, auch die von Felicitas, die sich ihrer Zweifel zu schämen begann, als Frau Seidel ihr erzählte, wie sie zu diesem Aufenthalt gekommen war.
»Ich habe es gar nicht glauben können«, sagte Frau Seidel. »Immer wieder habe ich mich gefragt, warum ausgerechnet mir diese Ehre zuteil wird. Er ist ein so gütiger Mensch, unser Herr Dr. Norden. Wenn man so alt ist wie ich und so vielen Menschen begegnet ist, weiß man das erst richtig zu schätzen.
Das erste Mal habe ich mich gar nicht so richtig in seine Praxis getraut, aber die Frau Glimmer hat mir zugeredet. Sie haben eine Tankstelle, und das Haus, in dem ich wohne, gehört ihnen. Es sind auch nette Leute. Sie haben mir die Miete nicht erhöht, wie es andere getan hätten. Was soll man denn heute machen, wenn man nur eine kleine Rente bekommt? Ja, Frau Glimmer hat gesagt, daß ich doch zu Dr. Norden gehen soll, als ich es so mit dem Ischias hatte, daß ich kaum noch laufen konnte. Der hilft Ihnen schon, Frau Seidel. – Ich rede wohl ein bißchen viel?« fragte sie dann verlegen.
»Nein, erzählen Sie nur, Frau Seidel. Dr. Norden hat Ihnen also geholfen.«
Felicitas war neugierig geworden, was Frau Seidel noch so alles über Daniel erzählen würde.
»Vernünftig geredet hat er halt mit mir, so wie kein anderer. Ausheilen kann man das ja nicht mehr, wenn man so alt geworden ist und sich nie um seine Wehwehchen kümmern konnte. Aber wenn die Schmerzen arg werden, dann kommt er gleich, da läßt er mich nie warten, und dann hilft es einem ja auch schon, wenn jemand so nett mit einem redet. Und nun darf ich hier sein, das ist noch wie ein Traum. Ich kann es dem Dr. Norden ja gar nicht vergelten, ich kann ihm nur viel, viel Glück wünschen. Gell, ich kann es sagen. In meinem Alter kann man da in keinen falschen Verdacht mehr geraten.«
So war Daniel also aus der Sicht einer alten Frau. Daniel, der Menschenfreund!
Warum will ich mich nur in die Idee verrennen, daß alles Berechnung bei ihm ist, überlegte Felicitas mit einem Gefühl der Beklemmung. Weil es eine
Isabel gibt und sicher auch noch andere Frauen?
Einmal hatte sie ihn in München in der Oper mit einer bildschönen, exotisch aussehenden Frau gesehen, und sie waren ein aufsehenerregendes Paar gewesen. Da hatte es sie gepackt. Da hatte sich in ihr eine Flamme des Zornes entzündet. Nein, es war nicht nur Zorn gewesen, sondern ohnmächtige Wut. Hätte er denn nicht auch mal auf den Gedanken kommen können, sie zu einem Opernbesuch einzuladen?
Mein Gott, ich bin ja eifersüchtig, schoß es ihr durch den Sinn. Eifersüchtig auf jede Frau, sogar auf seine Patientinnen. Ganz heiß wurde es ihr bei diesem Gedanken. Und gerade da kam er aus dem Haus und auf sie zu.
»Lieb von dir, daß du dich um Frau Seidel kümmerst, Fee«, sagte er.
»Es ist doch selbstverständlich«, erwiderte sie leise. »Wir haben uns sehr gut unterhalten.«
»Na, Frau Seidel, Sie haben doch nicht etwa wieder Loblieder auf mich gesungen?« fragte er scherzend.
»Ich sage nur, was wahr ist«, meinte Frau Seidel.
Er nahm den Arm der alten Frau. »Gehen wir zwei nun ein Stück spazieren?« fragte er. »Fee, dein Vater hätte dich gern gesprochen.«
Felicitas errötete. Daniel hatte sie nie anders als Fee genannt, aber erst heute wurde es ihr so richtig bewußt. Unwillkürlich mußte sie an Isabels Bemerkung denken. »Die Fee vom Rosensee«. Wie hatte sie sich darüber geärgert! Aber wenn Daniel sie so nannte, klang es anders.
Sie schaute ihnen nach, wie er langsam mit Frau Seidel am Arm dahinging, und da drehte er sich noch einmal um, als spüre er ihren Blick. Es war ein ganz merkwürdiger Ausdruck in seinen Augen. Ihr Herz begann stürmisch zu klopfen.
*
»Setz dich, Fee«, sagte Dr. Cornelius zu seiner Tochter. »Ich möchte etwas mit dir besprechen.«
»Ich kann es mir schon denken, Paps. Du erwartest von mir, daß ich Daniel mehr entgegenkomme.«
»Unsinn. Was heißt entgegenkommen? Du sollst dich vernünftig benehmen und nicht so, als wäre er mein Rivale. Aber darum handelt es sich nicht. Es gibt in München einiges zu erledigen. Daniel hat keine Zeit dafür. Du wolltest Anfang der Woche doch sowieso hinfahren wegen deiner Promotion.«
»Am Mittwoch, Paps«, warf Felicitas ein.
»Ich möchte dich bitten, heute mit Daniel zu fahren. Dann kannst du das alles bis Mittwoch erledigen. Es ist für dich auch bequemer, und ich brauche nicht die Sorge zu haben, daß dir etwas passiert.«
»So schlecht fahre ich ja nun weiß Gott nicht«, begehrte Felicitas auf. »Außerdem habe ich in München dann keinen Wagen.«
Sie konnte sich nicht erklären, warum ihr Vater diesen Vorschlag machte, der sie in tiefste Verwirrung stürzte, nachdem sie eben noch so eigenartigen Gedanken nachgehangen hatte.
»Es handelt sich um die Beerdigung von Dr. Neubert«, erklärte ihr Vater. »Daniel hat noch nichts davon gesagt, um hier den Einstand nicht zu stören.«
»Dr. Neubert ist tot?« fragte Felicitas. Sie war tief erblaßt.
»Ja, es hat Dan sehr getroffen, daß er gerade jetzt sterben mußte, da er sich doch so auf unsere Insel gefreut hatte. Ich kann nicht weg. Er war uns allen ein guter Freund, und ich möchte nicht gern, daß Dan allein an seinem Grab steht. Siehst du das ein?«
»Es tut mir entsetzlich leid, Paps«, flüsterte Felicitas. »Ich habe ihn doch auch gern gehabt. Ich verstehe, daß es Daniel sehr nahe gegangen ist. Aber ihm merkt man ja nichts an. Nie merkt man ihm eine Gefühlsregung an.«
»Er ist ein Mann, mein liebes Kind. Ein hundertprozentiger Mann, kein labiler Künstler. Nichts gegen David Delorme, aber gar so zu engagieren brauchtest du dich auch nicht.«
»Warum bist du so aggressiv, Paps? Du tust ja gerade so, als wolle ich eine Liebesaffäre beginnen.«
»Dagegen hätte ich allerdings allerlei einzuwenden«, sagte Dr. Cornelius brummig.
»Beruhige dich. Ich habe nicht die Absicht.«
»Aber vielleicht hat er solche.«
»Werde jetzt nur nicht komisch, Paps. David hat eine große Liebe.«
»Tatsächlich? Na, dann her mit ihr.«
»Die ist bei ihm. Es ist die Liebe zur Musik. Er ist sich nur nicht klar darüber, daß dies einstweilen seine einzige Liebe ist.«
Dr. Cornelius runzelte die Stirn. »Meine Tochter als Psychologin«, seufzte er.
»Das hatte ich jedenfalls schnell heraus«, sagte Felicitas. »Aber er ist dein Patient, nicht meiner. Also, ich soll heute mit Daniel nach München fahren«, lenkte sie ab.
»Bist du bereit?«
»Ja«, erwiderte sie kurz.
»Und wirst du ihn nicht ankläffen?«
»Du bist vielleicht höflich«, sagte sie. »Kläffe ich?«
»Deine Bemerkung gestern abend hat mir gar nicht gefallen, Fee«, sagte er ernst.
»Es tut mir leid, Paps. Man sagt manches unüberlegt. Warum hast du mir auch nie gesagt, was Daniel beigetragen hat?«
»Weil er es nicht wollte. Er denkt überaus sozial, Fee. Wenn alle Menschen so denken würden, gäbe es keine so schreckliche Not. Ich muß gestehen, daß ich diesbezüglich viel von ihm gelernt habe. Aber wenn man eine solche Einstellung hat wie er, will man dafür nicht hervorgehoben werden. Es ist ihm zu selbstverständlich.«
»Ein kärgliches Leben braucht er ja nicht zu führen«, sagte Felicitas aggressiv, weil sie einfach nicht eingestehen wollte, daß sie tief beeindruckt war.
»Das wäre auch zuviel verlangt. Warum sollte er das? Er arbeitet recht hart. Er gibt das, was er nicht braucht. Es ist eine sehr anerkennenswerte Einstellung, finde ich. Andere horten ihr Vermögen und werden immer knauseriger.«
»Wieso hat er dich dann aber überhaupt gebraucht, Paps«, fragte Felicitas.
Dr. Cornelius ging zum Fenster. »Sein Vater hatte diese Idee«, sagte er leise. »Ihm gehörte die Insel. Ihm gehörte noch mehr. Ein paar Häuser und Grundstücke, die er aber für seinen Sohn erhalten wollte. Die Idee hat Friedrich fasziniert, aber er hätte sie nie verwirklicht, weil er das Risiko fürchtete. Daniel hatte solche Bedenken nicht. Er hat alles verkauft und alles in die Verwirklichung dieses Wunschtraums seines Vaters gesteckt. Mein Beitrag dagegen ist gering. Nun weißt du es, aber schwöre mir, daß du Daniel nichts davon sagst.«
»Ich werde mich hüten. Er springt mir ins Gesicht«, sagte Felicitas. »Aber sage mir, warum er dir den Ruhm lassen will, warum dein Name hier an diesem Hause steht und nicht seiner?«
»Weil für ihn etwas gilt, was andere nur zu ihrem eigenen Nutzen gebrauchen, Fee. Freundschaft! Für ihn bleibe ich der beste Freund seines Vaters, weil ich mich für die Idee begeisterte, und jetzt bin ich sein Freund. Daniel hatte seine Bedenken, solange sein Vater lebte. Erst danach war er bereit, die Idee zu verwirklichen, auf sein Risiko wohlgemerkt. Er hat alles eingesetzt, und wenn es ein Fiasko wird, verliert er alles.«
»Aber es kann doch gar kein Fiasko geben«, sagte Felicitas erregt.
»Kennen wir die Menschen? Wie viele gibt es denn noch, die Ruhe und Frieden suchen? Die meisten rennen doch dem Vergnügen nach. Sie wollen etwas haben für ihr Geld. Sie wollen die Welt sehen!«
»Du hast also Bedenken, daß die Insel der Hoffnung keinen Gewinn abwirft«, sagte Felicitas leise.
»Gewinn, was heißt schon Gewinn, aber wenn wir nur draufzahlen, ist es nicht zu halten. Ich habe Daniel getäuscht. Es liegen noch nicht so viel
Anmeldungen vor, wie ich gesagt habe.«
»Wir haben doch auch noch gar keine Reklame gemacht«, sagte Felicitas.
»Das will er doch nicht. Er hält mehr von der Mund-zu-Mund-Empfehlung.«
Eine Weile war Schweigen zwischen ihnen, dann sagte Felicitas: »Immerhin ist der erste zahlende Gast David Delorme.«
»Was ist bei ihm schon zu heilen«, sagte Dr. Cornelius. »Seine Komplexe?«
»Oh, Paps, Komplexe sind manchmal sehr schwer zu heilen«, meinte Felicitas.
Sie legte ihre Arme um seinen Hals und lächelte zu ihm empor. »Wir beide haben ja auch welche«, sagte sie leise.
»Ich, wieso habe ich Komplexe?« fragte Dr. Cornelius.
»Daß die Insel der Hoffnung ein Fiasko werden könnte.«
»Und welche hast du?«
»Das verrate ich dir später einmal, aber ich habe eine ganze Menge«, erwiderte Felicitas.
*
»Wo ist eigentlich Frau Fischer?« fragte Daniel, als er Anne beim gemeinsamen Mittagessen vermißte.
»Sie holt ihre Tochter«, erklärte ihm Johannes Cornelius. »Eine tragische Geschichte, Katja hatte im Winter einen Skiunfall. Sie kann seither nicht mehr gehen.«
»Querschnittslähmung?« fragte Daniel.
»Nein, das ist es nicht. Eine Nervensache. Sie geriet mit ihrem Verlobten in eine Lawine. Er kam dabei um. Sie wurde gerettet. Der Schock muß sie gelähmt haben. Für Anne ist das alles natürlich schrecklich. Ein halbes Jahr zuvor hat sie ihren Mann durch einen Herzinfarkt verloren. Er war übrigens auch Arzt. Sie hat Katja von einem Spezialisten zum andern geschickt, doch keiner konnte dem Mädchen helfen. Die Lebensversicherung ging dabei drauf und auch das kleine Vermögen. Wir haben Kollegen, mein lieber Dan, die verflixt hohe Honorare verlangen.«
»Wir werden Frau Fischer doch hoffentlich auch ein gutes Gehalt zahlen«, meinte Daniel. »Werde ich die Tochter noch kennenlernen?«
»Kaum. Wahrscheinlich werden sie erst morgen kommen.«
»Teile mir bitte deine Diagnose mit, Hannes«, sagte Daniel.
»Du wirst mir doch nicht mehr zutrauen als den Kapazitäten?«
»Wer weiß. Wir wollen ja nicht nur an etwaige Honorare denken, und manchmal hilft der gesunde Menschenverstand weiter als Erkenntnisse der Schulmedizin.«
»Junge, Junge, du gibst mir immer wieder neue Probleme auf«, sagte Dr. Cornelius. »An was denkst du?«
»An Akupunktur.«
»Hast du dich denn damit auch befaßt?« fragte der Ältere staunend.
»Meine Neugierde ist schwer zu befriedigen. Die Chinesen haben mich schon immer fasziniert. Sollen wir alles Heilpraktikern überlassen, Hannes? Nichts gegen solche. Sie sind uns in manchem voraus.«
»Wieso?«
»Weil sie nicht mit Schulwissen und jahrhundertealten Erkenntnissen vollgepropft wurden. Manche von uns dünken sich so weise, daß sie keinen Instinkt mehr haben.«
Dr. Cornelius war ziemlich aus der Fassung gebracht. Von Daniel hatte er solche Worte zuletzt erwartet.
»Schau mich nicht so an, Hannes«, sagte Daniel. »Auch Schulmediziner gehen jetzt oft ihre eigenen Wege Sie werden verkannt und angegriffen. Sie sind die wahren Kämpfer meiner Ansicht nach. Was nützte es einem Menschen, der aufgegeben wurde, wenn man ihm mit althergebrachter Therapie kommt. Insel der Hoffnung heißt unser Sanatorium, und daran wollen wir uns halten. Wir wollen hier jede Möglichkeit ausschöpfen. Jede, auch wenn sie nicht in unseren Lehrbüchern stand.«
»Warum kommst du dann nicht her?« fragte Dr. Cornelius. »Du erwartest von mir anscheinend etwas zuviel, Dan.«
»Ich komme, wann immer du mich brauchst. Bei einer Langzeittherapie geht es ja nicht um Minuten. Was hast du übrigens mit Fee besprochen?«
»Sie fährt heute abend mit dir nach München«, erwiderte Dr. Cornelius.
»Jetzt bin ich allerdings überrascht«, sagte Daniel. »Hat sie keine Angst vor dem bösen Wolf?«
»Du Spötter. Bringt man einen Daniel nicht eher mit Löwen in Verbindung?«
Daniel lachte leicht auf. »Auch der Löwe muß sich vor der Mücke wehren, heißt es.«
»Fee ist doch keine Mücke.«
»Sie kann ganz schöne Stiche verteilen, aber sie ist dennoch eine bezaubernde Mücke«, sagte Daniel gedankenvoll.
*
Ohne dazu aufgefordert zu werden, setzte sich David am Nachmittag an den Flügel. Er spielte Schubertlieder und fand Zuhörer, die jeden Ton in sich aufnahmen.
Übelnehmen kann ich es Fee nicht, wenn sie von dem Jungen fasziniert ist, ging es Daniel durch den Sinn. Mir geht es ja genauso.
Das war keine Effekthascherei. David spielte ganz in sich versunken und ganz aus sich heraus. Es war meisterhaft. Man konnte es nicht anders nennen.
Diese Musik klang noch in ihnen nach, als Daniel und Felicitas die Reise nach München antraten.
Dr. Cornelius hatte seiner Tochter alles aufgeschrieben, was sie für ihn erledigen sollte. Davids Abschied von Fee war auch so gewesen, daß Daniel nicht erneut von quälenden Gedanken geplagt wurde.
»Kommen Sie bald wieder zurück?« hatte David gefragt. »Sehen wir uns noch, bevor ich von hier Abschied nehmen muß?«
»Aber ganz bestimmt«, hatte Fee erwidert. »Ich bleibe nur ein paar Tage fort.«
Nichts ließ darauf schließen, daß es ein schmerzlicher Abschied war.
»Hoffentlich ist bei Molly alles wieder in Ordnung«, sagte Daniel nach einem langen Schweigen. »Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir zuerst bei ihr vorbeifahren würden, Fee?«
»Nein, dann könntest du mich auch gleich zu einem Hotel bringen«, erwiderte sie.
»Blödsinn, du kannst doch bei mir schlafen. Ich meine natürlich in meinem Gästezimmer«, fügte er schnell hinzu. »Es ist sehr hübsch, und Lenchen freut sich, wenn sie dich mal wiedersieht. Warum hast du dich eigentlich nie blicken lassen?«
»Warum hast du mich nicht mal eingeladen?« fragte sie zurück.
»Ich wußte doch gar nicht, wo du wohntest.«
»Du hättest nur Paps zu fragen brauchen.«
»Er hat mir ja nicht mal gesagt, daß du die letzten Semester in München studiert hast«, sagte Daniel.
»Dafür hast du dich wahrscheinlich auch nicht interessiert. Außerdem hast du genug zu tun.«
»Ab und zu hätten wir uns doch mal treffen können, meinst du nicht? Dann wären wir uns nicht so fremd geworden. Aber sicher hast du deine Freunde gehabt.«
»Sei nicht so anzüglich«, sagte Felicitas leichthin. »Ich habe gebüffelt. Ich wollte keine Zeit verplempern. Für die Doktorarbeit wollte ich auch nicht noch ein paar Jahre verschwenden.«
»Worüber hast du sie geschrieben?« fragte Daniel.
»Über die Neuraltherapie.«
»Du hast Mut«, sagte Daniel erstaunt. »Was sagte dein Vater dazu?«
»Er weiß es noch gar nicht.«
»Und wenn man deine Arbeit ablehnt?« fragte Daniel.
»Dann werde ich auch ohne Doktorhut mein Ziel verfolgen. Man soll sich nicht von etwas abbringen lassen, wovon man überzeugt ist.«
Daniel entdeckte staunend eine neue, ihm unbekannte Seite an ihr. Sie war zäh und energisch. Sie hatte anscheinend eigene Vorstellungen von ihrem Beruf und wollte nicht nur in die Fußtapfen ihres Vaters treten.
»Meinst du nicht auch, daß die Zeit gekommen ist, in der wir uns nicht nur an herkömmliche Heilmethoden halten dürfen?« fragte Felicitas. »Bei manchen Krankheiten sind wir mit unserm Latein doch am Ende, und ich finde es gut, wenn man jede Möglichkeit ausschöpft, auch den Hoffnungslosen Lebenswillen einzuflößen. Ich mag es nicht, wenn unsere großen, allmächtigen Kollegen herablassend lächeln, wenn andere neue Wege beschreiten. Es ist doch keine Scharlatanerie, wenn sich ein Arzt ins Kreuzfeuer begibt, weil er um jeden Preis da zu helfen versucht, wo alle Medikamente und auch Operationen versagt haben. Lächelst du jetzt auch über mich?«
»Ganz im Gegenteil. Ich staune, Fee, und ich gebe dir vollkommen recht. Die Zivilisation hat uns die phantastischsten technischen Fortschritte gebracht, und dabei ist übersehen worden, daß das menschliche Wesen daran zugrunde gehen kann. Ich staune wirklich, daß du dir darüber auch schon den Kopf zerbrichst. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, daß wir die Krankheit selbst feststellen können. Wir müssen nach ihrer Ursache suchen; erst dann ist es möglich, eine Heilung zu erzielen.«
So ernsthaft redeten sie nun miteinander, und jeder wunderte sich über den andern. Felicitas entdeckte einen neuen Daniel und er eine neue Felicitas. Die Zeit war ihnen fast zu schnell vergangen, als sie vor Helga Molls Wohnung ankamen.
*
Dort hatte sich die Aufregung noch immer nicht gelegt. Helga und Isabel waren von der in Tränen aufgelösten Großmutter empfangen worden. Eine Nachricht von Peter war noch immer nicht gekommen. Aber trotz ihrer Erregung mußte Frau Schneider ihrem Herzen erst Luft machen.
Sie hätte ja immer gesagt, daß der Schwiegersohn nichts tauge und es nie verstanden, daß ihre Tochter ihn überhaupt noch in die Wohnung und zu den Kindern gelassen hätte. Und sie hätte Peter auch nicht erlaubt, mit seinem Vater zu gehen, aber mit einer alten Frau könne man ja machen, was man wolle.
»Ich habe es Peter gesagt, daß es dir nicht recht sein wird, Mutti«, erzählte sie kleinlaut, »aber Papa hat gesagt, daß er Peter abends wieder heimbringt. Ein neues Auto hat er, und das hat Peter imponiert.«
Sabine mußte in allem Kummer erst mal staunen, daß ihre Mutter mit Isabel Guntram daherkam. Sie war so fassungslos, daß sie überhaupt nichts sagen konnte. Doch Isabel ergriff die Initiative.
»Zu warten hat wenig Sinn«, meinte sie. »Ich werde gleich mal Nachforschungen anstellen. Würden Sie mich begleiten, Sabine? Sie können Ihren Bruder besser beschreiben als ich.«
Wäre die Situation nicht so besorgniserregend gewesen, hätte Sabine Luftsprünge vollführt. Das hätte sie sich niemals träumen lassen, daß ihr großes Vorbild die häuslichen Sorgen der Familie Moll teilen könnte.
Während sie mit Isabel das Haus verlassen hatte, mußte Helga wieder Vorwürfe von ihrer Mutter über sich ergehen lassen.
»Wir haben immer gesagt, daß du mit den Kindern zu uns ziehen sollst, aber du wolltest ja nicht auf uns hören. Was ist denn das für ein Zustand, wenn die Mutter berufstätig ist und die Kinder ihre eigenen Wege gehen.«
Helga war verzweifelt und schuldbewußt, aber nun lenkte Katrin ein.
»Es ging doch alles gut, Omi«, verteidigte sie ihre Mutter. »Peter hat so was auch noch nie gemacht. Es hat ihm nur imponiert, daß Papa ein neues Auto hatte.«
»Das er vielleicht gestohlen hat«, ereiferte sich Frau Schneider.
»Nein, das tut Heinz nicht«, trat Helga nun für ihren Mann ein. »Er ist leichtsinnig, aber nicht kriminell. Außerdem hat er augenblicklich Geld. Er hat mir neulich sogar etwas gebracht. Und er hängt an den Kindern.«
»Nun verteidigst du ihn auch noch«, warf ihre Mutter ihr vor.
»Was recht ist, muß recht bleiben«, sagte Helga. »Es muß etwas passiert sein«, fügte sie dann mit bebender Stimme hinzu.
Und so war es auch. Nur eine Stunde hatte es gedauert, bis Isabel es in Erfahrung gebracht hatte, daß der Wagen von Heinz Moll auf der Straße nach Garmisch von einem anderen Wagen beim Überholen gerammt worden war. Sie waren in das nächstliegende Kreiskrankenhaus gebracht worden. Heinz Moll hatte erhebliche Verletzungen, Peter stand noch unter einem schweren Schock. Daß die Angehörigen noch nicht benachrichtigt worden waren, lag daran, daß Peter die Adresse nicht angegeben hatte.
»Jetzt wird er natürlich ein schlechtes Gewissen haben«, sagte Sabine, die erst mal erleichtert war, daß Peter gefunden und nicht schwer verletzt war.»Und dann hängt er ja auch immer noch an Papa, wenn er es auch vor Mutti nicht zugibt.«
Geschiedene Ehen, dachte Isabel. Die Kinder sind die Leidtragenden. Sie stehen zwischen den Eltern. Vielleicht war es besser, wenn man gar nicht heiratete und vor allem keine Kinder in die Welt setzte.
»Ihre Eltern sind schon länger geschieden, Sabine?« fragte sie, als sie zur Wohnung zurückfuhren, um Helga Moll persönlich die Nachricht zu bringen.
»Fünf Jahre. So ging es auch nicht mehr. Ich kann Mutti verstehen. Sie hat sich abgerackert, und Papa hat das Geld verjubelt. Krank war er nie. Jetzt hat er Zeit, über alles nachzudenken, wenn er lange im Krankenhaus liegen muß.«
Das klang fast ein bißchen herzlos, aber Isabel war gerecht. Sie hätte diese Situation wohl ebenso realistisch betrachtet.
Helga war nun sehr gefaßt. Natürlich wollte sie gleich zum Krankenhaus fahren. Isabel bot sich an, sie dorthin zu bringen.
»Das kann ich nicht annehmen«, sagte Helga. »Den ganzen Sonntag habe ich Ihnen verdorben.«
»Ach was«, meinte Isabel gleichmütig. »Dabei lerne ich meine Volontärin gleich ein bißchen näher kennen.«
Sabine errötete. Für sie war dies ein erhebender Tag trotz aller Aufregungen. Noch fester war sie jetzt entschlossen, Isabel nachzueifern.
Sie ist nett, dachte Isabel, wirklich ganz reizend. Ein bißchen verspielt noch, aber doch realistisch.
Helga sprach während der Fahrt kein einziges Wort. Sie war auch noch immer nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
Peter saß am Krankenbett seines Vaters, als man Helga in das Zimmer führte. Er hatte nur ein paar Schrammen abbekommen, aber der Schock saß ihm noch immer in den Gliedern. Er war totenblaß, als seine Mutter eintrat. Er blieb aber an dem Bett sitzen und senkte den Kopf.
»Papa war nicht schuld«, murmelte er. »Der andere war schuld.«
»Warum hast du uns keine Nachricht gegeben, Peter?« fragte Helga tonlos, ihren Arm um den Jungen legend.
»Du warst doch nicht zu Hause. Oma ist sowieso gegen Papa. Ich konnte ihn doch nicht allein lassen, Mutti. Zum ersten Mal konnte ich so gut mit ihm reden. Er hat eingesehen, was er falsch gemacht hat. Er hätte morgen eine Stellung antreten können, und das wollte er mir alles sagen. Es war nicht seine Schuld.«
Immer wieder wiederholte er es. Hans Moll konnte sich nicht dazu äußern. Er war noch immer bewußtlos. Still lag er in dem Bett. Von seinem Gesicht war unter den dicken Verbänden kaum etwas zu erkennen.
»Ich konnte ihn nicht allein lassen«, sagte Peter wieder. »Er ist doch unser Vater.« Und da kamen ihm die Tränen.
Er ist der Vater meiner Kinder, ging es Helga durch den Sinn. Man kann es nicht wegreden. Er war mein Mann. Fast dreizehn Jahre war er mein Mann, und einmal haben wir uns versprochen in guten und in schlechten Zeiten zueinander zu stehen.
»Da ist Papas Brieftasche, Mutti«, sagte Peter leise. »Es ist noch eine Menge Geld drin. Den Wagen hat er günstig bekommen. Nun ist er futsch, aber es ist doch wichtiger, daß Papa am Leben bleibt.«
»Ja, mein Junge«, sagte Helga leise. »Wir werden ihn nicht im Stich lassen.«
»Du solltest eine bessere Meinung von ihm bekommen, hat er gesagt. Jetzt wollte er es beweisen, und nun liegt er so hilflos da. Was machen wir jetzt nur?«
Ja, was machen wir nun, dachte Helga. Ich kann Dr. Norden doch nicht Hals über Kopf im Stich lassen. Sabine kann sich allein helfen, aber Katrin ist auch noch da, und ob Mutter jetzt Verständnis für diese Situation hat und noch ein paar Tage bleiben würde? Ihre Gedanken überstürzten sich, aber wie man es auch drehte und wendete, sie fühlte sich in einer Zwickmühle gefangen.
Die Entscheidung traf dann Felicitas für sie. Sie und Daniel hatten von Frau Schneider eben erfahren, was geschehen war, als das Telefon läutete und Helga vom Krankenhaus aus anrief.
»Wollen Sie selber mit ihr sprechen?« fragte Frau Schneider und gab Dr. Norden den Telefonhörer.
»Ich werde schon eine Aushilfe bekommen, Molly«, sagte Daniel. »Hetzen Sie sich nicht ab.«
»Ich kann ja morgen für Frau Moll einspringen«, warf Felicitas ein.
»Bleibst du hier, Omi?« fragte Katrin ängstlich.
»Da wird mir wohl nicht anderes übrig bleiben«, sagte Frau Schneider. »Ich bin ja bloß froh, daß dem Buben weiter nichts passiert ist.«
*
»Nun bist du auch noch der rettende Engel, Fee«, sagte Daniel dankbar.
»Du würdest ohne deine Molly wohl ganz schön rotieren«, meinte sie.
»Wenn man so aufeinander eingespielt ist, wird es schwierig, sich umzustellen, aber wahrscheinlich werde ich mich nun doch nach einer anderen Hilfe umsehen müssen.«
»Warte doch erst mal ab, bis sich der Schrecken gelegt hat. Für mich ist es ganz interessant, mal zu erleben, wie es in einer Sprechstunde zugeht.«
»Hoffentlich geht es nicht zu sehr zu. Gerade der Montag ist meist ein turbulenter Tag.«
»Du kannst mich ja schnell noch ein bißchen anlernen«, sagte sie lächelnd. »Oder hattest du heute noch was vor?«
»Du liebe Güte, was hast du nur für eine Meinung von mir. Jetzt wird Lenchen erst mal schauen, wen ich da mitbringe.«
Und wie Lenchen schaute! Ein Leuchten ging über ihr Gesicht, als sie Felicitas erkannte.
»Ist schon lange her, daß ich die kleine Fee gesehen habe«, murmelte sie gerührt. Dann warf sie Daniel einen forschenden Blick zu, der ihn gewaltig in Verlegenheit brachte. Er konnte Lenchens Gedanken lesen und bemühte sich eilends, ihr eine Erklärung für Felicitas’ Anwesenheit zu geben.
»Was Molly aber auch alles mitmachen muß«, sagte sie kopfschüttelnd, denn so schnell begriff sie die Zusammenhänge nicht und meinte, daß Fee nur deshalb gekommen sei, um Daniel in der Praxis zu helfen.
»Wir brauchen ihr nicht alles auf einmal zu erklären«, raunte Daniel Fee zu. »Aber ist es nicht rührend, wie sie sich über dein Kommen freut?«
»Es ist seltsam«, sagte Fee sinnend.
»Was ist seltsam?« fragte Daniel. Fee errötete, aber dann raffte sie sich doch zu einer Begründung auf.
»Daß du noch immer allein hier mit dem alten Lenchen lebst«, erklärte sie.
»Hast du einen Harem erwartet?« fragte er amüsiert. Sie wich seinem Blick aus. »Das Penthouse ist zauberhaft«, lenkte sie schnell ab.
»Für mich ist es vor allem praktisch, daß die Praxis im gleichen Haus liegt. Wenn ich mal verschlafe, kann ich schnell herausgeklingelt werden.«
»Verschläfst du denn so oft?« fragte sie.
Daniel lächelte hintergründig. »Wenn du es mir auch nicht zutraust, ich bin ein Frühaufsteher, ein absoluter Tagmensch.«
»Aber ab und zu gibt es doch auch mal Nachtleben«, spottete Fee.
»Ab und zu.«
»Immer mit Isabel?« fragte sie. Sie wollte ganz kameradschaftlich tun, aber ihre Stimme hatte doch einen heiseren Klang.
»Wir sehen uns selten. Jeder hat seinen Beruf.« Daniel wußte nicht so recht, was er sagen sollte und auch nicht, worauf Fee jetzt hinauswollte.
»Ich bin wohl zu neugierig«, sagte sie.
»Warum sollen wir nicht offen miteinander reden«, sagte Daniel. »Warum wolltest du mich absolut zum Playboy abstempeln, Fee?«
Eine so direkte Frage hatte sie nicht erwartet und war nun vollends verwirrt. Aus unerfindlichen Gründen hatte sie sich von Daniel ein Bild gemacht, das den Tatsachen völlig zu widersprechen schien.
Da stand er vor ihr, die Arme über der Brust verschränkt, die dunklen Augen ernst und nachdenklich auf sie gerichtet. Nichts Hintergründiges war jetzt in seinem Blick, und sie meinte, er müsse ihr auf den Grund ihrer Seele schauen können. Ihr Gesicht verschloß sich zusehends.
»Du siehst eben zu gut aus«, sagte sie trotzig.
»Guter Gott, wenn es so ist, bin ich schuldlos daran«, sagte er. »Aber darf ein Arzt nicht auch annehmbar aussehen?
Nehmen wir deinen Vater, oder Dr. Schoeller, und ich kann dir noch eine Anzahl aufzählen. Und wie gefällt es dir, wenn ich dir sage, daß du für eine Ärztin viel zu hübsch bist? Du wirst allen Patienten den Kopf verdrehen, aber vielleicht werden sie dadurch ihre Wehwehchen schnell verlieren.«
»Ich habe nicht die Absicht, irgend jemandem den Kopf zu verdrehen«, sagte Fee aggressiv.
»Ich auch nicht.« Daniel lachte leise auf. »Laß uns das Kriegsbeil begraben, Fee. Du hast mich heute in manchen Dingen überrascht, und ich zolle dir Respekt.«
Da stand Lenchen in der Tür. Ihr Klopfen hatten sie überhört. Und das, was in diesem Raum gesprochen wurde, konnte sie in ihrer Schwerhörigkeit nicht verstehen.
»Wollt ihr nur schwatzen und gar nichts essen?« fragte sie. »Der Tisch ist schon lange gedeckt. Ihr könnt alles stehen lassen. Ich bin jetzt müde. Das Gästezimmer ist auch gerichtet. Gute Nacht.«
Felicitas ging zu ihr und umarmte sie. »Gute Nacht, Lenchen«, sagte sie. »Es tut mir leid, daß ich nicht schon längst mal hergekommen bin.«
»Das tut mir auch leid«, sagte Lenchen. »Aber vielleicht kommen Sie jetzt öfter mal.«
*
»Warum hast du Lenchen eigentlich nicht mit zur Insel der Hoffnung gebracht, Daniel?« fragte Felicitas.
»Weil sie nicht wollte. Sie hat so ihre Eigenheiten. Man soll einen Menschen nie zu etwas zwingen.«
»Auch eine Weisheit, aber eigentlich hätte man doch annehmen müssen, daß sie sehen möchte, was deines Vaters Idee war.«
»Sie kennt die Insel nur mit dem alten Bauernhaus. Und für sie hat das Sanatorium wohl keine Bedeutung, weil Vater nicht mehr lebt.«
»An dieses moderne Haus hat sie sich doch aber auch gewöhnt«, meinte Felicitas.
»Nicht so schnell, Fee. Sie hat genug gemeutert, aber mich wollte sie doch nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie ist eine rührende Seele. Für sie bleibe ich ewig der kleine Junge, dem sie die Nase geputzt und die Ohren gewaschen hat. Und wenn es dich beruhigt, kann ich dir sagen, daß sie mir gehörig die Leviten gelesen hat, wenn ich mal eine Nacht durchbummelt habe.«
»Also ist sie auch ein moralischer Rückhalt für dich«, sagte Fee neckend. »Darf ich es so verstehen, daß, wer die geheiligte Schwelle deines Hauses überschreitet, Gnade vor ihren Augen finden muß.«
»So darfst du es verstehen.«
»Da sie aber schwerhörig ist, kann man sie ab und zu auch mal übertölpeln«, sagte Fee anzüglich.
»Fängst du schon wieder an«, meinte Daniel sarkastisch. »Mein liebes Mädchen, ich habe auch gewisse Grundsätze. Du wirst mich nicht dazu bringen, dir eine Generalbeichte abzulegen. Heute nicht«, fügte er betont hinzu, und damit brachte er sie erneut in Verlegenheit.
»Und jetzt werden wir uns aufs Ohr legen, Fräulein Doktor. Mein Tag beginnt früh, und da du A gesagt hast, mußt du auch B sagen. Also beginnt auch dein Tag früh.«
Er begleitete sie zum Gästezimmer und ergriff ihre Hand. »Ich danke dir für deine Bereitschaft, mir zu helfen, Fee«, sagte er herzlich, »und schlaf gut unter meinem Dach.«
Dann zog er ihre Hand an seine Lippen, und wie ein elektrischer Schlag durchzuckte es sie.
»Gute Nacht, Daniel«, hauchte sie.
*
Lenchen war ganz erschrocken, daß sie schon gar so früh auf den Beinen waren.
»Ich muß das Fräulein Doktor einweisen«, sagte Daniel so laut, daß sie es ganz gewiß nicht überhören konnte.
»Jesses, Jesses«, murmelte Lenchen und flitzte hin und her.
»Der Kittel von Molly wird dir ein bißchen zu groß sein«, sagte Daniel zu Fee. »Aber dick ist sie glücklicherweise nicht.«
»Und Molly paßt eigentlich gar nicht zu ihr«, meinte Fee.
»Aber sie hört es ganz gern. Aber zu dir paßt Fee sehr gut.«
»Die Fee vom Rosensee«, sagte sie ironisch.
»Klingt das nicht hübsch?« fragte er, ohne sich daran zu erinnern, daß Isabel diese Bezeichnung gebraucht hatte.
»Ein bißchen albern«, meinte Fee. »Es kling so nach Heimatfilm.«
»Nostalgie, warum soll man es abwerten?«
»Hat es deine Freundin Isabel nicht abwertend gemeint?« Warum nur brach immer wieder diese verflixte Eifersucht bei ihr durch?
Daniel sah sie verwundert an. »Wieso Isabel?« fragte er.
»Sie hat mich doch so genannt. Ich habe es zufällig gehört.«
Er drehte sich zu ihr um und umfaßte ihre Schultern.
»Eins möchte ich klarstellen, Fee«, sagte er ruhig. »Isabel und ich sind Freunde. Wir haben nicht die Beziehungen, die du vielleicht annimmst.«
»Könnten wir nicht auch Freunde sein, Daniel?« fragte sie nach kurzem Zögern.
Er sah sie gedankenverloren an, und sie wich schnell seinem Blick aus.
»Nein, das glaube ich nicht, Fee«, erwiderte er mit dunkler Stimme. »Auch auf die Gefahr hin, daß du mich falsch verstehst. Aber vielleicht kommst du von selbst darauf, warum mir das unmöglich erscheint. Und nun an die Arbeit. Die Patienten werden sich bei dir anmelden, und du suchst dann ihre Karteikarten heraus. Kapiert?«
»Na, das ist wohl nicht allzu schwer zu begreifen«, meinte sie. Jetzt nur nicht über seine Worte nachdenken, mahnte sie sich, sonst bringe ich womöglich doch alles durcheinander.
»Was muß ich sonst noch tun?« fragte sie weiter.
»Injektionen aufziehen, Pflästerchen bereithalten. Aber das erkläre ich dir von Fall zu Fall. Einige werden Bestrahlungen bekommen, aber die Hauptaufgabe für dich wird wohl darin bestehen, Telefonanrufe zu beantworten. Meine Patienten sind gewohnt, daß man sich ein bißchen mit ihnen unterhält, und manchmal erwarten sie auch, daß man Ferndiagnosen stellt. Es gibt auch einige, die meinen, daß der Doktor ganz allein für sie dasein müßte. Immer hübsch diplomatisch sein.«
Allzu aufregend klang das gar nicht, aber als die erste Stunde überstanden war, hatte Fee schon einen Begriff bekommen, daß es gar nicht so einfach war, allen gerecht zu werden. Da läutete das Telefon, da schlug die Türglocke an. Kaum hatte sie eine Karteikarte herausgesucht und zu den anderen gelegt, kam schon der nächste Patient. Und das schlimmste war, daß jeder sich erkundigte, warum Molly nicht da sei.
Fee bewunderte Daniels Ruhe und Gelassenheit. Nicht eine Sekunde war er gereizt oder geistesabwesend. Und lächelnd gab er immer und immer wieder Auskunft, daß Fee nur als Vertretung für Frau Moll da sei, wenn eine der Patientinnen spitz oder anzüglich feststellte, was er jetzt für eine hübsche junge Sprechstundenhilfe hätte.
Ein gutes Dutzend Patienten waren abgefertigt, als Professor Manzold anrief.
Fee erkannte seine Stimme sofort und war überrascht. »Professor Manzold«, sagte sie staunend.
»Mit wem rede ich denn da? Die Stimme kenne ich doch auch«, tönte seine tiefe Stimme durch den Draht. Seinerseits war die Überraschung auch groß, als Fee ihn aufklärte. Aber zu einem Plausch hatte er so wenig Zeit wie sie. Er wollte Daniel selbst sprechen wegen Herrn Glimmer.
Zum ersten Mal an diesem Vormittag machte Daniel nach diesem Gespräch einen geistesabwesenden Eindruck.
»Hoffentlich geht alles gut aus«, sagte er.
»Eine schlimme Sache?« fragte Fee.
»Das kann man wohl sagen. Wieviel warten noch, Fee?«
»Sechs.«
»Ich muß in der Mittagspause in die Klinik fahren.« Mehr sagte er nicht. Er gab ihr einen Wink, und sie wußte nun schon, was das bedeutete. »Der nächste bitte«, sagte sie in die Sprechanlage.
*
Wie soll Daniel da eigentlich noch Zeit für ein Privatleben haben, dachte Fee, als der letzte Patient die Tür hinter sich geschlossen hatte. Daniel hatte seinen Kittel schon ausgezogen.
»Du läßt dich jetzt von Lenchen verwöhnen«, sagte er zu Fee. »Gib mir die Besuchsliste gleich mit.«
Er warf einen Blick auf die Karte. »Na, hoffentlich schaffe ich das bis fünf Uhr«, meinte er. »Dann kommen nämlich die Berufstätigen, die vorgemerkt sind.«
»Und wann ißt du?« fragte sie.
»Wenn ich Zeit habe«, erwiderte er. »Bist wohl ganz schön geschlaucht?«
»Es geht schon noch. Ich werde Paps anrufen, daß ich noch ein, zwei Tage dranhängen muß, um alles zu erledigen.«
»Tust du das gern, Fee?« fragte er, schon an der Tür stehend.
»Ich werde dich doch jetzt nicht sitzenlassen.«
»Ach ja, das muß ich noch sagen. Morgen zwischen zwei und vier Uhr kann ich keine Besuche machen, wenn Anrufe kommen sollten. Dr. Neuberts Beerdigung findet um halb drei Uhr statt.«
Fee blickte ihm gedankenvoll nach. So sah also sein Arbeitstag aus. Er lief nicht einem Chefarzt nach wie die Assistenzärzte in einer Klinik, obgleich die weiß Gott auch manchmal überbeansprucht waren.
Sie räumte auf und fuhr dann mit dem Lift in seine Wohnung. Lenchen hatte das Essen schon fertig.
»Daniel mußte in die Klinik«, sagte sie. Lenchen legte die Hand an ihr Ohr, und Fee wiederholte es noch einmal lauter.
»Daran bin ich ja gewöhnt«, erwiderte Lenchen dann.
»Wie oft kommt Daniel nicht zum Essen?« fragte Fee.
»Ich zähle es nicht mehr«, antwortete Lenchen.
»Geht es jeden Tag so zu?«
»Meistens.«
»Und wie spät wird es abends?«
»Er will nicht, daß ich so lange aufbleibe. Und wenn er nachts herausgeholt wird, höre ich es nicht. Mir wäre es lieber gewesen, er hätte sich für das Sanatorium entschieden. So macht er sich eines Tages kaputt.«
»Warum sind Sie nicht mit zu uns gekommen, Lenchen?« fragte Fee gedankenvoll.
»Weil es mir vielleicht zu gut gefallen hätte, und dann hätte ich wieder zuviel an ihn hingeredet. Das mag er nicht. Aber vielleicht findet sich noch jemand, der ihm klarmacht, daß es nicht ewig so weitergehen kann. Es ist ja nicht allein die Praxis und die Patienten, die zu ihm kommen. Er kümmert sich ja auch noch um den häuslichen Kram. Wie sein Vater, ich sage es immer, genau wie sein Vater. Und was hat der am Ende davon gehabt?«
Augenblicklich war es Felicitas ganz elend zumute. Nicht nur, weil sie sich Sorgen um Daniel machte, sondern auch darum, weil sie ihn so sehr verkannt hatte.
Als Modearzt hatte sie ihn bezeichnet, und was war er wirklich? Schlimmer noch war es, daß sie ihn Playboy genannt hatte.
»Wer erkennt das schon an, was er leistet«, nuschelte Lenchen vor sich
hin.
»Und was kann er schon dafür, daß die Weiber sich die Köpfe nach ihm verdrehen. Froh wäre ich, wenn er endlich eine fände, die sich um ihn kümmert, die ihn richtig versteht.«
Felicitas kam gar nicht auf den Gedanken, daß Lenchen diese Worte nur an ihre Adresse gerichtet hatte, zu sehr war sie mit ihren schuldbewußten Gedanken beschäftigt.
»Wenn Molly ihn jetzt auch noch im Stich läßt, weiß ich wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll«, fuhr Lenchen fort. »Irgendeine kann er doch nicht brauchen.«
»Molly hat auch ihre Sorgen«, sagte Fee sinnend.
»Und ich habe meine«, sagte Lenchen seufzend. »Reden Sie ihm doch zu, daß er das tut, was sein Vater so gern tun wollte.«
»Daniel wird nicht auf mich hören, Lenchen«, sagte Fee leise.
»Vielleicht nicht gleich, aber später vielleicht doch. Mit ihm muß man ein bißchen Geduld haben, aber immerhin geht er doch schon auf die Vierzig zu.«
»Erst mal auf die fünfunddreißig«, schwächte Fee ab.
»Und wie schnell gehen die Jahre dahin. So gern möchte ich es noch erleben, daß er Kinder hat, nur die richtige Frau braucht er, nur die richtige Frau!«
Lenchen sorgte sich um Daniel wie eine Mutter, und sicher machte sie sich oft Gedanken, wie lange sie noch für ihn dasein könnte.
»Daß Sie dem Jungen jetzt helfen, macht mich wirklich froh«, sagte Lenchen, dann ging sie wieder in ihre Küche.
Ein paar Minuten blieb Fee noch in Gedanken versunken sitzen, dann rief sie ihren Vater an und führte ein langes Gespräch mit ihm. Sie erfuhr, daß Katja gekommen sei. Es ging ihr ganz gut, meinte er, aber seine Stimme klang nicht optimistisch.
»Und David?« fragte Fee.
»Er erfreut uns mit seinem Spiel«, erwiderte ihr Vater. »Steh du nur Daniel bei. Ich kann dich jetzt schon noch entbehren.«
Kaum hatte sie den Hörer aufgelegt, läutete das Telefon. Fee schrak regelrecht zusammen.
Sie vernahm Isabels Stimme. Sie wollte Daniel sprechen. Es versetzte Fee wieder einen schmerzhaften Stich. Ob er schon eine Aushilfe gefunden hätte, erkundigte sich Isabel dann, nachdem es ihr anscheinend auch die Stimme verschlagen hatte, als Fee sich zu erkennen gab.
»Ich werde die ganze Woche bleiben«, erwiderte Fee, und dabei empfand sie einen leisen Triumph.
»Dann ist ja alles okay«, sagte Isabel.
Machte es ihr wirklich nichts aus? Ihre Stimme hatte ganz aufrichtig geklungen. Sie konnte über Isabel nicht lange nachdenken, denn schon wieder läutete das Telefon. Diesmal war es Frau Schneider, Helga Molls Mutter. Sie wollte ausrichten, daß ihre Tochter mit Peter morgen zurückkommen würde. Helga hätte schon vormittags versucht, Dr. Norden zu erreichen, aber die Nummer sei dauernd besetzt gewesen.
Fee machte sich eine Notiz, obgleich sie es bestimmt nicht vergessen würde, diese Nachricht an Daniel weiterzugeben.
Dann wird mein Gastspiel doch schneller beendet sein, dachte sie bekümmert. Molly wollte ihren Dr. Norden anscheinend nicht im Stich lassen. Und plötzlich wußte sie ganz genau, was sie sich wünschte, nämlich, immer an Daniels Seite zu sein und all die Sorgen, die sein Beruf, der auch ihrer war, mit sich brachte, mit ihm zu teilen.
*
Dr. Daniel Norden hatte indessen ein kurzes aber inhaltsreiches Gespräch mit Professor Manzold geführt. Sie mußten beide mit ihrer Zeit geizen.
Franz Glimmer sollte bereits morgen operiert werden.
»Mit welchen Aussichten?« fragte Daniel heiser.
Professor Manzold zuckte die Schultern. »Schwer zu sagen, aber zu warten ist sinnlos. Mit jedem Tag können sich seine Chancen verringern.«
Dr. Norden besuchte seinen Patienten. Er setzte sich zu Franz Glimmer ans Bett.
»Nun komme ich doch unter das Messer, vor dem ich mich immer so gefürchtet habe«, sagte der Patient ängstlich.
»Nicht fürchten«, meinte Daniel aufmunternd. »Es wird Ihnen helfen.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr«, sagte Franz Glimmer. Das wünschte auch Daniel Norden.
»Wenn es schiefgeht, bleiben Sie dem Maxi treu«, murmelte der Kranke. »Ich hätte halt früher auf Sie hören sollen, Herr Doktor.«
»Noch ist es nicht zu spät«, sagte Daniel. »Ich weiß Sie in den besten Händen, Herr Glimmer.«
Der versuchte ein Lächeln. »Wenn Sie bei uns vorbeikommen, sagen Sie meiner Frau ein paar aufmunternde Worte, Herr Doktor.«
»Das werde ich gleich nachher tun, wenn ich tanke, und morgen nachmittag komme ich vorbei.«
»Weil Sie nicht schon genug um die Ohren haben«, murmelte Franz Glimmer.
Dr. Norden machte seine Hausbesuche. Zu seiner Erleichterung wurde er nirgendwo lange aufgehalten. Er hatte sogar noch ein bißchen Zeit, sich an der Tankstelle aufzuhalten, wo Uschi gewissenhaft ihrer Arbeit nachging. So fröhlich wie sonst sah sie allerdings nicht aus.
»Papa wird morgen operiert«, sagte sie leise.
»Ja, ich weiß. Ich war vorhin bei ihm. Ist die Mutti da?«
»Nein, sie ist in die Klinik gefahren. Wenn bloß alles gutgeht. Papa muß sich dann auch mal richtig erholen, Herr Doktor. Sie müssen ihm zureden, daß er nicht gleich wieder an die Arbeit geht.«
»Das werde ich, Uschi. Kommt ihr gut zurecht?«
»Der Eugen hilft ja.« Sie errötete. »Er würde auch länger bleiben, damit Papa sich richtig erholen kann.«
Ein sympathischer junger Mann kam aus der Werkstätte, als Daniel sich wieder in seinen Wagen setzte. Er sah noch, wie er auf Uschi zuging und ihr schnell einen Kuß auf die Wange drückte. Ein wenig Glück in allem Unglück, ging es Daniel durch den Sinn. Er gönnte es diesem netten Mädchen. Es war gut, in schwierigen Situationen einen Menschen zur Seite zu haben, mit dem man sich verstand.
Ein Glücksgefühl erfüllte ihn, als Fee in der Praxis auf ihn wartete. Sie trug jetzt einen Kittel, der ihr richtig paßte. Er sah es sofort.
»Ich habe ihn mir schnell besorgt, wenn es auch nur für kurze Zeit ist, aber brauchen kann ich ihn ja immer«, erklärte sie verlegen. »Molly kommt morgen mit ihrem Sohn zurück. Frau Schneider hat angerufen. Ich wäre sonst auch noch ein paar Tage geblieben, Daniel.«
»Na, darüber reden wir noch. Ist schon jemand da?« Fee nickte.
»Zwei Patienten und ein Herr Neuner möchte dich dringend sprechen. Dann hat auch eine Frau Neumann angerufen. Ich bringe die Namen fast durcheinander.«
»Frau Neumann soll kommen, wenn ihr was fehlt. Sie ist nicht bettlägerig. Ein bißchen energischer muß ich in manchen Fällen wohl doch sein. Na, dann nehmen wir erst mal den Herrn Neuner dran. Zehn Minuten Limit, Fee.«
»Wieso?«
»Weil die andern Fälle dringender sind. Du wirst schon eine Ausrede finden, um das Gespräch zu unterbrechen. Er ist kein Patient. Ich behandele seine Frau.«
Das Gespräch zog sich nicht in die Länge. Herr Neuner zeigte sich einsichtig, nachdem er zuerst mit der Bemerkung gekommen war, daß Daniel seiner Frau Flausen in den Kopf setze.
Daniel machte ihm seinen Standpunkt klar, und Herr Neuner wurde merklich kleinlaut.
»Ein bißchen hysterisch ist sie aber schon«, versuchte er, sich zu rechtfertigen.
»Vielleicht suchen Sie die Schuld dafür auch einmal bei sich, Herr Neuner«, sagte Daniel unverblümt. »Die Wechseljahre sind ein schwieriges Alter, die Sorge um Ihren Sohn zerrt an ihren Nerven.«
»An meinen auch«, sagte Herr Neuner. »Aber wenn Sie meinen, daß sich alles einrenkt, wenn sie mit dem Jungen in Ihr Sanatorium geht, an mir soll es nicht liegen. Nächste Wochen können wir Rainer abholen und wenn Sie Platz haben, bringe ich meine Frau und ihn gleich zu der Insel mit dem vielversprechenden Namen. Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, sagt man aber auch.«
»Man soll nicht alles negativ sehen«, sagte Daniel.
»Na ja, Sie machen ja einen ganz vernünftigen Eindruck«, stellte Herr Neuner fest. »Besprechen Sie alles mit meiner Frau, zahlen tue dann ich.«
Das soll er auch, wenn er sonst zu nichts bereit ist, dachte Daniel.
Jetzt aber konnte er sich seinen anderen Patienten widmen, und es wurde wieder acht Uhr, bis endlich Feierabend war.
»Mußt du noch mal weg?« fragte Fee.
»Heute nicht mehr. Ich habe alles erledigt. Es sei denn, daß noch ein dringender Anruf kommt, aber dagegen ist man nie gefeit als Allerweltsdoktor.«
Ein Lächeln legte sich um ihre Lippen. »Den ich auch zu meinem Hausarzt ernennen würde, nachdem ich einen Tag an seinem Leben teilnehmen durfte«, sagte sie leise.
Er legte seinen Arm um ihre Schultern, als sie im Lift aufwärts fuhren. »Das hast du hübsch gesagt, Fee. Es macht mich glücklich.« Und dann streiften seine Lippen rasch ihre Stirn.
*
Helga Moll hatte den Tag mit ihrem Sohn Peter verbracht, da Heinz Moll noch immer nicht bei Bewußtsein war. Es war nicht leicht gewesen, mit Peter ins Gespräch zu kommen, aber langsam hatte sich dann seine Zunge doch gelöst, und die Schockwirkung schwächte sich ab.
»Du darfst mir nicht böse sein, Mutti«, sagte Peter, »aber ich mag Vater doch irgendwie. Er ist doch nun mal unser Vater. Ich habe viel über alles nachgedacht.«
»Wie lange schon, Peter?« fragte Helga.
»Schon ein paar Jahre. Sabine und Katrin sehen das sicher anders. Es sind ja auch Mädchen. Vielleicht fühlt er sich zu mir auch am meisten hingezogen. Es ist alles so schwer zu erklären.«
»Erkläre es mir, wie du es verstehst«, sagte Helga leise.
»Man muß ihm doch eine Chance geben, Mutti«, stieß er hervor. »Er hat den guten Willen. Er hängt doch wahnsinnig an dir. Es ist für einen Mann nicht einfach, wenn seine Frau klüger und tüchtiger ist als er. Das war sein Problem. Er hat immer gemeint, daß er schnell viel Geld verdienen müsse, um dir und auch sich selbst etwas zu beweisen. Das war eben nicht der richtige Weg. Wir haben uns neulich ganz ernsthaft unterhalten. Er hat mit mir geredet, als wenn ich erwachsen wäre, und zum ersten Mal habe ich ihn richtig verstanden.«
»Vielleicht bist du schon erwachsen, Peter«, sagte Helga nachdenklich.
Er sah sie mit kummervollen Augen an. »Ich habe dich genauso lieb wie Sabine und Katrin«, murmelte er, »aber Vater habe ich auch lieb.«
Helga strich ihm mit der Hand durch das Haar, das genauso struppig und widerspenstig wie das seines Vaters war.
»Es ist ja gut, Peter«, flüsterte sie. »Wie könnte ich dir böse sein. Machst du es mir zum Vorwurf, daß ich mich habe scheiden lassen?«
Er schüttelte den Kopf. »Das war richtig. Das hat Vater erst zu Bewußtsein gebracht. Du warst immer zu nachgiebig. Er sieht das alles ein, Mutti. Ihn muß man straff am Zügel halten, hat er zu mir gesagt. Du hast allein für uns sorgen können und ihm auch immer wieder Geld gegeben. Das war sicher nicht richtig. Nun hatte er plötzlich eine ganze Menge Geld und wollte neu anfangen, und dann ist das passiert.«
»Hat er dir gesagt, wie er zu dem Geld gekommen ist, Peter?« fragte Helga.
»Ja, er hat es gewonnen. Einmal hat er Glück gehabt mit seinem letzten Geld. Aber er wollte etwas daraus machen, Mutti. Er wollte keinen Pfennig davon wieder verspielen.«
Der Unfall hat das verhindert, ging es Helga durch den Sinn. Aber sie wollte Peters Glauben an das Gute in seinem Vater nicht erschüttern.
»Gib ihm doch eine Chance, Mutti«, sagte der Junge leise. »Bitte, gib sie ihm. Du hast ihn doch auch mal liebgehabt.«
Geliebt habe ich ihn, dachte Helga. Jeden Widerstand ihrer Eltern gegen diese Heirat hatte sie überwunden, und dann hatte sie doch kapituliert.
»Wir wollen hoffen, daß er gesund wird, Peter«, sagte sie. »Vielleicht gibt ihm das Schicksal die Chance. Ich bin froh, daß du mir nicht genommen worden bist, mein Junge.«
»Weißt du, was er zuletzt gesagt hat? Halt dich fest, Peter, da kommt ein Verrückter. Dir darf nichts passieren. – Er hat nur an mich gedacht, nicht an sich.«
Und das erste Wort, das Heinz Moll aussprach, als er aus der Bewußtlosigkeit erwachte, war der Name seines Sohnes.
»Peter!« Erst dann schlug er die Augen auf und sah Helgas Gesicht, das sich über ihn neigte
»Helga«, flüsterte er. »Was ist mit Peter?«
»Es geht ihm gut, Heinz«, erwiderte sie.
Er atmete erleichtert auf. »Und du bist bei mir«, murmelte er. »Bitte, bleib!«
»Morgen müssen wir heim«, sagte Helga, »aber ich komme dich besuchen, so oft ich kann.«
»Ich war nicht schuld«, flüsterte er.
»Das weiß ich. Peter hat mir alles gesagt. Du mußt jetzt gesund werden, Heinz. Du darfst deinen Sohn nicht enttäuschen. Du mußt den festen Willen haben, das Leben noch einmal zu beginnen, das dir geschenkt worden ist. Versprichst du mir das?«
»Ja, Helga. Werde ich es können?«
»Du mußt wollen«, sagte sie eindringlich.
»Reich mir deine Hand. Bitte, reich mir deine Hand«, flüsterte er.
Helga hielt seine Hand, bis er wieder einschlief. Und es war ihr eine Beruhigung, als der Arzt ihr sagte, daß Heinz nun außer Lebensgefahr wäre.
*
Am nächsten Tag wurde Dr. Neubert zu Grabe getragen. Nur wenige Menschen folgten dem Sarg. Daniel Norden und Felicitas und ein paar Nachbarn. Während der Geistliche von einem erfüllten Leben sprach, mußte Daniel an Franz Glimmer denken. Professor Manzold hatte noch nicht angerufen, wie er es ihm versprochen hatte, und er hatte einfach Angst gehabt, in der Klinik anzurufen.
Konnte man bei Dr. Neubert von einem erfüllten Leben sprechen? Gewiß von einem, das länger gewährt hatte als das seiner Frau und seiner Angehörigen, und seine Pflicht hatte dieser Mann immer gewissenhaft getan. Aber Erfüllung bedeutete doch auch Glück! Dr. Neubert hatte an zu vielen Gräbern stehen müssen, als daß er noch glücklich hätte sein können.
Seltsam, welche Gedanken kamen, wenn man auf einem Friedhof stand, vom Hauch der Ewigkeit umwoben. Daniel fröstelte es, obgleich es ein warmer Tag war. Unwillkürlich griff er nach Fees Hand. Ihre Finger verschränkten sich ineinander. Sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter, als der Sarg hinabglitt in die Tiefe. Zum ersten Mal lehnte sie sich an ihn, aber erst, als sie wieder im Wagen saßen, kamen ihr die Tränen.
Daniel zog sein Taschentuch hervor und tupfte diese Tränen ab. Dann legte er seine Hand an ihre Wange.
»Du bist mir jetzt so nahe, Fee«, sagte er leise.
»Du mir auch, Daniel«, flüsterte sie.
»Werden wir uns noch näherkommen?« fragte er. »Immer näher?«
Ich liebe ihn, dachte Fee aber sie sprach es nicht aus. Ihre weichen Lippen legten sich auf seine Wange.
»Wirst du den Weg zur Insel der Hoffnung finden, Daniel?« fragte sie gedankenverloren.
»Ich kenne ihn, und ich werde so oft kommen, wie es möglich ist.«
»Um eines Tages zu bleiben?«
»Ja, Fee, eines Tages werde ich bleiben. – Wenn du bleibst«, fügte er nach einer Gedankenpause hinzu.
Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Ich werde vorerst stellvertretend für dich dort sein und bleiben«, sagte sie.
»Und ich werde noch einige Zeit für Patienten sorgen«, sagte Daniel. »Ein wenig realistischer als unsere Väter denke ich schon, Fee. Hast du Verständnis dafür?«
»Ja«, erwiderte sie leise.
»Ich möchte jetzt noch schnell zur Klinik fahren und einen Patienten besuchen«, sagte Daniel. »Begleitest du mich?«
Fee nickte zustimmend. Sie sah ihm an, daß er von Unruhe und Sorge erfüllt war.
*
Um so erleichterter waren sie dann beide, als Professor Manzold ihnen lächelnd entgegenkam und Daniel kräftig die Hand schüttelte.
»Es ist alles gutgegangen. Besser, als ich dachte«, sagte er. »Nur ein bißchen länger hat es gedauert.«
»Wirklich?« fragte Daniel stockend.
»Ein Märchenerzähler war ich noch nie«, erwiderte der Professor. »Sie können sich selbst überzeugen, Dan. Und unsere hübsche Fee steht Ihnen zur Seite. Das ist eine große Freude, Sie schon heute zu sehen, Mädchen. Seid ihr jetzt vereint in Freud und Leid?«
Damit brachte er die beiden nun doch ein bißchen in Verlegenheit.
»Für ein paar Tage«, sagte Fee verhalten.
»Um gemeinsam den Doktor zu feiern?« fragte der Professor verschmitzt.
»Können wir ihn feiern?« fragte Daniel rasch.
»Ich will dem Auditorium die Ehre lassen«, sagte Professor Manzold bedeutsam und legte den Finger auf den Mund, »sonst stellt man mich noch als Schwätzer hin.« Er legte seinen Arm um Fees Schultern. »Leider war ich ja verhindert, zur Einweihungsfeier zu kommen«, fuhr er fort, »aber das werde ich nachholen und unser hübsches Fräulein Doktor in Aktion unter die Lupe nehmen. Oder entscheidet sie sich gar, in einer Stadtpraxis mitzuarbeiten?«
»Nein, dafür entscheidet sie sich nicht«, sagte Daniel anstelle von Fee. »Ihre Therapie kann sie auf der Insel der Hoffnung besser anwenden.«
»Davon werde ich mich bestimmt persönlich überzeugen«, erklärte Professor Manzold.
»Was wir auch hoffen wollen«, sagte Daniel. »Einstweilen vielen Dank.«
»Wofür? Der Patient hat sich bei Ihnen zu bedanken, Dan. Ihre Diagnose war seine Rettung.«
Für Fee war es dann ein herzbewegender Augenblick, als Frau Glimmer mit Tränen in den Augen dankbar Daniels Hände ergriff.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr Doktor. Tausendmal Dank. Ich bin so glücklich.«
»Ich auch, Frau Glimmer«, erwiderte Daniel. »Ich will nur mal kurz zu Ihrem Mann hineinschauen.« Frau Glimmer nickte, dann erst schien sie Fee zu bemerken.
»In ein paar Wochen hätte es zu spät sein können«, flüsterte sie. »Wir haben es nur Dr. Norden zu verdanken, daß wir unsern Papa behalten dürfen. Verzeihen Sie, ich weiß ja gar nicht, ob Sie zu ihm gehören.«
»Ja, ich gehöre zu ihm«, erwiderte Fee, und da kam Daniel schon wieder aus der Tür.
»In ein paar Wochen wird Ihr Mann wieder daheim sein, Frau Glimmer«, sagte er. »Und wir zwei werden hübsch aufpassen, daß er sich nicht gleich wieder zuviel zumutet.«
»Da können Sie sicher sein, Herr Doktor«, sagte Frau Glimmer.
Daniel nahm Fees Arm und ging mit ihr hinaus in den strahlend schönen Tag. Er atmete tief auf. »Ja, so ist das Leben, Fee. Es ist ein beglückendes Gefühl, wenn Gutes dem Traurigen folgt. Wir zwei haben uns keinen leichten Beruf erwählt.«
»Viele andere auch nicht, aber wenn man den Beruf als Berufung auffaßt wie du –«
»Pssst«, fiel er ihr ins Wort. »Die Pflicht ruft, Fräulein Doktor.«
»Darf ich dir kein anerkennendes Wort sagen?« fragte Fee.
»Nein, das mag ich nicht.«
»Du bist ein seltsamer Mann, Daniel.«
»Weil ich dem Bild, das du dir von mir machtest, nicht ganz entspreche?« fragte er.
»Dem entsprichst du überhaupt nicht. Aber darf ich das nicht einmal aussprechen?«
»Das hast du eben schon«, sagte er mit leisem Lachen, »aber muß man alles aussprechen, was man denkt?«
Er drehte den Zündschlüssel um, und der Wagen sprang an. »Molly wollte doch heute zurückkommen«, sagte er. »Vielleicht wartet sie schon in der Praxis.«
»Dann brauchst du mich ja nicht mehr«, sagte Fee leise.
»Es kommt darauf an, wie du es auffaßt«, erwiderte Daniel mit einem rätselhaften Lächeln. »Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir einen ungestörten Abend zusammen verbringen könnten.«
Sie kamen mit ein paar Minuten Verspätung an, und zu Daniels Überraschung wartete kein Patient vor der Tür. Das hatte jedoch seinen Grund, denn Molly war schon da und bei der Arbeit.
»Sie hätten sich nicht abzuhetzen brauchen, Molly«, sagte Daniel, »Fee hätte Sie schon noch vertreten.«
»Aber Sie sind doch nicht hergekommen, um meine Arbeit zu machen«, sagte Molly zu Fee, die feststellte, daß die Ältere sehr angegriffen aussah.
»Es war recht lehrreich für mich«, meinte Fee. »Fahren Sie ruhig heim und ruhen Sie sich noch ein bißchen aus. Wie geht es Peter?«
»Er hat alles gut überstanden, und mein Mann ist auch außer Lebensgefahr«, erwiderte Molly. »Er hatte übrigens keine Schuld an dem Unfall.«
»Das habe ich schon vernommen«, sagte Daniel, der doch ein bißchen überrascht war, daß sie so selbstverständlich »mein Mann« sagte.
»Ich will auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen«, fuhr Molly beklommen fort, »aber wenn es möglich wäre, würde ich gern nur noch halbtags arbeiten. Jetzt muß ich mich auch ein bißchen um Heinz kümmern. Er wird ein paar Wochen im Krankenhaus bleiben müssen.«
»Darüber können wir noch reden«, sagte Daniel. »Fahren Sie wieder heim, Molly, und ruhen Sie sich erst mal aus.«
»Wird es Ihnen denn nicht zuviel, Fee?« fragte Molly.
»Nein, wirklich nicht.«
»Es ist so nett von Ihnen. Ich möchte mich herzlichst bedanken. Bestimmt war allerhand los.«
»Aber wir leben noch«, sagte Daniel, »und Herr Glimmer hat die Operation auch gut überstanden.«
»Oh, das freut mich«, sagte Molly, und ein heller Schein flog über ihr Gesicht. »Dann sage ich noch mal schönen Dank für alles.«.
»Ich würde mich freuen, wenn ich Sie einigermaßen würdig vertreten habe, Molly«, sagte Fee herzlich.
»Das glaube ich bestimmt«, erwiderte Molly. Und als sie gegangen war, sah Fee Daniel mit einem flüchtigen Lächeln an. »Bist du auch einigermaßen zufrieden, Chef?« fragte sie schelmisch.
»Sehr«, erwiderte er und zog sie rasch an sich. »Ich war schon lange nicht mehr so froh, Fee, obgleich es doch ein trauriger Tag war. Ich würde dir sehr gern einen Kuß geben.«
»Warum tust du es nicht?« fragte sie weich.
»Jetzt? Die Patienten warten. Darf ich heute abend darauf zurückkommen? Ich könnte sonst mit meinen Gedanken nicht bei der Sache sein.«
*
Gegen sechs Uhr rief Isabel an und fragte, ob Daniel kurz für sie zu sprechen sei. Gleich sah Fee für den Abend, auf den sie sich nun schon so gefreut hatte, schwarz.
Aber da es um Lorna Wilding und David Delorme ging, konnte Daniel keine Ausrede gebrauchen. Nachdem er ein kurzes Telefongespräch mit Isabel geführt hatte, sagte er zu Fee: »Isabel wird nachher kurz vorbeikommen. Es wird dich auch interessieren, was sie zu erzählen hat. Es betrifft deinen Schwarm.«
Er meinte es nur scherzhaft, aber sie bekam es doch in die falsche Kehle.
»Er ist nicht mein Schwarm«, protestierte sie.
»Das hat aber sogar dein Vater gesagt«, meinte Daniel neckend, »und mich hast du eifersüchtig gemacht.«
»Das ist doch gar nicht wahr. Du hast gesagt, daß es dir gleich sei.«
»Wann denn?«
»Erinnere dich mal«, sagte Fee.
»Wahrscheinlich rede ich manchmal ganz dummes Zeug«, sagte Daniel. »Wollen wir nicht ganz vergessen, was früher war, Fee? Komm mal her zu mir. Schau mich an.«
»Herr Doktor, es warten immer noch zwei Patienten«, sagte sie.
Er seufzte abgrundtief. »Dann herein mit ihnen, damit wir endlich fertig werden.«
Ganz fertig war er noch immer nicht, als Isabel erschien. Schick und selbstbewußt stand sie vor Fee.
»Sie machen sich ganz gut«, sagte sie leichthin. »Der rettende Engel!«
»Das gefällt mir besser, als die Fee vom Rosensee«, konterte Fee, dann sahen sie sich an und brachen in ein helles Lachen aus.
In diesem Augenblick verabschiedete Daniel den letzten Patienten.
»Ihr seid aber vergnügt«, sagte er erstaunt.
»Wir haben eben festgestellt, daß wir beide Humor haben«, sagte Isabel schlagfertig.
»Es würde mich auch sehr enttäuschen, wenn ihr euch nicht verstehen würdet«, sagte Daniel. »Begeben wir uns jetzt in gemütlichere Gefilde? Lenchen hat uns sicher etwas zu bieten.«
»Haben Sie etwas dagegen einzuwenden, Fee?« fragte Isabel.
»Ich, wieso denn? Daniel ist doch der Hausherr.«
»Na, dann wollen wir mal, ihr zwei Hübschen«, sagte er. »Ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast, Isabel. Du nicht auch, Feelein?«
Nun hat es ihn doch erwischt, dachte Isabel. Aber vielleicht war sie schon immer sein Traumbild, wie die Insel der Hoffnung der Traum seines Vaters war. Sollte sie eifersüchtig sein? Sollte sie grollen? Nein, das wollte sie nicht. Dann würde sie einen Freund verlieren, an dem ihr sehr viel lag.
Vielleicht begriff Fee instinktiv die Seelengröße dieser Frau, denn als sie Daniels Heim betraten, streckte sie Isabel die Hand entgegen.
Daniel sah es und ging schnell ins Bad. »Bin gleich wieder da«, rief er über die Schulter zurück.
»Daniel hat gesagt, daß Sie Freunde sind, Isabel«, sagte Fee leise. »Können wir auch Freunde sein?«
Isabel hielt den Atem an. Kann ich das, dachte sie beklommen. Soll ich kampflos aufgeben?
»Vielleicht bin ich zu impulsiv«, sagte Fee verlegen.
»Nein«, sagte Isabel. »Wir werden bestimmt gute Freunde werden.«
Für Lenchens argloses Gemüt war es gar nicht befremdlich, daß Daniel heute gleich mit zwei Damen kam. Sie tischte ein köstliches Mahl auf und war allem Anschein nach restlos zufrieden, daß es nicht gestört wurde.
Isabel erzählte von Lorna Wilding. »Ich habe lange mit ihr gesprochen, und sie scheint vernünftig geworden zu sein«, sagte sie. »Manchmal unterschätzt man die Frauen.«
Daniel warf ihr danach einen schrägen Blick zu, worauf sie errötete, aber geistesgegenwärtig in ihrem Bericht fortfuhr.
»Sie hat sich mit Gladys in Verbindung gesetzt, ja, das hat sie tatsächlich getan. Aber Gladys heiratet morgen. Sie hat David abgeschrieben. Wie wird er es aufnehmen?«
»Hoffentlich wie ein Mann, der seinen eigenen Weg zu gehen gedenkt«, sagte Daniel ruhig. »Was meinst du, Fee?«
»So genau kenne ich ihn wirklich noch nicht«, erwiderte sie.
»Man muß es ihm irgendwie beibringen«, sagte Isabel. »Würden Sie das übernehmen, Fee?«
»Warum nicht?« Fee sah Isabel gedankenvoll an. »Und was hat Lorna Wilding vor?«
»Sie wird hierbleiben und darauf warten, daß David zurückkommt. Sie würde ihn auch besuchen, wenn es ihm recht ist. Ich glaube jetzt, daß sie wirklich nur mütterliche Gefühle für ihn hegt. Mütter sind ja manchmal sehr egoistisch.«
»Auf jeden Fall wäre es ein Jammer, wenn die Musikliebhaber auf einen David Delorme verzichten müßten«, sagte Fee sinnend. »Als ich mir den Kittel kaufte, habe ich übrigens auch ganz zufällig eine Schallplatte von ihm gesehen.«
»Und natürlich gekauft?« fragte Daniel.
»Ja, ich habe sie gekauft. Ich wollte sie dir zum Abschied schenken, Daniel, weil ich weiß, daß du ihn doch auch magst.«
»Wer redet denn jetzt schon von Abschied«, sagte er.
»Ich zum Beispiel«, sagte Isabel. »Ich habe noch allerlei zu erledigen. Die Platte habe ich übrigens von Lorna Wilding geschenkt bekommen.«
»Die gleiche?« fragte Fee. »Die Mondscheinsonate und die Pathetique?«
»Es ist die einzige, die bisher von ihm existiert«, sagte Isabel, »aber hoffentlich nicht die letzte.«
»Ich glaube noch immer, daß er erst am Anfang steht«, sagte Fee. »Und ich hoffe auch, daß die Insel der Hoffnung dazu beiträgt, ganz zu sich selbst zu finden.«
»Ich würde auch gern einmal länger dort sein«, sagte Isabel.
»Kommen Sie doch«, sagte Fee ohne zu zögern. »Für Sie wird immer ein Platz sein.«
»Du bist aber großmütig, Fee«, sagte Daniel, als Isabel gegangen war.
»Nun übertreib aber nicht. Sie ist deine Freundin und wird auch meine Freundin sein.«
Er sah sie lange und forschend an. »In den paar Tagen hast du dich aber gewaltig geändert«, stellte er fest.
Plötzlich fühlte sie sich ganz frei und leicht. Tiefe Zärtlichkeit war in seinem Blick. So hatte er sie noch nie angesehen. Alle versteckten Andeutungen, die er bisher gemacht hatte, waren wie nebenbei gesagt worden und sie hatte nie recht gewußt, ob sie ganz ernst zu nehmen waren. Aber dieser Blick versprach und forderte auch alles an Gefühlen, und Fee lehnte sich wieder an ihn. Seine Arme umschlossen sie, und seine Lippen preßten sich an ihre Schläfe.
»Ein Beweis, daß sich auch Hund und Katze vertragen können«, sagte sie schelmisch.
»Was ist das für ein Vergleich«, lächelte Daniel
»Der stammt von Paps. Wenn einer sich wundern wird, wie gut wir uns verstehen, dann bestimmt er.«
»Da werden sich noch mehr wundern«, sagte Daniel, aber ob Johannes Cornelius wirklich zu jenen gehören würde, wagte er zu bezweifeln. Der mochte wohl schon viel früher damit gerechnet haben, daß aus ihnen mal ein Paar werden würde.
Daniel hielt den Atem an bei diesem Gedanken, der nun wirklich wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam. Bisher war er nur von Stimmungen eingefangen gewesen, aber jetzt wußte er genau, was er wollte. Er dachte zum ersten Mal ans Heiraten, an eine Familie, an die unlösliche Zusammengehörigkeit.
»Was denkst du, Daniel?« fragte Fee leise, als er sie nur schweigend immer fester an sich preßte.
»Bin ich nicht zu alt für dich?« fragte er.
»Wieso zu alt?« fragte sie verblüfft. »Kriegst du Komplexe?«
»Ein Mann in meinem Alter sollte doch schon verheiratet sein, damit die Kinder keinen Tattergreis zum Vater bekommen.«
»Wer redet denn da vom Heiraten?« fragte sie beklommen.
»Ich, oder ist noch jemand hier? Du bist noch so jung, Fee. Würdest du mich dennoch heiraten?«
Atemloses, berauschendes Glück nahm sie gefangen. Ihr Herz klopfte stürmisch bis in die Kehle hinein.
»Du fragst so wichtige Dinge ganz nebenbei?« flüsterte sie.
»Ganz nebenbei? Ich halte dich jetzt schon geraume Zeit in den Armen, so fest, daß du eigentlich spüren müßtest, was ich denke, fühle und wünsche.«
Er drehte sie zu sich um und seine Lippen legten sich zärtlich auf ihren bebenden Mund, und sie vergaßen alles um sich her, auch daß sie sich Davids Schallplatte hatten anhören wollen. Sie brauchten jetzt keine Musik. In ihnen war Musik und der Gleichklang ihrer Herzen.
*
Auf der Insel der Hoffnung brauchte man keine Schallplatten von David Delorme, und man brauchte auch keinen Eintritt zu zahlen, wenn man ihn höen wollte. Er wartete auch nicht, bis Zuhörer sich versammelt hatten. Mitten in einem Gespräch stand er plötzlich auf und ging zum Flügel. Und wenn dann die ersten Töne aufklangen, verstummte jedes Gespräch.
Heute spielte er schöner und inniger als je zuvor. Heute spielte er für Katja, die in ihrem Rollstuhl neben dem Flügel saß.
Dr. Cornelius hatte gegen Abend mit Erstaunen bemerkt, daß er plötzlich hinter dem Rollstuhl stand und ihn dann vor sich herschob.
Ein leises Erschrecken war über das leidvolle junge Gesicht des Mädchens gehuscht, als sie sich umwandte und bemerkte, wer ihren Stuhl da vorwärtsbewegte.
»Es ist ein schöner Abend«, sagte David. »Wir werden ein wenig die herrliche Luft genießen, Katja.«
Vielleicht war er so schnell mit ihr vertraut geworden, weil er sich in seiner Sprache mit ihr unterhalten konnte, vielleicht war es auch Mitgefühl mit diesem hilflosen Wesen.
In Anne Fischers feinem Gesicht spiegelten sich widersprüchliche Empfindungen, als sie den beiden nachblickte.
»Ob das gut für Katja ist«, sagte sie leise vor sich hin.
»Schlecht kann es nicht sein«, bemerkte Dr. Cornelius. »David hat so viel Gefühl, daß er bestimmt den richtigen Ton findet.«
Was die beiden miteinander gesprochen hatten, erfuhren sie nicht, und als sie jetzt im Musiksalon waren, störte sie niemand. Die Töne drangen nach draußen, zauberhafte, weiche Melodien, die keiner von ihnen kannte und die David hier noch nicht gespielt hatte.
»Von wem sind diese Lieder, David?« fragte Katja, als er seine Finger von den Tasten nahm.
»Von mir, eigene Kompositionen. Sie sind die erste, die sie hören.«
Ein rosiger Hauch überflutete ihr feines Gesichtchen, und ein Leuchten kam in ihre Augen.
»Es ist wunderschön«, flüsterte sie.
David rückte näher an sie heran und griff nach ihrer Hand. »Ich werde sie Katja widmen, die mich dazu inspiriert hat«, sagte er. »Ich lasse sie hier zurück, wenn ich wieder fortgehen muß, und ich werde sie erst wieder spielen, wenn ich hierher zurückkomme.«
»Sie wollen wiederkommen, David?« fragte Katja staunend.
»Ja, immer wieder. So oft ich Zeit habe. Ist es nicht seltsam, Katja, aber zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich an einem Platz zu Hause. Hier, auf der Insel der Hoffnung. Man wird zum Zigeuner, wenn man einen solchen Platz nicht hat.«
Katja entzog ihm ihre Hand und schob sie in ihre andere. Wie zum Gebet gefaltet lagen sie nun in ihrem Schoß.
»Ich habe mir gewünscht, viel von der Welt sehen zu können«, sagte sie leise.
»Ich habe schon viel gesehen«, sagte David, »aber nirgendwo war es so schön, so still wie hier. Nirgendwo war ich so glücklich und frei.«
Katja blickte zum Flügel. »Das ist doch Ihre Welt, David«, sagte sie sinnend.
»Ein Teil meiner Welt, gewiß. Werden Sie hierbleiben?« lenkte er ab.
»Wohin sollte ich wohl? Ich kann doch nicht gehen«, stieß sie hervor.
»Eines Tages werden Sie wieder gehen können«, sagte David eindringlich. »Glauben gibt Stärke.«
»Glauben Sie an Gott und seine Gerechtigkeit?« fragte Katja. »Warum hat er uns meinen Vater genommen und mir meinen Verlobten? Warum nimmt er gute Menschen so früh von dieser Welt? Soll man da nicht zu zweifeln beginnen?«
»Ohne Zweifel wird wohl kein Mensch sein, oder er täuscht sich selbst«, sagte David. »Jeder Mensch muß mit dem Schicksal fertig werden, das ihm auferlegt wird. Das sind große Worte, nicht wahr? Ich beginne auch erst darüber nachzudenken, seit ich hier bin. Aber das Leben bringt nicht nur Leid, Katja, es bringt auch Freude.«
An der Türe standen Johannes Cornelius und Anne Fischer. Die beiden jungen Menschen bemerkten sie nicht. Dr. Cornelius nahm Annes Arm und zog sie von der Tür fort.
»Die beiden können wir gut sich selbst überlassen«, sagte er draußen zu ihr und schickte einen Blick zum Sternenhimmel empor. »Ich glaube, daß Friedrich Nordens Geist unter uns ist«, fuhr er leise fort. »Ich glaube, daß sich sein heißes Wollen erfüllen wird, Anne.«
»Man kann nicht in der Vergangenheit verharren«, sagte sie sinnend. »Man muß in die Zukunft schauen.«
»Aber die Gegenwart darüber nicht vergessen«, sagte Dr. Cornelius.
Ein paar Tage später kam Fee zurück. Daß sie verändert war, sah ihr Vater sogleich. Ihm stockte der Atem, als er in ihr von innen heraus durchleuchtetes Gesicht blickte.
»Nun gehöre ich nicht mal zu den ersten, die dir zum Doktor gratulieren, mein Kind«, sagte er leise.
»Das ist nur ein Titel, Paps«, erwiderte Fee. »Was ich leisten werde, zählt mehr. Und ich möchte viel leisten.«
»Also kommst du mit Ehrgeiz vollgestopft«, meinte er. »Willst du Daniel beweisen, daß mehr in dir steckt, als für ein paar Tage eine gute Hilfe zu sein?«
»Ihm brauche ich nichts zu beweisen. Und mit ihm Hand in Hand zu arbeiten, soll nicht auf diese paar Tage beschränkt bleiben.« Sie unterbrach sich, als sie David gewahrte, der lächelnd auf sie zukam.
»Ich habe ihm einiges zu sagen, Paps«, erklärte Fee. »Wir sprechen uns später noch.«
Er konnte sich seinen Gedanken hingeben. Fee ging mit David durch den Park. Sie wußten nicht, daß Katja an ihrem Fenster saß und ihnen nachblickte, mit einem wehmuts- und entsagungsvollen Ausdruck.
»Lorna Wilding wartet auf eine Nachricht von Ihnen, David«, begann Fee zögernd. »Es scheint, daß sie zur Einsicht gekommen ist. Es war auch für sie gut, Abstand zu gewinnen.«
»Dann werden wir irgendwie den Weg zueinander wieder finden«, sagte er.
»Sie wollte auch diese Geschichte mit Gladys in Ordnung bringen«, fuhr Fee beklommen fort.
»Haben Sie mit Lorna gesprochen, Fee?« fragte David.
»Nein, Isabel hat mir alles gesagt. Gladys hat inzwischen geheiratet. Erst vor ein paar Tagen.«
Sie wunderte sich, daß er erleichtert aufatmete. »Es enttäuscht Sie nicht?« fragte sie überstürzt.
»Ich bin so weit davon entfernt«, erwiderte er leise. »Hier hat ein ganz anderes Leben für mich begonnen, Fee. Ich habe mich gefunden. Ich könnte meinen Weg jetzt auch allein gehen, aber ich vergesse nicht, daß ich Lorna Dank schulde. Gladys – das war etwas, wohin ich mich flüchten wollte, was meinem früheren Leben näherstand, da ich mich dem anderen Leben nicht gewachsen fühlte. Aber jetzt habe ich zu mir selbst gefunden. Ich lasse mich nicht mehr blenden von dem Ruhm, aber ich werde mich auch nicht mehr verkriechen. Mir bleiben hier jetzt nur noch ein paar Tage. Der Abschied wird mir sehr schwer werden, aber die Heimkehr wird dann um so schöner sein.«
»Die Heimkehr, David?« fragte Fee verhalten.
»Das ist ein Stück Heimat für mich geworden. Ich weiß jetzt, wo meine Gedanken Ruhe finden können, wenn sie wieder einmal in die Irre gehen. Meine Seele hat eine Heimat gefunden.«
»Das haben Sie schön gesagt, David«, flüsterte Fee.
Seine großen, dunklen, rätselhaften Augen blickten sie nachdenklich an. »Ich möchte jetzt zu Katja gehen«, sagte er leise. »Sie soll nicht vergeblich auf mich warten. Sie braucht sehr viel Zuspruch, Fee. Werden Sie Zeit für sie haben, wenn ich nicht mehr hier bin?«
»Aber gewiß, David«, erwiderte Fee mit schwingender Stimme.
Und als sie Minuten später das Zimmer ihres Vaters betrat, klangen weiche, zärtliche Töne an ihr Ohr.
Sie summte mit. »In mir klingt ein Lied, ein schönes Lied…«
»Du bist verliebt, mein Kind«, stellte Dr. Cornelius fest.
»Nein, Paps, ich bin nicht verliebt. Ich liebe Daniel, und wir werden heiraten, in ein paar Monaten, in einem Jahr, irgendwann, wenn er die Zeit dafür gekommen hält, auch hierherzukommen. Ein bißchen ökonomisch müssen wir schon denken, wenn wir eine Familie gründen wollen, meinst du nicht auch?«
Dr. Cornelius nahm seine Tochter in die Arme. »Mein liebes Kind«, sagte er weich, »damit wird sich wohl Friedrichs größter Wunsch erfüllen.«
»Deiner nicht auch, Paps?« fragte sie schelmisch. »Du hättest mich doch nicht mit Daniel nach München geschickt, wenn du dir nichts davon versprochen hättest.«
Er lachte leise. »So viel auf einmal allerdings nicht gleich«, sagte er. »Hoffentlich hast du darüber nicht vergessen, alles zu erledigen, was ich dir aufgetragen habe.«
»Ist alles in Ordnung, Paps«, erwiderte Fee. »Es waren die bisher ereignisreichsten Tage meines Lebens. Ich habe unsagbar viel gelernt. In den nächsten Wochen können wir übrigens mit einer ganzen Anzahl von Patienten rechnen. Mollys Mann wird herkommen, Franz Glimmer mit seiner Frau, Frau Neuner mit ihrem Sohn, der Anfang ist gemacht.«
»Der Anfang war schon gemacht«, sagte er und deutete hinaus aus dem Fenster. Fee sah, wie David Katjas Rollstuhl vor sich herschob.
»Wenn wir alle Patienten so schnell heilen können wie ihn, werden wir viel Freizeit haben«, lächelte Dr. Cornelius.
»Und was macht Frau Seidel?« fragte Fee.
»Unsere Henriette? Na, um die brauchen wir uns überhaupt nicht zu kümmern. Sie kümmert sich um alles. Sie kann nur leben, wenn sie sich nützlich machen kann, und deshalb haben wir beschlossen, sie immer hierzubehalten.«
*
Das war allerdings auch für Daniel eine Überraschung, als er dann am nächsten Wochenende kam. Die Sehnsucht nach Fee hatte ihn hergetrieben, und David Delorme wollte er doch Lebewohl sagen.
Er wollte ihn auch vorbereiten, daß Lorna kommen würde, um ihn abzuholen. Angekündigt hatte er sein Kommen aber nicht.
Fee unterhielt sich mit einigen Patienten, die am Vormittag neu angekommen waren, als sein Wagen vorfuhr.
Sie drehte sich um, und als er ausstieg, ging sie langsam auf ihn zu.
»Daniel«, sagte sie zärtlich, »so schnell bist du gekommen.«
»Ich hatte große Sehnsucht nach dir. Du fehlst mir, Feelein. Du fehlst mir sehr.«
Es war ein wundervolles Gefühl für sie, es war reinstes, verheißungsvollstes Glück.
Doch wenige Stunden später schlug für David die Stunde des Abschieds. Lorna war gekommen. Stumm ließ sie ihren Blick über die Insel der Hoffnung schweifen, dann wandte sie sich Dr. Cornelius zu.
»Ich werde auch einmal hierherkommen, wenn Sie mich aufnehmen, Dr. Cornelius«, sagte sie.
Ihre Augen wanderten zu David, der sich über Katja neigte und sie auf die Stirn küßte. Was er ihr sagte, konnte niemand verstehen.
Dann ging Daniel auf ihn zu. »Leben Sie wohl, David«, sagte er. »Alles Gute für Sie.«
»Ich sage auf Wiedersehen«, erwiderte David.
Und da weiteten sich Daniels Augen. Katja zog sich an den Lehnen des Rollstuhls empor und stand plötzlich aufrecht.
»David«, rief sie laut. Er drehte sich um und lief zu ihr zurück, gerade noch zur rechten Zeit kommend, um sie aufzufangen, als sie ein paar taumelnde Schritte auf ihn zumachte.
»Auf Wiedersehen, David«, stammelte sie, als seine Arme sich fest um ihren schmalen Körper legten.
»Und wenn ich wiederkomme, wirst du mir entgegenkommen, Katja«, sagte er. »Ich weiß es.«
Fassungslos barg Anne Fischer ihren Kopf an Dr. Cornelius’ Schulter. »Sie kann gehen. Katja kann gehen«, flüsterte sie.
Und noch ein Wunder geschah!
Lorna ging zu Katja und ergriff ihre Hand. »Er wird bestimmt wiederkommen«, sagte sie. »Und ich auch.«
»Was sollen wir uns noch wünschen, Fee?« fragte Daniel.
»Ich bin sehr unbescheiden. Ich wünsche mir sehr viel, aber vor allem, daß wir solche Augenblicke noch oft erleben, Daniel, mein Liebster!«
»Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist sicherlich die größte unter ihnen«, flüsterte Henriette Seidel.
»Frau Seidel«, rief Daniel freudig aus.
»Hier bin ich die Henriette, und wenn Sie mich in Zukunft sehen wollen, müssen Sie tatsächlich zu mir kommen, hierher«, erwiderte sie.
»Ja, Henriette bleibt bei uns«, lächelte Fee. »Sie ist uns unentbehrlich geworden.«
»So hat es Vater sich wohl in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt«, sagte Daniel. »So viel Glück auf dieser Insel.«
- E N D E -