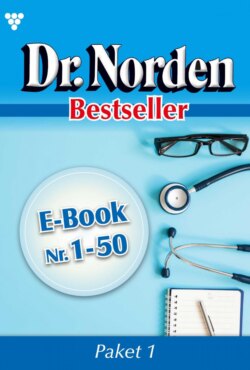Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»So, jetzt tut es mal ein bißchen weh, Herr Gradel«, sagte Dr. Daniel Norden zu seinem Patienten. »Aber dann haben wir es geschafft.«
»Wenn ich mich schon so dämlich anstelle, gehört es mir nicht anders«, sagte der biedere grauhaarige Hausmeister, der mit dem Daumen in die Brotschneidemaschine gekommen war. »Meine gute Hilde fehlt mir halt an allen Ecken und Enden.«
Dr. Norden hatte den Schnitt, der tiefgegangen war, geklammert und einen Schutzverband darübergelegt.
»Nun wird Ihre Frau ja bald wieder zurückkommen«, sagte er aufmunternd, »gut erholt und frei von allen Beschwerden.«
»Es muß das reinste Paradies sein«, sagte Herr Gradel. »Klingt ja auch schon so. Insel der Hoffnung. Es war sehr nett von Ihnen, daß Sie meine Frau dorthin geschickt haben. Sie hat die Erholung nötig gebraucht. Und bis sie zurückkommt, wird der Daumen wohl auch wieder verheilt sein, sonst sagt sie wieder, daß man mich nicht allein lassen kann. Aber Sie können wirklich alles, Herr Doktor.«
»Alles auch nicht«, erwiderte Dr. Norden lächelnd. Sein interessantes Gesicht wirkte durch dieses Lächeln noch anziehender.
»Den Krankenschein bringe ich noch«, sagte Herr Gradel.
»Ach was, schon erledigt«, erwiderte Dr. Norden. »Sie sind ja auch immer für uns da.«
»Wenn nur alle hier im Haus so nett wären wie Sie«, sagte der Mann, »aber bei manchen meint man ja, es macht ihnen Spaß, einen zu schikanieren.«
Das wußte Dr. Daniel Norden auch. Unfreundliche Zeitgenossen gab es überall, und welcher Hausmeister konnte es schon allen recht machen? Dabei war Herr Gradel wirklich ein zuverlässiger und stets freundlicher Mann, der mit allem Bescheid wußte. Nur mit der Brotschneidemaschine konnte er anscheinend nicht umgehen. Aber vielleicht war er wieder einmal mit seinen Gedanken bei seiner Frau gewesen, die nun schon die vierte Woche auf der Insel der Hoffnung weilte, jenem Sanatorium, dessen Initiator Daniel Nordens Vater gewesen war und das von Dr. Johannes Cornelius geleitet wurde.
Einen solchen Erholungsaufenthalt hätte sich Hilde Gradel nie leisten können. Von der Krankenkasse wäre sie irgendwohin geschickt worden, wo sie sich wahrscheinlich todunglücklich gefühlt hätte, denn die Trennung von ihrem Mann, mit dem sie über dreißig Jahre verheiratet war, fiel ihr schwer. Aber auf der Insel der Hoffnung brauchte sie sich nicht fremd zu fühlen. Dort herrschte der gleiche Geist, mit dem Dr. Daniel Norden auch seine Stadtpraxis betrieb, mit großem menschlichem Verständnis für seine Patienten, gleich, ob arm oder reich, mit leidenschaftlicher Hingabe an seinen Beruf, wie es einst sein Vater auch gehalten hatte.
Wenn man Daniel Norden nur flüchtig kannte, traute man es ihm nicht zu, daß er ein so gemütvoller Arzt war. Er wirkte eher wie ein Sportsmann, und nach seiner äußeren Erscheinung hätte man ihn auch für einen Filmstar halten können. Das war wohl auch ein Grund dafür, daß viele Frauen zu ihm kamen. Was ihn daran ein wenig störte, war die Tatsache, daß jede meinte, er müsse Zeit für ein Plauderstündchen haben.
Helga Moll, seine Sprechstundenhilfe, von ihm Molly genannt, mußte da manchmal ganz energisch, wenn auch mit aller Diskretion, einschreiten. Sie machte das allerdings sehr geschickt. Auch jetzt wieder, als Frau Brehmer gar keine Anstalten machte zu gehen.
»Dringender Anruf, Herr Doktor«, schallte es aus der Sprechanlage. »Herzanfall.«
»Sie entschuldigen, gnädige Frau«, sagte Dr. Norden zu Frau Brehmer. »Sie haben es vernommen.«
Wohl oder übel mußte sie jetzt gehen. »Lassen Sie sich doch nicht so hetzen«, sagte sie mit einem süßlichen Lächeln. »Das haben Sie doch gar nicht nötig.«
»Wenn ein Menschenleben auf dem Spiel steht?« fragte er, obgleich er annahm, daß Molly einmal wieder zu einer energischen Maßnahme Zuflucht genommen hatte, um die anhängliche Frau Brehmer aus der Praxis zu vertreiben.
Dem war aber nicht so. Der Notruf war wirklich gekommen. Und zwar von der Frau des Hoteliers Kürten. Schon der zweite Herzanfall innerhalb von vier Wochen.
Es war gut, daß Frau Brehmer die letzte Patientin gewesen war. Sie richtete es immer so ein, weil sie dann hoffte, daß Dr. Norden länger Zeit für sie haben würde.
Dr. Norden dachte daran nicht mehr, als er auf schnellstem Wege zu dem Hause der Kürtens fuhr, das in einer stillen Straße der Villenkolonie lag.
Ein sehr blasses, zierliches junges Mädchen öffnete ihm.
»Dr. Norden?« fragte sie leicht überrascht, doch scheu und bebend. »Ich bin Astrid Kürten. Papa geht es gar nicht gut.«
Dr. Norden schenkte ihr keine weitere Beachtung. Er eilte schon die Treppe hinauf, an deren oberem Absatz Frau Kürten mit sorgenvoller Miene stand.
»Diesmal ist es noch schlimmer«, sagte sie leise. Davon konnte er sich gleich darauf überzeugen.
»Diesmal muß Ihr Mann in die Klinik«, sagte er, nachdem er dem Kranken eine Spritze gegeben hatte. »Die Verantwortung, ihn zu Hause zu lassen, kann ich nicht übernehmen.«
»Aber Sie kennen doch meinen Mann«, sagte Frau Kürten erregt.
»Er muß unter ein Sauerstoffzelt«, sagte Dr. Norden, und schon war er auf dem Wege zum Telefon. Hier war höchste Eile geboten, und doch ahnte er noch nicht, daß das blasse junge Mädchen, das zitternd an der Tür lehnte, ihn einmal noch bedeutend mehr beschäftigen würde als ihr Vater.
Er verständigte die Klinik und bestellte den Krankenwagen.
»Ich werde ihn persönlich zu Professor Manzold bringen«, sagte er zu Astrid Kürten. »Nun weinen Sie doch nicht gleich. Ihrem Vater kann doch geholfen werden.«
Es läutete an der Tür. Es war noch nicht der Krankenwagen. Es war ein junges Mädchen, sehr hübsch und quicklebendig. Das Gegenteil von Astrid Kürten.
»Was ist denn bei euch los?« fragte sie.
»Papa ist schwer krank«, erwiderte Astrid unglücklich.
»Dann rühre ich mich später. Ich wollte dir nur verkünden, daß ich mich mit Wolf verlobt habe, Astrid.«
Ziemlich taktlos, dachte Dr. Norden, und er sah, wie Astrid schwankte.
»Herr Kürten ist sehr krank«, sagte er zu dem Mädchen, der nun glühende Röte ins Gesicht schoß.
»Entschuldigung, das war dumm von mir«, sagte sie. »Tut mir leid, Astrid. Alles Gute für deinen Vater.«
Dann sah sie Dr. Norden mit einem leicht herausfordernden Blick an. »Sie sollten sich vielleicht auch mal um Astrid kümmern«, sagte sie.
»Ich bin nicht krank«, stieß Astrid hervor, doch dann kam der Krankenwagen.
Das Mädchen verschwand schnell.
Dr. Norden bemerkte noch, daß Astrid mühsam nach Fassung rang, dann bemühte er sich um seinen Patienten, und wenig später fuhr er hinter dem Krankenwagen her zur Klinik.
*
Melanie Kürten hatte sich den Mantel angezogen. »Ich möchte auch zur Klinik fahren«, sagte sie. »Begleitest du mich, Astrid?«
»Ja, Mama«, erwiderte sie gehorsam wie ein kleines Mädchen.
»Deine Freundin Lilly ist sehr robust«, bemerkte Frau Kürten nebenbei. »Aber es wäre ganz gut, wenn du etwas von ihrem Selbstbewußtsein hättest.«
»Das habe ich nun mal nicht«, sagte Astrid trotzig.
»Habe ich richtig gehört, sie hat sich mit Wolf verlobt?« fragte Frau Kürten.
»Du hast richtig gehört«, erwiderte Astrid mit zitternder Stimme. »Aber ist Papa nicht wichtiger?«
»Natürlich ist er wichtiger, aber du machst mir auch Sorgen, Kleines.«
Sie machte sich ehrliche Sorgen um ihre Tochter. Sie war eine gute Mutter. Es tat ihr immer wieder weh, daß Astrid so gar nichts aus sich zu machen verstand. Ihre einzige Tochter, die sich doch alles erlauben könnte, und dazu war sie doch ein sehr intelligentes Mädchen.
Vor einem Jahr hatte sie ihr Abitur glänzend bestanden, dann noch ein Jahr die Hotelfachschule besucht. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, denn sie wollte in den väterlichen Betrieben arbeiten. So richtig ernst genommen hatten ihre Eltern diesen Wunsch nie, aber dieses eine Mal hatte Astrid ihren Willen durchgesetzt.
In sie hineinschauen konnte man nicht. Während Melanie Kürten mit Astrid im Wartezimmer der Klinik saß, versuchte sie es, aber sie mußte wieder einmal feststellen, daß ihre Tochter ihr ein Rätsel war.
Sie hat mir Wolf weggenommen, dachte Astrid. So einfach war das für sie, und ich habe gedacht, sie sei meine Freundin.
So etwas durfte sie nicht denken! Ihr Vater schwebte in Lebensgefahr. Ihr Vater mußte ihr mehr bedeuten als Wolfgang Bender.
*
Karl Kürten war indessen schon wieder bei Bewußtsein, und gleich begehrte er wieder auf. Dr. Norden hatte das schon erwartet, als der Kranke die Augen aufschlug. Er kannte ihn, diesen Mann, der sich nicht unterkriegen lassen wollte, der nie aufgab. Und er mochte ihn, weil er wußte, daß sein Lebenswille stärker war als sein Herz.
»Was soll das bedeuten?« fragte Karl Kürten.
»Daß Sie unter einem Sauerstoffzelt liegen und die ärztlichen Anweisungen befolgen müssen«, erwiderte Dr. Norden trocken.
»Das können Sie nicht mit mir machen«, begehrte der Kranke auf.
»Sie dürfen jetzt auch nicht reden«, sagte Daniel Norden energisch. »Oder wollen Sie, daß mir der Vorwurf gemacht wird, ich hätte meine Pflichten versäumt?«
Damit konnte er ihn am ehesten zum Schweigen bringen. Karl Kürten war ein gerechtdenkender Mann, der keinem anderen Menschen Schwierigkeiten bereiten wollte.
Er hatte sein Leben lang gearbeitet und nicht auf seine Gesundheit geachtet. Er gönnte sich kaum einen Urlaub, und man mußte schon schweres Geschütz auffahren, um ihm klarzumachen, daß das Herz der Motor des Menschen war und ab und zu eben auch einer Überholung bedurfte.
»Hoffentlich regt Melanie sich nicht zu sehr auf«, sagte er, »und dann, Herr Doktor, kümmern Sie sich auch mal um meine Kleine.«
Das war innerhalb kurzer Zeit zum zweitenmal, daß ihn jemand dazu aufforderte. Zuerst dieses resolute Mädchen, dann der besorgte Vater.
»Werden Sie jetzt erst mal gesund«, sagte Dr. Norden.
»Das kommt nur vom Wetter«, sagte Karl Kürten.
»Das ist das Herz«, erklärte Dr. Norden mit ernstem Nachdruck. »Darüber werden wir uns einmal ganz ernsthaft unterhalten. Professor Manzold versteht keinen Spaß, lieber Herr Kürten.«
»Und Sie drücken sich.«
»Ich drücke mich nicht. Sie dürfen mir schon zutrauen, daß ich genau weiß, wann der Hausarzt nicht ausreicht.«
»Ich habe aber zu keinem andern Arzt Vertrauen.«
»Zu Professor Manzold können Sie es haben. Und nun seien Sie einmal vernünftig, Herr Kürten.«
Frau Kürten konnte er wenigstens beruhigen. Dabei sah er sich Astrid genauer an. Blaß, schlecht durchblutet war sie und sehr zart. Aber er konnte sie nicht einfach zu einer gründlichen Untersuchung zitieren.
»Morgen können Sie Ihren Mann kurz besuchen, Frau Kürten«, sagte er. »Ich werde auf dem laufenden gehalten.«
Für eine Mittagspause hatte er kaum noch Zeit. Sein gutes, treues Lenchen wartete wieder mal mit dem Essen, und er würgte nur ein paar Bissen hinunter. Seine Wohnung lag im Penthouse des Gebäudes, in dem sich auch seine Praxis befand. Es war eine ebenso komfortable wie gemütliche Wohnung, deren Ruhe er aber leider viel zu selten genießen konnte.
Er mußte jetzt noch eine ganze Anzahl Krankenbesuche machen, und um vier Uhr begann schon wieder die Sprechstunde. Aber so viel Zeit nahm er sich doch, einmal das Sanatorium anzurufen, die Insel der Hoffnung, denn er wollte die Stimme von Felicitas Cornelius hören, von seiner kleinen Fee, mit der er sich nun doch zusammengerauft hatte.
Aber sie war nicht da. Er konnte nur mit Anne Fischer sprechen, die die Verwaltung des Sanatoriums leitete. Dr. Cornelius war gerade bei einer Untersuchung. Sonst sei alles in Ordnung, erklärte ihm Anne. Sie wären voll belegt, und eine Menge Anmeldungen lägen bereits vor.
Und Fräulein Dr. Cornelius sei nicht erreichbar? Daniel fragte es mit einem unterschwelligen Gefühl der Eifersucht. Sehr formell, so, wie er es mit Fee verabredet hatte, denn ihre privaten Beziehungen waren noch ganz inoffizielle.
Für Anne Fischer allerdings nicht. Sie hörte die Ungeduld aus seiner Stimme und lächelte.
»Nein, heute und morgen nicht. Sie ist weggefahren«, erwiderte sie.
Daniel fragte nicht mehr. Er war gekränkt und sogar ein bißchen zornig. Wohin ist sie gefahren? überlegte er. Warum hat sie mich nicht angerufen? Und geschrieben hat sie schon eine ganze Woche nicht.
Aber deshalb konnte er seine Patienten nicht warten lassen. Lenchen sah ihm kopfschüttelnd nach, als er grußlos an ihr vorbei zur Tür hinausstürmte. Dem pressiert’s aber wieder mal, dachte sie. Eigentlich aber war sie es gar nicht von ihm gewohnt, daß er so ein finsteres Gesicht machte.
Als Dr. Norden unten aus dem Lift stieg, stand jenes junge Mädchen vor ihm, das er am Vormittag schon in der Villa Kürten gesehen hatte, und jetzt wußte er auch, woher sie ihm bekannt war. Sie arbeitete in einem der Büros, die sich hier im Hause befanden.
Lilly Friedingers Mittagspause war beendet. »Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick, Herr Dr. Norden«, sagte sie zurückhaltend. »Darf ich mich erkundigen, wie es Herrn Kürten geht?«
»Den Umständen entsprechend«, erwiderte er. »Ich muß weiter.«
»Ich hätte Sie auch gern konsultiert«, sagte sie.
»Bitte, die Sprechzeiten stehen an der Tür.«
Er eilte zu seinem Wagen. Im allgemeinen war er nicht so kurz angebunden, aber er erinnerte sich jetzt gut an die Taktlosigkeit dieses Mädchens, und außerdem war er mit seinen Gedanken bei Fee. Wo mochte sie nur sein?
*
»Dr. Norden hat angerufen«, sagte Anne Fischer zu Dr. Cornelius. »Er wollte Fee sprechen.« In ihren Augen blitzte es schelmisch.
Dr. Cornelius konnte sich nur freuen, daß das Leid aus diesen schönen, warmen Augen verschwunden war.
»Fee will ihn überraschen«, sagte Dr. Johannes Cornelius.
»Ich habe nichts verraten«, erwiderte Anne Fischer mit einem flüchtigen Lächeln.
»Sie bekommen einmal einen tüchtigen Schwiegersohn, Johannes.«
»Soweit ist es noch nicht«, erwiderte er. »Gut Ding will Weile haben, und das ist auch recht so.«
»Sie möchten Fee noch hierbehalten«, meinte Anne nachsichtig.
»Ist das nicht zu verstehen?« fragte er. »Ich hatte es mir so schön vorgestellt, Fee hatte es sich doch auch gewünscht, aber Daniel will die Praxis sicher noch ein paar Jahre behalten, bevor er sich entscheidet, hierherzukommen.«
»Das wird allerdings auch notwendig sein, wenn er uns so viele Patienten schickt, die für die entstehenden Kosten gar nicht aufkommen können«, meinte sie sachlich. »Sonst geraten wir bald in die roten Zahlen.«
»Sein Vater hat es sich so vorgestellt, Anne, und daran hält sich Daniel«, sagte Dr. Cornelius. »Reiche Leute können sich jeden Sanatoriumsaufenthalt leisten. Die Armen müssen mit dem vorliebnehmen, was man ihnen zugesteht. Hier soll es nicht so sein, und damit haben wir doch schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Die Menschen finden nicht nur zurück zur Natur, sondern auch Kontakt zu ihren Mitmenschen, die vom Schicksal nicht so begünstigt sind. Sie halten das doch auch für richtig, Anne.«
»Ich schon, aber das Bankkonto nicht. Allerdings haben wir schon ein paar edle Spender. Von Herrn Delorme sind heute fünftausend Euro überwiesen worden. Er vergißt uns wirklich nicht.«
»Er vergißt vor allem Katja nicht, wie es scheint. Sie hat heute einen Brief von ihm aus Barcelona bekommen.«
»Ihnen entgeht auch nichts, Johannes«, sagte sie im Neckton.
»Ich interessiere mich für Briefmarken«, erwiderte Dr. Cornelius schmunzelnd.
Katja Fischer, Annes Tochter, hatte in ihrem jungen Leben schon viel leiden müssen. Im vergangenen Winter war sie beim Skifahren mit ihrem Verlobten in eine Lawine geraten. Er war dabei getötet worden und sie durch den Schock lange Monate gelähmt gewesen. Eine Schocklähmung, die sich dann behoben hatte, als sie hier auf der Insel der Hoffnung den jungen Pianisten David Delorme kennenlernte.
Es war nun nicht so, daß Katja gleich wieder frisch und munter war von einer Stunde zur andern. Sie mußte sachgemäß behandelt werden. Aber Anne Fischer, die auch ihren Mann verloren hatte, ein paar Monate, bevor der nächste Schicksalsschlag sie traf, konnte sich nun schon freuen, welche Fortschritte Katjas Genesung machte, wie sicher sie jetzt schon ohne Stock gehen konnte.
An diesem Tag kam sie schon ganz beschwingt daher. Ihr zartes Gesicht war rosig überhaucht.
»David hat aus Barcelona geschrieben«, erzählte sie freudig. »Er hat riesigen Erfolg. Anschließend macht er eine Südafrika-Tournee, und dann will er sich wieder ein paar Wochen hier ausruhen. Hättest du das gedacht, Mutti?«
»Es freut mich«, sagte Anne, aber sie dachte auch dabei, daß Katja sich hoffentlich nicht zu große Hoffnungen in bezug auf David Delorme machte. Ein Künstler von seinem Rang war dauernd unterwegs in aller Welt, und er wurde von den Frauen umschwärmt. Sie wünschte Katja ein beständiges Glück. Ja, sie wünschte es von ganzem Herzen für ihr einziges Kind, das alles war, was ihr von einem großen Glück geblieben war. Allerdings konnte sie nicht übersehen, daß David regelmäßig schrieb. Das würde er wohl nicht tun, wenn sie ihm nicht viel bedeuten würde.
»Ob Fee nicht vergißt, mir seine neueste Platte mitzubringen?« fragte Katja.
»Sie wird es schon nicht vergessen, Liebes«, erwiderte Anne. »Aber vielleicht gibt es die bei uns noch gar nicht.«
Die junge Ärztin Dr. Felicitas Cornelius hatte an noch mehr zu denken als an die Schallplatte von David Delorme, und vor allem dachte sie daran, was Daniel wohl für ein Gesicht machen würde, wenn sie plötzlich vor ihm stand, als sie auf dem Wege nach München war, das nun schon als verhangene Silhouette vor ihren Augen auftauchte.
Strahlender Sonnenschein hatte sie auf der ganzen Fahrt begleitet, aber über der Stadt hing wieder eine Dunstglocke.
Und diese endlose Kette von Autos, die nun vor ihr herfuhr! Zermürbend war das. Die Menschen mußten
ja krank werden. Nein, ständig würde sie in der Stadt nicht mehr leben können, so reizvoll München auch immer für sie gewesen war. Aber seit sie draußen waren auf der Roseninsel, ihrer Insel der Hoffnung, gab es in München nur noch einen Anziehungspunkt für sie: Daniel Norden!
Um nur ja nicht die Schallplatte für Katja zu vergessen, suchte sie zuallererst ein großes Schallplattengeschäft auf, und zum Glück bekam sie diese Platte. Sie kaufte sie gleich zweimal. Eine wollte sie Daniel als Geschenk mitbringen, denn schließlich war David sein Schützling.
Und eifersüchtig ist er auch auf ihn gewesen, dachte Felicitas mit einem verträumten Lächeln. Eifersüchtig, weil sie für den genialen jungen Pianisten so viel übrig hatte. Allerdings nur für die Art, wie er spielte. Als Mann hatte ihr immer nur einer gefallen, nämlich Daniel, wenngleich sie es verstand, dies lange für sich zu behalten.
Punkt vier Uhr erreichte sie Daniels Praxis, wie sie es sich vorgenommen hatte. Er war noch nicht da, aber Helga Moll waltete schon ihres Amtes. Sie riß die Augen ganz weit auf, als Felicitas so plötzlich vor ihr stand.
»Guten Tag, Molly«, sagte Felicitas fröhlich. »Überrascht?«
»Und wie«, entgegnete Molly. »Ist etwas mit meinem Mann?« fragte sie dann stockend.
Hans Moll, eigentlich Helgas geschiedener Mann, wenn es jetzt auch so schien, als würden sie doch wieder zueinander finden, befand sich nach einem schweren, unverschuldeten Autounfall ebenfalls auf der Insel der Hoffnung.
»Nein, es geht ihm gut«, erwiderte Felicitas. »Deswegen komme ich nicht, obgleich ich berichten kann, daß er sich herausmacht und wir ihn tüchtig einspannen.«
»Das wird ihm guttun«, sagte Helga Moll. »Vielleicht lernt er doch noch, richtig zu arbeiten.«
Das war ihr großer Kummer gewesen und auch der Grund dafür, daß sie sich scheiden ließ. Nirgendwo hatte es der unstete Hans Moll ausgehalten. Immer hatte Helga für den Unterhalt der Familie sorgen müssen, damit ihre drei wohlgeratenen Kinder eine richtige Ausbildung bekommen konnten.
»Er ist wirklich sehr anstellig«, erklärte Felicitas. »Er mausert sich zu einem Faktotum, und wenn er Lust
hat, kann er sich bei uns seinen Lebensunterhalt verdienen.«
»Abwarten«, sagte Helga Moll skeptisch. »Neue Besen kehren gut. Aber vielleicht hat er diesmal richtig eins aufs Dach gekriegt.«
So war diese Helga Moll, zweiundvierzig Jahre alt und noch sehr appetitlich anzusehen, mit beiden Beinen fest im Leben stehend. Eine berufstätige Frau und auch eine fürsorgliche Mutter.
Felicitas empfand Bewunderung für sie. Daniel hatte in ihr wahrhaft eine tüchtige Hilfe, und für sie war es beruhigend, daß nicht ein junges, hübsches Ding um ihn herumflatterte. Denn, das mußte wohl gesagt werden, auch Felicitas war nicht frei von Eifersucht, denn sie wußte, wie umschwärmt Daniel Norden war.
»Dr. Norden muß bald kommen«, sagte Helga Moll. »Heute geht es wieder heiß her.«
»Wann geht es nicht heiß her bei euch«, sagte Felicitas, und da trat auch schon die nächste Patientin ein.
Es war Lilly Friedinger, forsch, wie Dr. Norden sie kennengelernt hatte, und wie auch Helga Moll sie aus flüchtigen Begegnungen kannte.
Sie runzelte die Stirn. »Ich bin angemeldet bei Dr. Norden«, sagte Lilly. »Ich habe ihn heute mittag getroffen.«
»Er hat nichts notiert für heute«, erwiderte Helga Moll gelassen.
»Sie können es mir schon glauben«, sagte Lilly herablassend. Dann wurde Felicitas von ihr gemustert.
»Dr. Norden macht noch Besuche«, sagte Molly.
»Dann werde ich warten. Ich habe mir extra freigenommen.«
Molly zuckte die Schultern und deutete auf das Wartezimmer, in dem Lilly dann auch verschwand.
»Sie ist in einem Immobilienbüro hier im Hause beschäftigt«, sagte sie erklärend. »Ich kenne sie vom Sehen. Ist mächtig von sich überzeugt.«
Wieder eine, die mehr den Mann, als den Arzt sucht, sagte sich Felicitas.
Und dann kam er. Er blieb in der Tür stehen wie erstarrt, als er Felicitas sah.
»Fee«, sagte er dann leise und sehr zärtlich, und ein glückliches Lächeln war in seinen Augen. Schnell zog Helga Moll sich in das Sprechzimmer zurück. Daniel streckte die Arme nach Fee aus und zog sie an sich.
»Vorsicht«, sagte sie flüsternd, »es sind schon Patienten da.«
Er küßte sie dennoch. »Du, ich habe heute mittag bei euch angerufen, aber Frau Fischer hat mir nicht gesagt, daß du in München bist.«
»Da bin ich wohl gerade losgefahren. Ich wollte dich überraschen, Daniel.«
»Und sehen, ob ich auch brav bin?« fragte er verschmitzt.
Wie er sie durchschaute! Sie wurde rot. »Ich habe einiges zu erledigen«, erklärte sie rasch. »Ich bleibe bis morgen.«
»Das ist wunderbar. Geh hinauf zu Lenchen. Sie wird dich verwöhnen. Ich sehe zu, daß ich so schnell wie möglich fertig werde.«
»Die Pflicht kommt vor dem Vergnügen«, sagte sie, glücklich darüber, daß er sich so freute. »Ich werde noch ein paar Besorgungen machen, und dann warte ich oben auf dich.«
»Fein«, sagte er und gab ihr noch einen zärtlichen Kuß.
»Laß dich nicht verführen«, raunte sie ihm schelmisch zu. »Da sitzt eine ganz flotte Biene im Sprechzimmer.«
Eine halbe Stunde später, nachdem er ein paar Stammpatienten abgefertigt hatte, saß ihm eine flotte Biene gegenüber.
Lilly schlug ihre langen, schlanken Beine übereinander und lehnte sich zurück. »Sie hatten mich nicht vorgemerkt, Herr Doktor«, sagte sie spöttisch.
»Ich wußte nicht, daß Sie gleich heute kommen wollten«, gab er gleichmütig zurück. »Nun, wo drückt der Schuh?«
»Eigentlich komme ich wegen Astrid. Astrid Kürten ist meine Freundin. Ich bin besorgt um sie.«
Der Tonfall ließ an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln. Er verstand es recht gut, sie einzuschätzen. Ein Mädchen, das seine Ellenbogen zu gebrauchen verstand, mehr raffiniert als intelligent und gewohnt, jede Chance zu nutzen.
»Wenn Fräulein Kürten Beschwerden hat, kann sie mich selbst konsultieren«, sagte er kühl.
»Ach, das ist so eine verfahrene Geschichte. Ich fühle mich verpflichtet, etwas für sie zu tun. Ich will nicht, daß sie böse mit mir ist. Wissen Sie, die ganze Sache liegt so: Sie ist reich, ich muß mir mein Geld verdienen. Wir waren zusammen auf der Schule. Sie hat das Abitur gemacht, ich mußte mit mittlerer Reife abgehen und eine Handelsschule besuchen. Wir blieben Freundinnen.«
Warum, dachte Dr. Norden? Weil es ihr schmeichelt, eine reiche Freundin zu haben, und was bedeutete solche Freundschaft schon in menschlicher Beziehung?
Und warum erzählte sie ihm das? Er war nun doch neugierig.
»Na ja, und nun ist es so, daß der Mann, für den Astrid geschwärmt hat, mich heiraten will. Das ist natürlich ein Konfliktsituation für mich.«
Eine Konfliktsituation? fragte sich Dr. Norden, doch eher ein Triumph! Sonst wäre sie ja auch nicht mit der Tür ins Haus gefallen, noch dazu, wo sie gerade erfahren hatte, daß es Herrn Kürten schlechtging.
»Astrid ist nicht Fisch und nicht Fleisch«, fuhr Lilly Friedinger fort. »Sie ist eine Mimose, und ich möchte wirklich etwas für sie tun, da ihre Eltern das anscheinend versäumen. Sie kann doch nicht gesund sein, so, wie sie immer aussieht, und da ist es doch kein Wunder, daß ein Mann kein Interesse hat. Sie hat sich vielleicht eingebildet, daß Wolf sie heiratet, weil er doch Geschäftsführer bei ihrem Vater ist, aber Geld allein macht’s eben auch nicht.«
Welche Überheblichkeit, dachte Daniel Norden. Ein sarkastisches Lächeln legte sich um seinen Mund.
»Was bezwecken Sie eigentlich?« fragte er.
Leicht irritiert sah sie ihn an. »Ich habe Wolf versprochen, daß ich es ihr schonend beibringe«, sagte sie unsicher.
»Was Sie ja nicht gerade getan haben«, bemerkte er nun doch, obgleich er keine Stellung hatte beziehen wollen.
»Sie haben einen falschen Eindruck von mir gewonnen. Es tut mir leid. Ich bin zu impulsiv, aber ich will Astrid wirklich nicht kränken.«
»Ich bin Arzt, kein Psychotherapeut«, erklärte Daniel. »Sie sind an der falschen Adresse, Fräulein Friedinger.«
»Na ja, bei der Gelegenheit wollte ich mir auch Antibabypillen von Ihnen verschreiben lassen«, sagte sie.
»Da wenden Sie sich besser an einen Kollegen von der Gynäkologie«, sagte er, »ich bin da vorsichtig. Entschuldigen Sie, aber es warten noch Patienten, die vorgemerkt sind.«
Kümmern Sie sich um meine Kleine, hatte Herr Kürten zu ihm gesagt. Notwendig war das vielleicht schon, aber was hatte Lilly Friedinger für ein Interesse daran? Genügte es ihr nicht, daß sie diesem scheuen Mädchen den Mann weggenommen hatte, den Astrid Kürten vielleicht tiefer liebt, als dieses oberflächliche Geschöpf?
Daniel Norden meinte, die Frauen ganz gut zu kennen, aber er wäre doch sehr überrascht gewesen, wenn er Lillys Beweggründe durchschaut hätte.
*
»Du hast ja Komplexe, Wolf«, sagte sie zu dem jungen Mann, mit dem sie sich wenig später traf. »Astrids wegen brauchst du dir wahrhaftig keine Gedanken zu machen. Sie hat doch längst beide Augen auf Dr. Norden geworfen. Er geht doch bei ihnen ein und aus.«
Wolfgang Bender war kein besonders guter Frauenkenner. Lilly war er ganz und gar nicht gewachsen. Und von einer offiziellen Verlobung konnte augenblicklich noch gar nicht die Rede sein. Er war völlig ahnungslos, mit welcher Intrige sie diese bewerkstelligen wollte.
Er war ein gutaussehender junger Mann, und er hatte es in jungen Jahren schon zu etwas gebracht. Das imponierte Lilly.
Daß er ungemein tüchtig war, wurde ihm von Karl Kürten hoch honoriert. Er hatte Verstand, aber auch Herz.
»Ich mag Astrid gern«, sagte er.
»Aber du hast doch keine Chance. Ihr Vater würde dich nur für einen Mitgiftjäger halten, und er schirmt sein Goldstück doch ab«, sagte Lilly. »Und mich hast du doch auch gern, Wolf. Hast du den gestrigen Abend schon vergessen?«
So gern wollte er sich daran gar nicht erinnern. Er war beschwipst gewesen, und Lilly hatte wirklich alle ihre Reize ausgespielt.
Als sie sah, wie unbehaglich es ihm war, verengten sich ihre Augen.
»Ich bin kein Spielzeug«, warf sie ihm vor. »Ich habe zwar nicht so viel Geld wie Astrid, meinen Stolz habe ich auch.«
Warum habe ich mich nur mit ihr eingelassen, dachte er, und zum ersten Mal fragte er sich auch, wieso sie eigentlich Astrids Freundin wäre.
»Astrid hat etwas für Dr. Norden übrig. Das weiß ich«, sagte Lilly. »Sie meint nur, daß du dir Hoffnungen gemacht hast und will dich nicht spüren lassen, daß du doch nur ein Angestellter ihres Vaters bist. Denk doch mal nach, Wolf, das ist doch auch für dich eine fatale Situation.«
»Ich bin kein Mitgiftjäger«, stieß er hervor, »und ich glaube, das weiß Astrid sehr gut.«
»Sie weiß auch, daß wir jetzt verlobt sind«, sagte Lilly, »und sie hat es gleichmütig hingenommen.«
»Wieso verlobt?« fragte er stockend.
»Wir haben uns gestern abend verlobt, mein Lieber, falls du das schon wieder vergessen haben solltest.«
»Das war doch nur eine Flachserei«, sagte er tonlos.
Ihr Gesicht bekam einen gehässigen Ausdruck. »Für mich nicht. Ich spaße mit solchen Dingen nicht. Aber du bist wohl doch auf Astrids Geld aus, denn diese kleine graue Maus kann dich doch wohl kaum in Entzücken versetzen.«
Er starrte Lilly an. »Wie redest du nur plötzlich von Astrid«, sagte er heiser. »Ich denke, du bist ihre Freundin?«
»Es hat alles seine Grenzen«, sagte sie. »Ich liebe dich, und du liebst mich, das hat sich doch gestern erwiesen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was dir an Anstrid gefallen könnte, außer, daß sie Karl Kürtens Tochter ist. Freundschaft hin, Freundschaft her, aber blind bin ich nicht.«
»Du bist gefühllos, Lilly«, sagte er. »Du bist nicht Astrids Freundin.«
»Nicht mehr, wenn es darum geht, daß du ihrem Geld den Vorzug geben willst«, stieß sie hervor.
»Es geht doch nicht um das Geld«, sagte er leise. »Es geht doch darum, daß sie Werte hat, die mehr bedeuten als Äußerlichkeiten. Und jetzt ist ihr Vater schwer krank.«
»Und Dr. Norden tröstet sie«, sagte Lilly gelassen. »Du bist töricht, Wolf, wenn du meinst, daß Astrid sich für dich entschieden hätte.«
»Hör doch damit auf. Davon war nie die Rede«, sagte Wolfgang Bender gereizt. »Ich will nicht, daß du über mich verfügst, hörst du? Wir waren gestern abend fröhlich beisammen, aber wie kannst du Astrid sagen, wir hätten uns verlobt?«
Ihre Augen verengten sich noch mehr. »Weil es mir ernst war, Wolf«, sagte sie. »Und weil ich es nicht vertrage, daß man über dich lächelt.«
Seine grauen Augen wurden ganz dunkel. »Wer könnte über mich lächeln?« fragte er heiser.
»Die reichen Kürtens zum Beispiel.«
»Mach dich doch nicht lächerlich. Herr Kürten weiß, daß ich mein Bestes tue, um ihn zu entlasten. Jetzt muß ich zu ihm fahren.«
»Um ihm zu sagen, daß du viel lieber seine Tochter mit einer angemessenen Mitgift heiraten würdest, als eine kleine Sekretärin?« fragte Lilly höhnisch.
»Um ihm Bericht zu erstatten«, sagte Wolfgang Bender kalt.
»Wir reden aneinander vorbei, Lilly. Ich habe dich für ein lustiges, nettes Mädchen gehalten und für Astrids Freundin. Darin habe ich mich wohl getäuscht.«
»Du bist ein Narr«, sagte Lilly. »Ich wollte dir nur eine Blamage ersparen.«
»So leicht blamiere ich mich nicht«, sagte er. »Misch dich nicht in meine Angelegenheiten.«
*
Lilly überlegte nicht lange. Als Wolf sich von ihr getrennt hatte, fuhr sie auf schnellstem Wege zur Villa der Kürtens.
Sie atmete auf, als das Hausmädchen ihr sagte, daß Astrid daheim sei.
Allerdings schien Astrid nicht sonderlich erfreut über ihren Besuch zu sein.
»Ich wollte gerade in die Klinik fahren«, sagte sie niedergeschlagen.
»Soviel ich eben von Wolf hörte, ist er zu deinem Vater zitiert worden«, sagte Lilly. »So schlecht kann es ihm doch nicht gehen.«
»Es sind gerade sehr wichtige Verhandlungen im Gange«, erwiderte Astrid tonlos.
»Ich habe mich heute vormittag dumm benommen, Astrid«, sagte Lilly. »Verzeih es mir bitte. Wolf hat mich erst darauf gebracht, daß es taktlos von mir gewesen war.«
»Wieso?« fragte Astrid.
»Er ist der Meinung, daß du viel für ihn übrig hast«, sagte Lilly leichthin.
»Eine irrige Annahme«, sagte Astrid abweisend.
»Das habe ich ihm auch gesagt. Du kennst mich doch, Astrid. Ich will dich nicht verletzen, und Wolf wollte auch nie in den Verdacht geraten, daß er sich um dich bemüht, weil du eben die Tochter eines reichen Vaters bist.«
Ein Zucken lief über Astrids schmales Gesicht. Lilly war sehr zufrieden mit sich. Sie fand, daß sie ihre Worte sehr gut gewählt hatte.
»Er tut wirklich sein möglichstes, um deinen Vater zufriedenzustellen, und ich hoffe nicht, daß du uns jetzt böse bist, wenn wir heiraten«, fuhr sie fort. »Vielleicht hat er dir doch mehr bedeutet, als ich annehmen konnte.«
»Du irrst dich«, erwiderte Astrid mit gekünstelter Ruhe. »Müssen wir darüber sprechen? Ich mache mir große Sorgen um Papa.«
»Aber das brauchst du doch nicht. Er ist doch bei Dr. Norden in den besten Händen. Dr. Norden scheint sich übrigens sehr für dich zu interessieren, Astrid. Ich traf ihn heute mittag. Du weißt ja, daß unser Büro im gleichen Haus ist wie seine Praxis. Er hat sich eingehend nach dir erkundigt und gesagt, daß du ein ganz reizendes Mädchen bist.«
»So?« fragte Astrid spöttisch.
»Er ist ein toller Mann«, sagte Lilly.
»Tatsächlich? Genügt dir Wolfgang nicht?« fragte Astrid mit einem Ausdruck, der Lilly nun doch irritierte.
»Du mißverstehst mich«, sagte sie nach einer kleinen Atempause. »Bedenke doch, daß du eine reiche Erbin bist. Ein Akademiker wäre wohl das mindeste, was deine Eltern als Schwiegersohn erwarten, doch nicht einen Mann mit mittlerer Bildung wie Wolf.«
Astrid straffte sich. Sie schien zu wachsen. »Worauf willst du eigentlich hinaus, Lilly?« fragte sie. »Bist du Wolfs Zuneigung nicht sicher, oder ist deine Freundschaft zu mir nur geheuchelt? Was würdest du sagen, wenn ich eingestehen würde, daß ich Wolf sehr gern habe? Nein, das tue ich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein, aber dein Gerede geht mir auf die Nerven. Ich habe wahrhaft andere Sorgen, als mir dieses Geschwätz anzuhören.«
»Ich dachte, wir wären Freundinnen?« fragte Lilly bestürzt, denn ganz so hatte sie sich diese Unterhaltung nicht vorgestellt.
»Das dachte ich auch«, erwiderte Astrid. Sie sah sehr auffällig auf ihre Armbanduhr. »Ich muß jetzt wirklich fahren«, sagte sie. »Ade!«
Das war immer ihr Abschiedsgruß gewesen, aber heute klang er kühl und irgendwie endgültig.
Lilly war aus der Fassung gebracht, verunsichert. Sie wollte noch etwas sagen, aber Astrid eilte schon zu ihrem Wagen, einem neuen, schicken Sportkabriolett, lindgrün mit schwarzem Lederdach. Lilly ballte ihre Hände in den Manteltaschen. Wirklich alles konnte sie sich leisten, alles, was man mit Geld kaufen konnte, aber Wolf sollte sie nicht bekommen. Aber dann kam ihr plötzlich ein Gedanke, der sehr unbequem war. Wenn nun Karl Kürten sterben würde? Astrid war die Erbin! Sie hatte dann zu bestimmen, und wenn sie nun Wolf entlassen würde? Solche Stellung bekam er so schnell nicht wieder. Vielleicht hatte Karl Kürten ihn so protegiert, weil er in Wolf seinen zukünftigen Schwiegersohn sah.
Astrid hatte unerwartet reagiert, und für Lilly war es kein erfreulicher Gedanke, daß sie an diesem Tag zweimal eine Abfuhr bekommen hatte. Einmal von Dr. Norden und jetzt von Astrid. Und hatte nicht auch Wolf sie zurechtgewiesen?
*
Lenchen hatte über das ganze Gesicht gestrahlt, als Felicitas kam. Solche Überraschungen ließ sie sich gern gefallen, und Felicitas ließ sich gern von ihr verwöhnen, denn sie hatte ihre Besorgungen im Eiltempo erledigt und war nun doch recht abgespannt. Sie war diese verbrauchte Luft, die in den Straßen der Stadt lastete, nicht gewohnt. Hier war es besser.
Sie blieb nicht lange mit Lenchen allein. Daniel kam bald. Lenchen verschwand sofort taktvoll, und Daniel nahm seine Fee zärtlich in die Arme.
»Ich bin froh, daß du da bist«, sagte er. »Könntest ruhig öfter kommen.«
»Du auch«, erwiderte sie schelmisch.
»Du weißt ja, wie es hier zugeht.«
»Bei uns auch, Daniel. Ich werde jetzt schon tüchtig eingespannt. Da, ich habe dir etwas mitgebracht.« Sie gab ihm die Schallplatte. »Für Katja habe ich auch eine gekauft«, erklärte sie.
»David Delorme«, sagte Daniel gedankenverloren. »Der erste Patient auf der Insel der Hoffnung.«
»Eigentlich war es Frau Seidel«, erinnerte ihn Felicitas. »Unsere gute Henriette! Wir könnten sie gar nicht mehr entbehren.«
»So ist ein Mensch auf seine alten Tage noch glücklich geworden, glücklich, weil sie sich nicht überflüssig vorkommt. Das ist auch eine Therapie, Fee.«
Sie nickte. »Eine bessere als Medikamente.«
»Und Katja denkt immer noch an David?«
»Sie schreiben sich recht fleißig«, erwiderte Fee lächelnd. »Wie bist du denn mit der flotten Biene zurechtgekommen? Was für Wehwehchen hat sie denn?«
»Ein Klatschwehwehchen«, erwiderte Daniel spöttisch. »Sie wollte sich als fürsorgliche Freundin aufspielen, aber die kleine Astrid Kürten scheint da eine Schlange an ihrem Busen genährt zu haben.«
Eigentlich lohnte es wohl nicht, über Lilly Friedinger zu reden, aber Fee wollte doch Genaueres wissen.
»Eigentlich eine Frechheit, dir damit zu kommen«, sagte Fee. »Und man muß schon sehr arglos sein, um auf solchen Typ hereinzufallen.«
»Und das Schlimme dabei ist, daß sie ein dickes Fell hat und Astrid Kürten ein ganz dünnes.«
Er hatte es kaum ausgesprochen, als das Telefon läutete. Es war Professor Manzold, der ihn unbedingt noch wegen Karl Kürten sprechen wollte, und der Hotelier hatte selbst auch den Wunsch geäußert, mit Dr. Norden zu sprechen.
»Da bleibt mir dann wohl nichts anderes übrig, als schnell in die Klinik zu fahren«, sagte Daniel seufzend. »Begleitest du mich?«
Bevor sie zustimmen konnte, läutete das Telefon schon wieder.
»Man ist gegen uns«, brummte Daniel. Diesmal war es Frau Kürten, und sie bat ihn dringend, doch sofort nach ihrer Tochter zu schauen. Wohin sollte er nun zuerst? Er sah Fee an, und da kam ihm ein Gedanke.
»Dürfte ich Ihnen vorerst eine Kollegin schicken, Frau Kürten?« fragte er, Fee zublinzelnd, deren Augen sich staunend weiteten. »Ich komme von der Klinik aus zu Ihnen. Ja, darauf können Sie sich verlassen.«
Er wandte sich Fee zu.
»Sei so lieb und übernimm das. Ich habe das Gefühl, daß eine Frau bei der kleinen Kürten mehr ausrichten kann.«
»Du traust mir allerhand zu«, sagte Fee.
»Alles«, erwiderte Daniel. »Dir können nicht mal Frauen widerstehen.«
Er ließ seine Finger durch ihr wundervolles silberblondes Haar gleiten. »Eine richtige Traumfee bist du«, raunte er ihr ins Ohr.
So zärtlich konnte er sein. Ein heißes Glücksgefühl durchströmte Fee.
*
Als sie vor der Villa Kürten stand, war sie darauf gefaßt, daß man ihr mit Mißtrauen begegnen würde, aber auf Frau Kürtens Gesicht malte sich nur Überraschung, als Fee ihren Namen nannte.
»Sie sind Fräulein Dr. Cornelius?« fragte sie ungläubig.
Fee nahm niemandem Skepsis übel. Sie war gewohnt, für jünger gehalten zu werden, als sie war. Und Frau Kürten war eine sympathische Frau, die ihre Verblüffung mit einem mütterlichen Lächeln abschwächte.
»Astrid macht mir große Sorgen«, sagte sie leise. »Es kann ja sein, daß sie, ich meine, daß es nicht der Kummer wegen ihres kranken Vaters ist. Sie ist mir regelrecht zusammengeklappt, als sie aus der Klinik kam.«
Daß Astrid Kürten ein äußerst sensibles Mädchen war, erkannte Fee sofort. Es schien fast so, als sei sie erleichtert, daß nicht Dr. Norden kam.
»Mama macht sich unnötige Sorgen«, sagte sie stockend. »Ich habe diese Magenschmerzen doch öfter.«
Und einen viel zu niederen Blutdruck hatte sie auch, wie Fee zuerst feststellte.
Fee überlegte, wie sie dieses Mädchen zum Sprechen bringen könnte. Einfach würde es wohl nicht sein. Sie dachte daran, was Daniel ihr erzählt hatte, und sie war ziemlich sicher, daß die Beschwerden, die durchaus nicht zu verniedlichen waren, auf schwere seelische Störungen zurückzuführen waren. Aber um die Seele eines Menschen zu ergründen, mußte man erst dessen Vertrauen erlangen.
»Sie haben Kummer«, sagte sie vorsichtig.
»Mein Vater ist sehr krank«, erwiderte Astrid leise.
»Es geht ihm doch schon bedeutend besser«, sagte Fee aufmunternd. »Dadurch brauchen Sie sich nicht aus Ihrem seelischen Gleichgewicht bringen zu lassen.«
Astrid warf ihr einen langen Blick zu. Ihre Augen, weit geschnitten und sehr dunkel, hatten einen melancholischen Ausdruck.
»Ich glaube, ich habe gar kein seelisches Gleichgewicht«; sagte sie leise. »Ich lasse mich immer gleich einschüchtern.« Sie versuchte ein Lächeln, aber es mißlang kläglich, und Tränen standen in ihren Augen.
Zwanzig Jahre jung, mit allen materiellen Gütern reich gesegnet und so resigniert, dachte Fee.
»Wer schüchtert Sie denn ein?« fragte sie vorsichtig.
»Ach, ich habe einfach keine Menschenkenntnis«, sagte Astrid, »und gerade die braucht man doch im Hotelgewerbe. Ich möchte gern so sein, wie Papa sich seine Tochter wünscht.« Ein Fragezeichen stand dahinter, aber das Aber blieb unausgesprochen.
»Möchten Sie etwa so sein wie Ihre Freundin, Fräulein Friedinger?« fragte Fee sehr direkt.
Astrid sah sie erschocken an. »Sie kennen Lilly?« fragte sie heiser.
»Ich bin ihr heute zufällig begegnet. In der Praxis von Dr. Norden.«
Vielleicht war es falsch, ihr das zu sagen, aber Fee ließ sich von ihrem Gefühl leiten.
»Sie war bei Dr. Norden«, sagte Astrid. »Sie war bei mir.« Man sah ihr an, daß sie angestrengt nachdachte. »Sie hat so viel Unsinn geredet, aber was soll ich darüber sprechen.«
»Sprechen Sie ruhig«, sagte Fee. »Das erleichtert. Solange Sie alles in sich hineinschlucken, wird es nichts mit dem seelischen Gleichgewicht.«
»Arbeiten Sie ständig mit Dr. Norden zusammen?« fragte Astrid.
»Nein, aber wir arbeiten Hand in Hand.« Dann begann sie, aus einem zwingenden Gefühl heraus, von der Insel der Hoffnung zu erzählen, von den Menschen, die dort Genesung suchten.
»Manchen Leiden kann man nicht mit Medikamenten beikommen«, sagte sie. »Ihre Magenbeschwerden sind nervöser Natur. Sie kommen immer dann, wenn Sie sich aufgeregt haben, stimmt es?«
Sie mußte einige Zeit auf eine Antwort warten. »Was hat Lilly bei Dr. Norden gewollt?« kam anstelle einer Antwort die Frage. »Wollte sie ihm einreden, was für eine gute Partie ich bin, wie sie mir einreden wollte, daß er sich für mich interessiert?« Sie lachte spröde auf. Dieses Lachen tat Fee wohl. »Um sich so etwas vorzustellen, müßte ich schon eine blühende Phantasie haben«, fuhr Astrid fort, »und die habe ich nicht.«
»Mögen Sie Dr. Norden?« fragte Fee mit Selbstüberwindung, weil sie sich fragen mußte, ob darin die Konflikte des Mädchens zu suchen wären.
»Ich habe ihn doch erst heute kennengelernt«, erwiderte Astrid. »Lilly wußte das wohl nicht, daß Dr. Norden der Hausarzt meiner Eltern ist. Papa hält sehr viel auf ihn. Lilly hat ganz andere Gründe, mir solchen Unsinn einreden zu wollen.«
»Sie sind schon lange befreundet?« fragte Fee behutsam.
»Ich habe mir eingebildet, daß sie meine Freundin ist«, stieß Astrid hervor. »Ich bin ein ganz unmögliches Mädchen.«
»Das sind Sie nicht«, sagte Fee. »Sie sind ein sehr empfindsames Mädchen, vertrauensvoll und nicht fähig, Böses zu denken.«
»Ich bin einfältig«, sagte Astrid.
»Aber, aber, das ist eine zu herbe Selbstkritik. Andern gegenüber kritisch zu sein, ist besser. Ich frage mich, warum Sie so voller Hemmungen sind, Fräulein Kürten. Sie haben vernünftige Eltern …«
»Die mich sehr verwöhnt haben«, fiel Astrid ihr ins Wort. »Mir ist alles aus dem Wege geräumt worden. Lilly hatte es so viel schwerer, und sie ist viel selbstbewußter. Ich habe sie immer darum beneidet.«
»Und Sie sind wohl von ihr beneidet worden, weil Sie alles hatten, was sie gern haben wollte«, sagte Fee nachdenklich. »Versuchen Sie einmal ganz nüchtern darüber nachzudenken.«
»Sie sind sehr nett«, sagte Astrid, »aber kann ein Mensch sich, seinen Charakter ändern? Kann man aus seiner Haut heraus?«
»Man kann in eine andere hineinschlüpfen«, erwiderte Fee lächelnd. »Manchmal schlägt man aus Trotz einen falschen Weg ein. Das ist mir auch schon passiert. So, jetzt nehmen Sie diese Tropfen. Ich habe ein Läuten gehört. Ich glaube, Dr. Norden kommt, und er hat mich ja nicht zu einem Plauderstündchen zu Ihnen geschickt, sondern, um Sie von Ihren Schmerzen zu befreien.«
»Mir ist schon viel wohler. Schade, daß Sie nicht hierbleiben. Ihre Therapie würde mir sicher gut bekommen.«
»Sie könnten ja eine Zeit zu uns kommen, auf die Insel der Hoffnung. Ich will keine Propaganda machen, denn wir sind voll belegt, aber vielleicht würde es auch Ihrem Vater guttun, wenn er mal Ferien vom Ich macht.«
»Wenn man lange vorausplanen muß, ist bei Papa nichts zu machen. Und wenn er sich erst wieder richtig wohl fühlt, gerät er schnell in seinen alten Trott«, sagte Astrid. »Aber ich würde gern kommen.«
»Und dann wäre bestimmt auch ein Platz für Sie frei«, erwiderte Fee.
*
Dr. Norden hatte Frau Kürten berichten können, daß ihr Mann sich wieder recht stark fühlte. Er hatte ihn eigentlich auch wegen Astrid sprechen wollen.
»Fräulein Dr. Cornelius ist noch bei ihr«, sagte Frau Kürten. »Ich habe sie nicht gestört. Meinem Gefühl nach hat sich Astrid heute über ihre Freundin aufgeregt. Ich habe diese Freundschaft nie so recht gebilligt, aber dreinreden wollte ich meiner Tochter auch nicht.«
Ihr wollte Daniel nichts von Lillys Besuch sagen. Jetzt wollte er erst einmal abwarten, was Fee zu berichten hatte.
Astrid war wieder scheu und gehemmt, als er eintrat.
»Es geht mir schon wieder besser«, sagte sie überstürzt. Ihr Blick wanderte zwischen Daniel und Fee hin und her, und dann entspannten sich ihre Gesichtszüge wieder.
»Fräulein Dr. Cornelius hat mir sehr geholfen«, sagte sie. »Sie brauchen nichts mehr für mich zu tun, Herr Doktor.«
Sie will nichts mit mir zu tun haben, dachte Daniel. Es ist wohl gut, daß ich Fee zu ihr geschickt habe. Sie würde ihm schon einiges zu erzählen haben. Das konnte er von ihrem klaren Gesicht ablesen.
Das tat sie dann auch ausführlich, und er konnte spüren, wie sie sich mit Astrid Kürten beschäftigte.
»Das Mädchen ist voller Komplexe«, sagte sie. »Das Gegenteil von dem, wie man sich eine Millionärstochter vorstellt.«
»Sie möchte keine sein, da liegt der Hase im Pfeffer«, sagte er. »Ihr Vater hat mit mir darüber gesprochen. Deswegen macht sie auch nichts aus sich. Und ich habe von ihm auch erfahren, daß er diesen Wolfgang Bender gern als Schwiegersohn hätte. Eine fatale Situation. Kürten ist nämlich überzeugt, daß seine Tochter Bender liebt und nur zu schüchtern ist, ihm das zu zeigen.«
»Wenn er so dumm ist und es nicht merkt«, sagte Fee.
»Das soll anderen auch schon passiert sein, daß sie nicht gemerkt haben, wie sehr sie geliebt werden«, sagte Daniel hintergründig.
Er spielte auf sie an, auf den früheren Zustand zwischen ihnen, der manchmal äußerst gespannte Stimmungen erzeugt hatte.
»Du hast es mir aber nie gezeigt, daß du mich liebst«, verteidigte sie sich. »Und außerdem gab es so viele andere Frauen in deinem Leben.«
»Du mußt es ja wissen«, brummte er.
»Ich weiß doch, wie du angeschwärmt wirst, auch jetzt noch, aber diese kleine Astrid steckt so voller Komplexe, daß man nur Mitleid mit ihr haben kann.«
»Aber sie will nicht um ihres Geldes willen geliebt werden«, sagte Daniel.
»Und warum hat sich diese Lilly an sie gehängt? Doch nur, weil sie sich Vorteile davon versprach. Hoffentlich ist sich Astrid wenigstens darüber im klaren oder wird es, wenn sie darüber nachdenkt.«
»Und wie lautet die Diagnose, Fräulein Doktor?« fragte er.
»Vegetative Dystonie, Übersensibilität. Ich hoffe, daß unser Gespräch sich positiv auswirkt.«
»Aus einem grauen Entlein wird nicht so schnell ein stolzer Schwan«, sagte Daniel.
»Schau sie doch erst mal genauer an«, sagte Fee. »Sie ist kein graues Entlein. Sie versteht es nur nicht, ihre Vorzüge ins rechte Licht zu rücken. Vielleicht ist sie in diesen jungen Mann wirklich verliebt. Gesprochen hat sie nicht darüber. Ich würde sie gern unter meine Fittiche nehmen.«
»Hast wohl wieder Reklame fürs Sanatorium gemacht?« fragte er neckend.
»Es geht nicht um den Profit, sondern um den Menschen«, sagte Fee. »Das ist doch unsere Devise.«
»Hast ja recht, Liebes«, sagte Daniel. »Schade, daß du nicht meine Praxis teilst.«
»Ob du dann nicht eine ganze Menge weiblicher Patientinnen verlieren würdest?« meinte sie anzüglich.
»Dafür eine ganze Anzahl männlicher Patienten dazugewinnen«, konterte er. »Ein feines Deutsch haben wir beieinander. Als ob es männliche Patientinnen geben würde.« Er lachte übermütig und küßte sie, als er vor dem Hause angehalten hatte. Und gerade da ging Wolfgang Bender vorbei. Daniel sah ihn nicht, aber Wolfgang Bender erkannte ihn sofort. Er hatte Dr. Norden ja erst vor einer Stunde in der Klinik gesehen. Und er gestattete sich auch einen langen Blick auf die bildschöne Begleiterin des Arztes.
Seine Augenbrauen schoben sich zusammen. Lilly hatte ihm doch weismachen wollen, daß Dr. Norden sich für Astrid interessieren würde. Das sah allerdings nicht so aus, und außerdem hatten all ihre Bemerkungen ein sehr unbehagliches Gefühl in ihm wachgerufen. Er nahm sich vor, morgen einmal mit Astrid zu sprechen. Vorsichtig natürlich, ohne Lilly zu erwähnen.
*
Daniel und Fee sprachen nicht mehr über Patienten an diesem Abend. Sie hörten sich die Schallplatte von David Delorme an und ließen sich einfangen von der himmlischen Musik. Sie sahen sich dabei an.
Daniel konnte sich nicht sattsehen an diesem schönen, reinen Gesicht, das umflossen war von dem silberblonden Haar, an den violetten Augen, in denen alle Empfindungen zu lesen waren.
Fee wiederum stellte fest, wie ausdrucksvoll und wandelbar Daniels Gesicht war, das jetzt so ganz anders wirkte als in der Praxis.
Er konnte den Beruf und das Privatleben so völlig voneinander trennen, und sie fragte sich, wie viele Menschen ihn wohl wirklich kannten.
»David ist ein Romantiker«, sagte Daniel, als der letzte Ton verklungen war. »Er paßt gar nicht in diese Welt.«
»Es war jedenfalls ein Gewinn, ihm zu begegnen«, sagte Fee. »Wie geht es Isabel?«
Es war nicht so abwegig, Isabel Guntram und David Delorme in einem Atemzug zu nennen, denn schließlich hatte Isabel ziemlich viel dazu beigetragen, daß der berühmte junge Pianist zur Insel der Hoffnung gekommen war, aber Daniel hatte immer gewisse Hemmungen, mit Fee über Isabel zu sprechen.
»Sie ist mal wieder unterwegs. Ich weiß es von Molly. Ihre Tochter arbeitet doch als Volontärin in Isabels Redaktion. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Daniel«, sagte Fee.
»Ich entschuldige mich nicht. Ich mag nur nicht, daß du annehmen könntest, zwischen uns wäre etwas.«
»Ich mag Isabel«, sagte Fee. »Es läßt mich nicht kalt, daß ich ihr den Mann weggenommen habe, den sie liebt.«
»Du siehst das falsch, Liebes«, sagte er und schob seine Hand unter ihren Nacken. »Es gibt wirklich echte Freundschaft zwischen Mann und Frau. Bei Isabel und mir ist das so. Es wird auch so bleiben, selbst wenn wir beide verheiratet sind.«
»Dagegen habe ich doch nichts«, sagte Fee leise.
»Dann mach dir auch keine Gedanken um sie. Sie liebt ihren Beruf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß sie nur Ehefrau oder gar Mutter sein könnte. Apropos Kinder. Wir wollen doch auch welche haben, Fee?«
»Natürlich«, erwiderte sie.
»Dann sollten wir mit dem Heiraten aber nicht zu lange warten. Kinder wollen junge Eltern haben.«
»Und dann soll ich nur Ehefrau und Mutter sein«, sagte Fee gedankenverloren.
»Ab und zu darfst du mir helfen, wenn ich problematische Fälle habe.«
»Wo?« fragte sie.
»Ja, das ist die Frage. Kann ich es mir leisten, die Praxis aufzugeben? Eines Tages entdecken die Leute, daß sie durch alle möglichen Illustrierten so eingehend über eine gesunde Lebensweise informiert werden, daß sie keine Kur und keinen Sanatoriumsaufenthalt mehr nötig haben«, sagte Daniel mit einem humorvollen Lächeln, »und dann…«
»Dann werden die Ärzte auch brotlos«, fiel ihm Fee ins Wort. »Abgesehen von den Chirurgen. Es sei denn, daß nur noch außerordentlich attraktive Männer diesen Beruf ergreifen.«
»Werd nicht schon wieder keck«, murmelte er, und dann küßte er sie so heiß, daß sie lieber seine Küsse erwiderte, als die Neckerei fortzuführen.
*
Um sieben Uhr, wie jeden Tag, läutete bei Dr. Daniel Norden der Wecker, und aus der Küche kam der aromatische Duft des Kaffees. Lenchen war schon am Werk.
Im Bad rauschte bereits das Wasser, und als Daniel sich endlich aufgerappelt hatte, kam Fee schon heraus.
So taufrisch wie der erwachende Morgen war ihr Gesicht. Die Haut spannte sich wie matte Seide über den Wangen, und ihre weichen Lippen leuchteten wie eine erblühende Rose. Solche romantischen Vergleiche kamen ihm, wie sie so vor ihm stand.
»Wenn Vater das erlebt hätte«, sagte er leise, ihre Hände an seine Brust ziehend.
»Was?« fragte sie.
»Daß Felicitas Cornelius, die Tochter seines besten Freundes, mir gehört«, erwiderte er. Es klang fast feierlich.
»Meinst du, daß unsere Väter solche Gedanken hegten?«
»Insgeheim vielleicht. Gesprochen haben sie wohl nicht darüber. Wir haben vernünftige Väter, die ihre Kinder nicht beeinflussen wollten. Manchmal will ich nicht wahrhaben, daß mein Vater nicht mehr da ist, Fee.«
»Ich kann es verstehen, Daniel«, sagte sie weich, »aber sein Geist lebt ja weiter. Mit der Insel der Hoffnung hat er sich selbst ein Denkmal gesetzt.«
»Es klingt schön, wenn du es sagst, aber das hat Vater wohl gar nicht gewollt. Er hat nie an sich gedacht, immer nur an die Leidenden. Du, ich muß mich beeilen. Schau mich nicht so an, sonst vergesse ich meine Patienten.« Seine Lippen streiften schnell ihr Haar, und ihr war es nicht anders zumute als ihm. Am liebsten hätte sie alles vergessen und ihn und sich auf eine einsame Insel gewünscht, wo niemand sie stören konnte.
Am Frühstückstisch gab er sich Mühe, einfach nur heiter zu sein.
»Was hast du heute noch zu erledigen?« fragte er.
»Nicht mehr so viel. Ich will mittags wieder daheim sein.«
»Kannst du nicht noch einen Tag bleiben?« fragte er mit einer Stimme, die heiser vor Zärtlichkeit war.
»Das geht nicht, Daniel. Paps und Jürgen haben genug zu tun.«
Daniels Kopf ruckte empor. »Duzt ihr euch eigentlich?« fragte er, und blanke Eifersucht klang aus seiner Stimme.
»Nein, wir nennen uns der Einfachheit halber nur beim Vornamen«, erwiderte Fee. »Jürgen Schoeller würde niemals wagen, mit dir zu konkurrieren.«
»Aber er hat viel für dich übrig.«
»Vielleicht soviel wie Isabel für dich, er zeigt es nicht.«
»Ihr seid tagtäglich beisammen«, sagte Daniel unwillig.
»Das könnten wir auch sein, wenn du dich entschließen würdest, den Standort zu wechseln«, erklärte Fee.
»Oder du den deinen.«
Es war nicht das erste Mal, daß sie sich darüber in Hitze redeten. Daniel hätte nicht Daniel und Fee nicht Fee sein müssen, wenn bei ihnen alles sanft und reibungslos abgegangen wäre. Dazu besaß jeder von ihnen zuviel Persönlichkeit. Aber heute war nicht die Zeit dazu da, noch länger darüber zu diskutieren, und sie waren übereingekommen, sich niemals mit der kleinsten Unstimmigkeit zu trennen. Das war ja auch keine. Es war nur der übliche Disput, wenn Daniel vom Heiraten anfing.
Ob Fee überhaupt ahnt, wie sehr ich sie vermisse? dachte Daniel, als er sich sehr liebevoll von ihr verabschiedet hatte. Das ist doch kein Zustand. Und daß er einmal so eifersüchtig sein könnte, hätte er auch nie gedacht.
Es behagte ihm nicht, daß Dr. Schoeller immer in Fees Nähe war. Er wußte sehr gut, wieviel er für sie übrig hatte.
Genausoviel wie dabei für dich, hatte Fee gesagt. Du liebe Güte, darum hatte er sich auch niemals Gedanken gemacht. Mit Isabel war er hin und wieder ins Konzert gegangen, zum Essen, oder auch in eine Bar. Aber seit die Entscheidung zwischen ihm und Fee gefallen war, ging er überhaupt nicht mehr aus, was Lenchen wohlwollend zur Kenntnis nahm.
Als sie ihn mittags aber fragte: »Na, wann wird dann nun geheiratet?« verdüsterte sich seine Miene.
»Das hättest du ruhig Fee fragen können«, brummte er.
*
Er hatte an diesem Tage so viele Krankenbesuche zu machen, daß er gar nicht zur Besinnung kam. Es war Föhn, und das machte sich bei den Kreislaufkranken sofort bemerkbar. Molly telefonierte dauernd hinter ihm her.
Dann wäre ihm fast das Benzin ausgegangen, und als er zu seiner Tankstelle fuhr, kam es ihm in den Sinn, Franz Glimmer, den Tankstellenbesitzer, zu fragen, wie ihm Dr. Schoeller gefiele. Franz Glimmer war vier Wochen, nach einer schweren Magenoperation, im Sanatorium gewesen und erst Ende der letzten Woche zurückgekommen.
Er strahlte, als Daniel vorfuhr, und seine erwachsenen Kinder Uschi und Max kamen auch gleich herbeigelaufen.
»Wir dachten schon, Sie wären uns untreu geworden, Herr Doktor«, sagte Uschi, die in der letzten Zeit viel weiblicher geworden war. Richtig hübsch war sie geworden. Sie errötete, als Dr. Norden sie musterte.
»Das letzte Mal mußte ich unterwegs tanken, weil mir der Sprit ausgegangen war«, sagte Daniel, »und fast wäre mir das jetzt wieder passiert«
»Fräulein Dr. Cornelius hat vorhin auch bei uns getankt«, sagte Franz Glimmer. »Hat mich sehr gefreut, daß sie sich eigens erkundigt hat, wie es mir geht. Wenn man von so einer hübschen Ärztin betreut wird, muß man ja gesund werden.«
»Laß das Mutti nicht hören«, scherzte Max, »sonst läßt sie dich nächstes Jahr nicht wieder auf die Insel.«
»Nächstes Jahr kommt die Mutti mit«, sagte Franz Glimmer. »Herrlich ist es da, Herr Doktor. Ein richtiger Gesundbrunnen.«
»Es freut mich, daß es Ihnen gefallen hat«, sagte Daniel, »und bekommen ist es Ihnen auch, wie ich sehe.«
»Aber zur Untersuchung muß er schon regelmäßig zu Ihnen kommen«, sagte Uschi. »Da passen wir jetzt auf. Solchen Schrecken jagt Vati uns nicht noch mal ein.«
»Waren Sie auch mit Dr. Schoeller zufrieden?« erkundigte sich Daniel beiläufig.
»Und wie. Ein feiner, stiller Mensch ist das. Manchmal haben wir abends auch zusammen Schach gespielt. Es ist wirklich eine wunderbare Idee von Ihnen gewesen. Wie eine große Familie sind sie dort alle, auch die, die zuerst mucken, werden angesteckt.«
»Es war meines Vaters Idee«, wälzte Daniel das Lob von sich ab. »So, jetzt muß ich wieder weiter. Bis zum nächsten Mal.«
»Die Uschi muß jetzt auch mal zu Ihnen kommen«, sagt Franz Glimmer. »Mit ihrem Magen stimmt’s nicht.«
Na, da wird wohl etwas ganz anderes nicht stimmen, dachte Dr. Norden, als er bemerkte, wie verlegen Uschi wurde.
»Dann gleich morgen, da ist keine offizielle Sprechstunde«, sagte er. Und er nickte Uschi aufmunternd zu, was sie zu brauchen schien.
Er mochte diese netten Leute, und auch Uschi, dieses frische, tüchtige Mädchen das er hatte heranwachsen sehen. Wie schnell doch aus Kindern Leute wurden. Ja, so sagte es Lenchen.
Er sah auf seinen Block, den er auf das Armaturenbrett geheftet hatte. Direktor Wendel stand noch aus und Sibylle Jensen. Liebe Güte, da stand ihm ja noch etwas bevor. Er stöhnte in sich hinein. Aber schließlich waren das beides Patienten, die ihm zu einem guten Start verholfen hatten, Patienten mit vielen Verbindungen, wenngleich recht schwierige.
Und er mußte dazu weit in die Stadt hineinfahren. Wendel wohnte in Bogenhausen und Sibylle Jensen in Schwabing.
Er dachte daran, daß es noch gar nicht so lange her war, daß er mehrmals in der Woche in Schwabing gewesen war, in diesen Künstlerlokalen, in denen er so gern seine Studien gemacht und auch alte Studienfreunde getroffen hatte. Man lebte sich auseinander. Das war der Lauf der Zeit. Und Tennis hatte er auch schon lange nicht mehr gespielt. Auf der Insel hätte er alles beisammen und vor allem Fee.
Hoffentlich ist sie gut angekommen, ging es ihm durch den Sinn.
*
Fee war längst daheim. Katja hatte schon sehnsüchtig auf sie gewartet. Oder besser auf die Platte von David, mit der sie sich gleich in ihr Zimmer zurückzog.
»Was ein Glück, daß du sie bekommen hast, Fee«, sagte Anne Fischer.
Sie duzten sich seit kurzer Zeit. Es war ganz von selbst gekommen, als sie einmal abends beisammen saßen. Gemocht hatten sie sich von Anfang an, und Fee ahnte auch, daß ihr Vater Anne sehr zugetan war.
Sie wäre die richtige Gefährtin für ihn, hatte sie gedacht und gemeint, daß er mehr Mut bekommen würde, wenn er merkte, daß sie sich gut mit Anne verstand.
Aber er wie auch Anne Fischer trugen wohl zu schwer an ihrem Schicksal und trauerten noch zu tief um die Menschen, die sie verloren hatten, um solche Gedanken ins Auge zu fassen.
»Wo ist Paps?« fragte Fee, die vergeblich nach ihrem Vater Ausschau gehalten hatte.
»Bei einem neuen Patienten. Heute morgen erst gekommen und sehr schwierig. Ihm sind zuviel einfache Leute hier.«
»Das alte Lied«, sagte Fee, »er kann ja wieder abreisen. Ist es dieser Amerikaner?«
»Deutschamerikaner«, erwiderte Anne. »Ein Rauhbein, wie es im Buche steht.«
William Docker hieß er. Fee wußte es aus der Anmeldung. Und sie hörte seine dröhnende Stimme aus einem der hübschen Häuser, die verstreut auf der Insel lagen und so den Eindruck einer Wohnsiedlung machten und nicht den eines Sanatoriums.
»Die Idee ist gut, lieber Doktor«, sagte William Docker, »prächtig sogar. Das ist ein Paradies. Aber wie wollen Sie auf Ihre Kosten kommen, wenn Sie so viele arme Leute aufnehmen? Mann, Sie könnten doch das große Geld machen, wenn Sie die Reklametrommel rühren würden. Lassen Sie sich das von einem sagen, der ganz klein angefangen hat.«
»Darauf sind Sie also stolz, Mr. Docker, aber heute blicken Sie über die, die nicht so viel Glück hatten, hinweg oder sogar auf sie herab.«
»Jeder bekommt seine Chance«, sagte William Docker schon etwas leiser. »Alle verstehen sie nicht zu nützen.«
»Und jeder hat nicht so ein dickes Fell wie Sie«, sagte Johannes Cornelius.
Fee lachte leise in sich hinein. Er
gibt’s ihm, dachte sie. Er gibt es ihm ordentlich.
»Sind Sie glücklich?« hörte sie ihren Vater fragen. »Warum können Sie denn nachts nicht schlafen? Werden Sie von Ihren Geldsäcken erdrückt?«
Dr. Cornelius wußte genau, wie er den Leuten begegnen mußte. Den einen, und meistens waren das die wenig vom Glück begünstigten, ganz vorsichtig und sehr behutsam. Mit Samthandschuhen mußte man sie manchmal anfassen, um ihnen ihre Hemmungen zu nehmen, und anderen konnte man mit dem Holzhammer kommen.
So, wie William Docker, der einigermaßen fassungslos war, wie Dr. Cornelius mit ihm redete. Aber seltsamerweise wagte er keinen Widerspruch mehr.
Während Fee weiterging zum Wirtschaftstrakt, um Henriette Seidel zu begrüßen und ihr zu sagen, daß es ihrem tief verehrten Dr. Norden gutginge, denn das wollte die alte Frau Seidel, die Daniel so viel zu verdanken hatte, immer wissen, sagte William Docker zu Dr. Cornelius:
»Wer ist schon glücklich? Alles ist relativ im Leben. Und bezahlen muß man auch für alles. Manchmal frage ich mich, wofür ich geschuftet habe.«
»Haben Sie keine Kinder?« fragte Dr. Cornelius.
Das flächige Gesicht verdüsterte sich. »Fragen Sie mich nicht«, brummte er. »Ausfragen lasse ich mich nicht.«
»Nun, dann werden Sie wohl auch weiterhin schlecht schlafen«, erklärte Dr. Cornelius gelassen.
»Wieso? Wozu bin ich hier?«
»Um von Ihren Beschwerden geheilt zu werden, aber das kann nur geschehen, wenn die Ursachen beseitigt werden.«
»Ursachen«, höhnte der andere. »Suchen Sie die Ursache meiner Schlaflosigkeit etwa darin, daß mein einziger Sohn seinem treusorgenden Vater die kalte Schulter gezeigt hat und so ein leichtes Mädchen heiratete? Daß sie ihm mehr bedeutete als alles, was ich ihm geboten habe?«
»Vielleicht ist das die Ursache Ihrer Schlaflosigkeit. Aber nun weiß ich ja schon etwas über Sie, und wir werden uns noch öfter unterhalten.«
»Hiergeblieben«, kommandierte William Docker, als sich Dr. Cornelius zum Gehen wandte. »Sie haben komische Methoden. Sie fragen einen ja nur aus.«
»Wir haben hier eben unsere speziellen Methoden«, erwiderte Dr. Cornelius lächelnd. »Sie brauchen nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen, aber wenn Sie Genesung suchen, ist es besser, wenn wir uns ab und zu über Ihre Probleme unterhalten.«
»Ich habe keine Probleme. Der Bengel kann doch machen, was er will. Ich habe Luftveränderung gebraucht, und da bin ich hergekommen, weil ich früher in der Gegend gelebt habe. Ich bin wirklich hart im Nehmen, Doktor, aber zerbrechen Sie sich den Kopf nicht über imaginäre Probleme, sondern über meine Schlaflosigkeit.«
Den werden wir auch noch zähmen, dachte Dr. Cornelius. Hier gelebt hat er also, und sein Sohn ist ihm durchgebrannt wegen einer Frau. Ein leichtes Mädchen hatte Docker sie genannt.
Eine Idee kam ihm, eine ganz seltsame Idee, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Merkwürdig war es ihm ja gleich vorgekommen, daß schon nach so kurzer Zeit ein Mann aus Texas zu ihnen kam. Vielleicht war es nicht die Insel allein, vielleicht zog ihn noch etwas anderes her.
Ich werde schon dahinterkommen, dachte er, und da kam Fee schon auf ihn zugelaufen und fiel ihm um den Hals.
»Hat das Rauhbein dir tüchtig zugesetzt, Paps?« fragte Fee. »Soll ich es mal mit weiblichem Charme versuchen?«
»Ach was, Kleine, der hält schon was aus. Rauhe Schale, weicher Kern, sagt man doch. Ich glaube, das trifft auch auf ihn zu.«
»Du hast es ihm aber auch ganz schön gegeben«, lächelte sie. »Ich habe nämlich ein bißchen gelauscht.«
»Und ich habe eigentlich gedacht, daß du wegen einer Panne erst morgen kommst«, sagte er neckend.
»Mein Wagen ist erst überholt worden«, sagte Fee irritiert.
»Na, passieren kann doch immer mal was mit solcher Sardinenbüchse, noch dazu, wenn man in netter Gesellschaft ist.«
»Mein lieber Paps, ich bin mir meiner Pflichten durchaus bewußt«, sagte Fee verweisend.
»Auch jener Pflichten, die einer leidenden Frau harren?« fragte er nachdenklich. »Ich könnte mir vorstellen, daß Dan sich bald nicht mehr mit diesen kurzen Besuchen zufriedengibt.«
»Er hat doch auch seine Pflichten. Willst du mich loswerden, Paps?«
»Nein, aber als guter Vater, der ich hoffentlich für dich bin, möchte ich nicht, daß du Rücksicht auf mich nimmst, mein Kind.«
»Ich mag das nicht, heute kennenlernen und nach vier Wochen heiraten«, sagte Fee eigensinnig.
»Nun übertreib nicht. Ihr kennt euch doch schon ein halbes Leben.«
»Aber die meiste Zeit als Hund und Katze. Das hast du selber gesagt.«
»Bei dir waren es doch nur Vorurteile, weil Dan ein besonders attraktiver Mann ist. Bei ihm dagegen…«
»Jetzt sag nicht, daß er mich schon immer heimlich geliebt hat, seit ich aus den Windeln heraus war. Viele Frauentränen säumen seinen Weg«, spottete sie. »Und ich könnte mir vorstellen, daß sich schon wieder eine an seiner Schulter ausweint, die gar zu gern mehr als nur den Herrn Doktor in ihm sehen würde.«
*
Und so war es auch. Sibylle Jensen erschreckte Daniel wieder einmal mit einem Tränenstrom.
Direktor Wendel hatte er hinter sich gebracht.
Sibylle war eine exzentrische Malerin. Mit ihren Karikaturen hatte sie das große Geld gemacht, doch das private Glück war ihr versagt geblieben. Für Daniel war das kein Wunder, denn eine Frau, die so egoistisch war und die von allen verlangte, daß sie sich nach ihr richteten, konnte nicht glücklich machen und nicht glücklich sein. Dabei war sie in ihrer exotischen Schönheit, wenn auch nicht mehr die Jüngste, eine beeindruckende Erscheinung. Wenigstens solange sie nicht weinte.
Daniel hatte sie durch Professor Manzold kennengelernt, mit dessen Bruder sie einige Zeit liiert gewesen war, der sich dann aber auch von ihr zurückgezogen hatte.
»Dan, Sie sind meine Rettung«, rief sie aus, als er die phantastisch eingerichtete Wohnung betrat. Er war immer wieder fasziniert von diesen Räumen, die die unerschöpfliche Phantasie dieser Frau verrieten.
Einen kranken Eindruck machte Sibylle nicht, aber sie hatte anscheinend wieder zuviel getrunken, und dann bekam sie jedes Mal das heulende Elend.
Damit hatte Daniel eigentlich schon gerechnet, aber ihre schillernde Persönlichkeit faszinierte ihn ebenso wie ihre Räumlichkeiten, und deswegen fuhr er auch immer wieder zu ihr, wenn sie ihn rief.
Bei einem guten Psychiater wäre sie wohl besser aufgehoben gewesen, aber das hätte er ihr nicht zu sagen gewagt. Sie wäre ihm wohl ins Gesicht gesprungen, denn sie selbst hielt sich für völlig normal.
Zum Beichtvater fühlte sich Daniel nicht berufen, aber für Sibylle war er es. Er kannte alle Romanzen, all ihre Affären und auch die Enttäuschungen, die sie erlebt hatte, die sie erleben mußte, denn sie war eine überaus großzügige Frau. Reiche Männer hatten sie nie interessiert, immer wieder gabelte sie einen auf, den sie durchfütterte und einkleidete. Nicht etwa primitive Geister, o nein, damit gab sich Sibylle nicht ab.
Es waren jene, die sich als verkannte Genies fühlten, oder andere, die genau wußten, wie man mit ihr reden mußte. Im Grunde ihrer Seele war sie naiv. Naiv wie ihre Bilder, die überall an den Wänden hingen und von denen sie sich so schwer trennen konnte.
Diesmal war es ein junger Franzose, dem sie nachtrauerte.
»Nicht mehr so jung, Dan«, sagte sie theatralisch, »nur zehn Jahre jünger als ich. Und er wollte nichts von mir, was sagen Sie dazu. Er wollte kein Geld und keine Geschenke. Er wollte mich heiraten!«
»Und warum haben Sie ihn nicht geheiratet, Sibylle?« fragte Daniel sarkastisch.
»Das fragen Sie mich? Mein Gott, ich bin keine alte Frau, das weiß ich gut, aber zehn Jahre sind doch ein gewaltiger Unterschied, und der Gedanke, daß er mich dann wegen einer Jüngeren verlassen würde, wäre mir unerträglich.«
»Vielleicht hätte er Sie nicht verlassen«, sagte Daniel nüchtern. »Geht nicht jeder Mensch ein Risiko ein, wenn er sich an einen anderen bindet, gleich, ob er jünger und sie älter oder er älter und sie jünger ist? Es gibt doch keine Norm. Und wenn Sie Zweifel hegen, brauchen Sie sich nicht wieder selbst zu zerfleischen und Trost im Alkohol zu suchen. Wann werden Sie endlich vernünftig, Sibylle?«
»Nie«, sagte sie und sank schluchzend an seine Schulter. »Warum können Sie mich nicht lieben, Dan? Sie wären der ideale Mann für mich.«
»Meinen Sie?« fragte er. »Ich würde Sie schön auf Trab bringen. Dieser ganze Firlefanz, nächtelang in den Kneipen hocken, eine Kognakflasche nach der andern leeren, in diesen blödsinnigen Gewändern herumlaufen, fiele weg. Sie würden kochen und Kinder kriegen, morgens um sieben Uhr aufstehen müssen und so weiter, und so weiter.«
»So bürgerlich sind Sie?« fragte sie staunend.
»So bürgerlich bin ich. Das erwarte ich von meiner Frau. Außerdem weiß ich schon, wen ich heiraten werde.«
Ihre kohlschwarzen Augen wurden kugelrund. »Sie wollen heiraten?« fragte sie, und die Tränen waren versiegt. »Wen?«
»Das ist noch mein Geheimnis«, erwiderte er.
»Mir können Sie es doch sagen«, meinte sie schmollend. »Bin ich nicht Ihre beste Freundin?«
»Über Freundschaft kann man auch geteilter Meinung sein, Sibylle«, sagte er. »Sie sind eine verrückte Person, aber ich mag Sie, und deshalb wäre ich froh, wenn Ihr unstetes Leben endlich ein Ende hätte. Wenn Sie nicht mehr auf die krummen Touren hereinfallen würden, mit denen Ihre seltsamen Freunde Ihnen so lange das Geld aus der Tasche locken, bis Sie selbst keins mehr haben.«
»Ich brauche einen Halt«, sagte sie plötzlich nachdenklich. »Ich bin wie ein schwankendes Rohr im Wind. Ich weiß es, Dan, aber ich bin zu feige, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Geben Sie mir einen Rat, bitte. Einen ernsten Rat.«
Sie brauchte ihn, das wurde ihm jäh bewußt. Und er wußte auch einen Ausweg.
»Ich werde Sie zur Insel schicken«, sagte er.
»Zu Ihrer Insel? Zur Insel der Hoffnung?« Sie lachte auf. »Mir klingt das so nostalgisch. So nach Großmütterchen, Großmütterchen. Kennen Sie dieses Lied noch? Ich mußte es meiner Großmutter immer vorsingen. Ja, warum sollte ich nicht hinfahren? Ich muß mir doch ansehen, wofür Sie Ihr sauer verdientes Geld verschwenden.«
»Jedenfalls nicht so leichtfertig wie Sie, Sibylle«, sagte er. »Und Sie müssen auch zahlen.«
Er wußte, wie man ihr kommen mußte.
Sie legte den Kopf in den Nacken.
»Ich habe mir noch nie etwas schenken lassen«, stieß sie hervor.
»Das weiß ich«, sagte er, und nun war seine Stimme voller Wärme. »Sie haben sich immer nur ausnutzen lassen, und darum wird es Zeit, daß Sie einmal unter Menschen kommen, die Sie nicht ausnutzen werden. Ich hätte schon früher darauf kommen können.«
Sie sah ihn mit einem seltsamen Blick an. Man konnte jetzt die Falten sehen, die sich schon in ihrem Gesicht eingegraben hatten, aber sie taten diesem ausdrucksvollen Gesicht keinen Abbruch. Im Gegenteil!
»So mag ich Sie, Sibylle«, sagte Daniel, »und wenn Sie von der Insel zurückkommen und spotten über diesen törichten Doktor, dann kriegen Sie Ihr Geld zurück. Schlagen Sie ein!« Er hielt ihr seine Hand hin.
Sie zögerte noch, aber dann schlug sie ein.
»Es mag Ihnen nicht recht sein, Dan«, sagte sie leise, »aber Sie sind wirklich mein einziger Freund.«
»Sie werden staunen, aber das betrachte ich als ein Kompliment«, erwiderte er.
»Müssen Sie noch Besuche machen?« fragte Sibylle.
»Nein, jetzt ist aber Schluß für heute.«
»Gehen wir dann noch in unsere alte Kneipe, wo wir früher immer unsere Bohnensuppe gegessen haben? Sie soll noch genauso gut sein. Ich war schon lange nicht mehr dort.«
Ob Fee das gefallen würde? dachte Daniel, aber dann sagte er: »Gut, gehen wir!«
Warum auch nicht, ein bißchen Ablenkung würde ihm ganz guttun.
Sibylle hatte ihren Moralischen überwunden, als sie den Keller betraten, in dem es heiter herging. Hier hatte sich noch eine Atmosphäre der Gemütlichkeit gehalten, die leider viel zu häufig von Diskotheken und Beatschuppen verdrängt wurde.
Sibylle wurde gleich an einen Tisch gezogen, und auf Daniel schwankte ein hagerer blonder Mann zu. Daniel mußte gleich zweimal schauen, ob er sich auch nicht verguckte, obgleich man bei solcher Länge kaum übersehen werden konnte.
»Mensch, Daniel, alter Junge, gibt es dich auch noch«, sagte der Mann, und es war unverkennbar die Stimme von Max Lamprecht, genau gesagt, von dem Professor für Physik, Dr. Dr. Max Lamprecht. Und er, der Abstinenzler, der sich viel Neckerei hatte gefallen lassen müssen von seinen Studienfreunden, hatte ganz schön einen in der Krone.
»Maxl«, sagte Daniel staunend, »was ist denn mit dir los?«
»Was soll los sein? Gekippt habe ich einen«, kam die Antwort. »Komm, setz dich zu uns. Der Leitner-Schorsch ist auch da.«
Max Lamprecht war ein richtiger Bayer, ein waschechter, und auch seine akademischen Grade änderten daran nichts. Nur mit dem Bier hatte er es früher nicht so gehabt, doch das schien sich inzwischen doch geändert zu haben.
»Was ist, Daniel?« fragte Sibylle über die Schulter hinweg. »Setzen wir uns hierher?«
»Ach, du bist in Begleitung«, sagte Max, und es klang richtig enttäuscht. »Ist so was jetzt dein Typ?« fragte er.
»Eine alte Bekannte«, gab Daniel zurück. Dann machte er Max mit Sibylle bekannt.
»Sibylle Jensen, die Malerin?« fragte Max konsterniert. »Sie habe ich mir anders vorgestellt.«
Sibylle erwies sich als schlagfertig. »Professor Lamprecht, der Physiker? Sie habe ich mir auch anders vorgestellt.« Dann lachten sie beide, und Sibylle zog es doch vor, sich an den runden Tisch zu setzen, an dem der Leitner-Schorsch, seines Zeichens Chefarzt einer Frauenklinik, Daniel mit großem Hallo begrüßte.
Daniel bereute es nicht, hierher gegangen zu sein. Man hatte sich schon Jahre nicht mehr gesehen und konnte nun in Erinnerungen schwelgen.
Ja, das waren Zeiten gewesen, als sie noch auf der Uni waren. Der Leitner Schorsch zwei Semester weiter als Daniel, der Max von einer anderen Fakultät, und ein paar andere, die heute fehlten, waren auch dabeigewesen, wenn sie im Studentenheim beisammen hockten oder sich in der Mensa zum Essen trafen.
Max hatte seit dieser Zeit schon Haare gelassen, in doppeltem Sinne, wie Daniel erfahren sollte. Im Beruf war er erfolgreich.
Ja, da ging er seinen Weg. Aber privat hatte er kein Glück gehabt. Natürlich erinnerte sich Daniel noch an die kastanienbraune Marlene, mit der er auch mal geflirtet hatte. Max hatte sie geheiratet, aber die Ehe war bald wieder auseinandergegangen.
»Und nun werde ich erst mal richtig leben«, verkündete Max. »Nicht mehr bloß hinter Bücher hocken und sich mit den Studenten herumärgern. Die Burschen wollen die Welt verändern, nichts weiter. Nicht hübsch langsam, sondern am liebsten von einem Tag zum andern.«
»Waren wir denn anders?« warf Schorsch ein, der sich bisher so wenig wie Daniel zu einer Heirat hatte entschließen können. »Du bist doch kein Tattergreis, Maxl. Denk mal dran, was wir alles angestellt haben.«
Sibylle saß staunend dabei. Sie hatte den Block aus der Tasche genommen, den sie immer mit sich trug, und sie zeichnete. Die Männer achteten gar nicht darauf. Es schien, als hätten sie ihre Anwesenheit vergessen.
»Habt ihr etwas von Jochen gehört?« fragte Daniel. Er war der fröhlichste in ihrer Runde gewesen, vielleicht auch der besessenste.
»Er ist doch nach Afrika gegangen in ein Entwicklungsland«, sagte Schorsch, der Frauenarzt. »Der vollkommene Idealist. Hoffentlich kommt er wieder heil zurück. Kinder, ich muß langsam aufbrechen«, fuhr er dann fort, nachdem er erschrocken auf die Uhr geschaut hatte.
»Ich auch«, sagte Daniel. Sibylle schien es gar nicht zu hören.
»Na, wir zwei Hübschen können dann ja noch ein bißchen bummeln«, sagte Max zu ihr. »Mich zieht es nicht in meine triste Bude.«
Es war Mitternacht vorbei, als Daniel und Schorsch, der Gynäkologe Dr. Hans-Georg Leitner, auf der Straße standen. Müde waren sie eigentlich gar nicht, aber plötzlich war es ihnen zuviel geworden.
»Hoffentlich versumpft Max nicht vollends«, sagte Schorsch. »Er will anscheinend alles ruckzuck nachholen.«
»Dann ist er bei Sibylle in den richtigen Händen«, lachte Daniel. »Sie können sich gegenseitig trösten.«
»Eine ganz interessante Frau«, sagte der andere. »Es hätte mich nur erstaunt, wenn du dich für so eine schon ein bißchen antiquierte interessiert hättest. Was macht die Liebe, Dan? Immer noch wechselhaft bis gewittrig?«
»Sehr beständig und in voller Blüte«, erwiderte Daniel: »Und bei dir?«
»Hoffnungslos«, erwiderte Schorsch heiser. »Ich werde mir jetzt ein Taxi suchen.«
»Bist du nicht mit dem Wagen da?«
»Ich fahre nie, wenn ich etwas trinke. Du bist immer noch standfest?«
»Immer«, erwiderte Daniel lächelnd. »Ich bringe dich nach Hause. Oder kommst du noch mit zu mir?« schlug er aus einer plötzlichen Eingebung heraus vor.
»Wenn es dir nichts ausmacht«, sagte Schorsch. »Mich zieht es nicht heim. Wohne immer noch bei meiner Mutter. Manchmal schafft es mich. Sie sieht in mir immer noch den kleinen Jungen. Bevormundet mich andauernd, und wenn ich nachts mal nicht heimkomme, ist gleich großer Zirkus.«
Waren darin seine Probleme zu suchen? Daß er welche hatte, konnte Daniel nicht entgehen.
Schorsch stand vor dem schnittigen Sportwagen. »Eine wundervolle Maschine«, sagte er. »Dir geht es gut, man sieht es.«
In dem Lichtkreis der Neonlampe sah Daniel sein Gesicht deutlich. Viele Falten hatten sich darin schon eingegraben, und seine Schläfen waren ganz grau.
Guter Gott, lag die Studienzeit wirklich schon so weit zurück? Konnten die Jahre so schnell enteilen?
»Du hast dich gut gehalten«, sagte Schorsch Leitner. »Die Zeit ist an dir spurlos vorübergegangen.« Hatte er Daniels Gedanken geahnt?
»Ganz so auch nicht«, sagte Daniel.
»Es ist wohl ein Unterschied, ob man unabhängig ist oder den ganzen Ballast einer Klinik mit sich herumschleppen muß«, fuhr Schorsch fort. »Hast du überhaupt eine Ahnung, was da alles an einem hängenbleibt? Früher habe ich immer gedacht, daß ein festes Gehalt und die Sicherheit einem Ruhe geben, aber so ist es auch nicht, Dan. Du hast es richtig gemacht.«
Und als er sich dann in Daniels Wohnung umblickte, pfiff er durch die Zähne.
»Beneidenswerter Mensch«, sagte er. Dann blieb sein Blick auf Fees Fotografie ruhen.
»Bezaubernd«, sagte er. »Die Herzkönigin?«
»Genau. Meine zukünftige Frau«, erwiderte Daniel. »Und eine Kollegin dazu.«
»So was gibt es auch?« fragte Schorsch.
»Da würde ich aber nicht lange warten. So etwas muß man festhalten.«
»Das will ich auch.«
Er sah den andern an. Dr. Hans-Georg Leitner war ein ausgesprochen hübscher Junge gewesen. Jetzt war er ein breitschultriger, schon ein bißchen untersetzter Mann. Sein Gesicht hatte strenge Züge, die aber durch ein anziehendes Lächeln gemildert wurden und mehr noch durch die warmen grauen Augen.
»Es freut mich sehr, daß wir uns getroffen haben, Dan«, sagte er. »Die Arbeit frißt einen auf, und wenn man keine Freude hat, wird man trübsinnig.«
»Warum heiratest du nicht?« fragte Daniel. »Du bist doch auch Mitte dreißig.«
»Sechsunddreißig«, brummte der andere.
»Und immerhin schon Chefarzt. Wird doch wohl gut honoriert.«
»Das schon. Aber sie ist verheiratet. Ich habe doch gesagt, daß es hoffnungslos ist. Und dann ist da auch noch meine Mutter. Jeden Tag bekommen, ich vorgehalten, daß sie sich das Geld für mein Studium vom Munde abgespart hat. Das zermürbt. Man fühlt sich verpflichtet, sich dankbar zu erweisen. Ich bin es auch, aber sie hat eben kein Verständnis für meine Situation. Da bleibt es nicht aus, daß man sich hin und wieder besäuft, um alles wenigstens für ein paar Stunden zu vergessen. Manchmal ist das Leben einfach Mist, Dan. Wenn ich im Trott bin, vergesse ich es. Es ist ein schönes Gefühl, wenn sich dankbare Patientinnen von einem verabschieden, aber jedes Kind, das ich zur Welt bringen helfe, versetzt mir einen Stich. Ich habe mir immer Kinder gewünscht. Ich hätte sie anders erzogen, als ich erzogen worden bin. Katrins Kind habe ich auch geholt.«
Er sprach jetzt mehr zu sich selbst, versunken in Gedanken. »Es ist ein süßes kleines Mädchen gewesen. Ist es noch. Drei Jahre ist sie jetzt. Seither kennen wir uns, lieben uns, verstehst du.« Er stöhnte. »Sie hat einen schrecklichen Mann, ein widerlicher, gefühlloser Tyrann ist er.«
»Und warum läßt sie sich nicht scheiden?« sagte Daniel.
»Weil er ihr das Kind wegnehmen würde. Er hat mit seinem Geld die Firma ihres Vaters gerettet. Ich habe noch mit keinem darüber gesprochen. Entschuldige, Dan, wenn ich dir was vorjammere.«
»Red nur weiter«, sagte Daniel. »Auch ein Arzt braucht manchmal einen Arzt.«
»Dieses verfluchte Geld. Wieviel Unheil hat es schon angerichtet, solange die Welt besteht«, fuhr Schorsch fort. »Als Jochen mir damals Adieu gesagt hat, habe ich den Kopf geschüttelt über seinen Entschluß. Jetzt trage ich mich manchmal mit dem Gedanken, es ihm gleichzutun. Es gibt so viel Elend auf der Welt, Dan.«
»Hier auch«, sagte Daniel, »wir leben daran vorbei. Wenn wir nicht direkt damit konfrontiert werden, verschließen wir die Augen davor.«
Dr. Leitner sah ihn nachdenklich an. »Du warst immer der gescheiteste von uns allen. Warum will sich Daniel nur mit all diesen lächerlichen Wehwehchen herumplagen, habe ich manchmal gedacht, aber du hast es erfaßt, daß es am Ende nur die richtige Befriedigung ist, wenn man den Menschen als Ganzes nimmt, mit Herz und Seele. Ich möchte mal meine Mutter zu dir schicken.«
»Tu es, Schorsch«, sagte Daniel aufmunternd. »Vielleicht quält sie sich genauso wie du mit Problemen herum, über die sie mit ihrem Sohn nicht reden mag. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man aneinander vorbei schweigt. Glaub nur nicht, daß ich das nicht auch schon mitgemacht habe.«
»Wie läßt es sich eigentlich mit deinem Sanatorium an?« fragte Schorsch nach längerem Schweigen. »Geredet wird ja darüber, aber die lieben Kollegen belächeln deine Vorstellungen. Sei mir nicht böse, wenn ich das sage.«
»Bin ich nicht. Ich weiß es«, sagte Daniel. »In mancher Augen erscheine ich als armer Irrer, aber es war die Idee meines Vaters, und zuerst war ich auch skeptisch. Aber die Erfahrung lehrt, daß es eine gute Idee war.«
»Ich sehe es schon kommen, daß ich mich auch mal dieser Therapie unterziehen werde«, sagte Dr. Leitner nachdenklich. »Nächsten Monat habe ich Urlaub. Ich bin müde, Dan, entsetzlich müde.«
»Wann mußt du in der Klinik sein?« fragte Daniel.
»Punkt acht Uhr. Zwei Operationen.«
»Dann wird es Zeit, daß du schläfst«, meinte Daniel. »Ich kann dir ein Bett anbieten, und morgen früh fahre ich dich rüber.«
»Du warst schon immer ein feiner Kerl«, sagte Dr. Leitner. »Was denkst du von mir? Daß ich ein jämmerlicher Schwätzer bin?«
»Depp«, sagte Daniel lächelnd. »Eine Generalüberholung wäre fällig, und die gibt es unter Freunden und Kollegen kostenlos.«
»Na, dann überhole mich mal«, sagte Schorsch.
*
Am Morgen war er ein anderer. Lenchen zeigte ihre Überraschung nicht, als ein fremder Mann am Frühstückstisch erschien. Einen Mann akzeptierte sie.
»Du bist gut versorgt«, sagte Schorsch zu Daniel, als er den reichgedeckten Tisch sah. »Mutter päppelt mich immer noch mit Haferflocken.«
»Brrr«, machte Daniel. »Sag mal, brauchst du keinen Wecker? Du warst schnell auf den Beinen.«
»Training. So kurz kann die Nacht gar nicht sein, daß ich am Morgen nicht wieder fit wäre. Ich habe dir wohl mächtig die Ohren vollgejammert?«
»Es war nicht so schlimm«, erwiderte Daniel.
»Fee hat gestern abend noch angerufen«, sagte Lenchen laut, als sie den Kaffee einschenkte. Schwerhörig, wie sie war, bekam sie die Unterhaltung der beiden Männer nicht mit. Es war ein wahres Wunder, daß sie am Telefon überhaupt etwas verstehen konnte. Aber Fees Stimme kannte sie ja.
»Ich habe gesagt, daß Sie noch Besuche machen«, brüllte ihm Lenchen ins Ohr.
»Danke«, brüllte Daniel zurück.
»Du brauchst mich nicht zur Klinik zu bringen«, sagte Dr. Leitner. »Ich lasse mir ein Taxi kommen. Ich bin dir genug auf den Wecker gefallen.«
»Es war mir ein Vergnügen, Schorsch«, erwiderte Daniel lächelnd. »Du kannst ruhig öfter mal kommen.«
»Hoffentlich bereust du das Angebot nicht, wenn ich davon Gebrauch mache. Ich habe phantastisch geschlafen. So gut, wie schon lange nicht mehr.«
»Da siehst du, was es ausmacht, wenn man den seelischen Müll abwälzen kann.«
»Und Mutter wird sich den Kopf zerbrechen, wo ich wohl die Nacht verbracht habe«, sagte Schorsch.
»Ich werde sie anrufen und beruhigen«, meinte Daniel.
»Würdest du das wirklich tun?«
»Warum nicht? Euch muß doch zu helfen sein.«
Zuerst riefen sie ein Taxi herbei. Es kam schnell. Für Schorsch Leitner war es auch höchste Zeit.
»Ein netter Mensch«, sagte Lenchen, als er sich verabschiedet hatte. »Ich dachte schon, Sie wären versumpft. Das dulde ich nämlich nicht, daß Fee sich Sorgen macht.«
»Brauchst du doch nicht«, sagte Daniel. Und dann rief er ganz schnell Fee an. Sie war gerade erst aufgestanden. Ihre Stimme klang noch ziemlich verschlafen. Aber sie war gleich ganz da, als Daniel »Guten Morgen, Geliebte« sagte.
»So früh am Morgen und schon so munter?« fragte sie.
»Hast du gebummelt oder ich?« fragte er zurück.
»Hast du gebummelt?« fragte Fee. »Mit wem denn?«
»Mit einem alten Studienfreund. Ich habe ihn zufällig getroffen. Er hat bei mir geschlafen.«
»Ein weiblicher oder männlicher Studienfreund?« fragte Fee.
»Ein männlicher natürlich. Lenchen hat mir eben gesagt, daß du gestern abend angerufen hast. Ist alles in Ordnung, Feelein?«
Seine Stimme klang sehr zärtlich.
»Soweit alles in Ordnung«, erwiderte sie. »Einen despotischen Amerikaner haben wir bekommen.«
»Schorsch werde ich auch zu euch schicken«, sagte Daniel.
»Wer ist Schorsch?«
»Der Studienfreund. Dr. Leitner.«
»Der Gynäkologe?« fragte Fee verwundert. »Du hast mir noch gar nicht von ihm erzählt.«
»Du kennst ihn?« fragte er schon wieder mit einer eifersüchtigen Regung.
»Ich kenne eine Patientin von ihm. Katrin Pietsch.«
»Katrin«, sagte Daniel nachdenklich. »Ist so was möglich.«
»Kennst du sie auch?« fragte Fee.
»Nein, er hat mir nur von ihr erzählt. Woher kennst du sie?«
»Von der Schule. Wir haben eine Schulbank gedrückt. Sie hat mir aber auch nie erzählt, daß sie dich kennt, Daniel.«
»Sie kennt mich auch nicht.«
»Aber du kennst ihren Namen.«
»Nun sind wir beide wieder mal eifersüchtig«, sagte Daniel. »Das war nicht der Sinn meines Anrufes, Liebling. Ich wollte deine Stimme hören. Ich wollte dir sagen, daß ich froh bin, daß ich dich habe, daß es bei uns keine Probleme gibt. Es gibt doch keine?«
»Bei mir nicht«, tönte Fees Stimme durch den Draht.
»Ich habe auch keine. Ich liebe dich«, sagte er.
Eine kleine Pause folgte. »So könntest du mich ruhig öfter morgens wecken«, sagte Fee dann.
»Jeden Morgen, wenn du willst«, sagte Daniel zärtlich.
»Dann wirst du aber eine ziemlich hohe Telefonrechnung bekommen.«
»Zum Ärger des Finanzamtes«, erwiderte er mit leisem Lachen, »aber darauf hatte ich schon längst kommen können, Fee.«
»Komm lieber mal wieder her«, sagte sie.
»Wenn nichts Dringliches vorliegt, am Sonntag«, versprach er.
In bester Stimmung betrat er zehn Minuten später seine Praxis. Er hatte noch Dr. Leitners Mutter anrufen wollen, aber als sich dort niemand meldete, war ihm eingefallen, wie früh es noch war. Alte Damen pflegten doch wohl länger zu schlafen. Gut, daß sie sich durch das Telefon nicht wecken ließ. Es wäre ihm doch peinlich gewesen, sie gestört zu haben.
*
Der Mittwoch war für jene Patienten reserviert, für die er mehr Zeit brauchte. Pünktlich wie immer, war Molly zur Stelle.
Und ganz früh war auch schon Uschi Glimmer gekommen. Sie hatte er völlig vergessen gehabt.
»Fräulein Glimmer ist gar nicht vorgemerkt«, sagte Molly.
Daniel schlug sich an die Stirn. »Ich habe ihr gestern gesagt, daß sie kommen soll. Ist schon in Ordnung, Molly. Ich schiebe sie zwischen Herrn Hieber und Frau Kießling ein.«
Herr Hieber hatte Diabetes und hatte noch immer nicht gelernt, die Insulininjektionen selbst zu machen. Er bekam jedes Mal das große Zittern, wenn Daniel die Spritze aufzog, obgleich er doch wußte, daß sie lebensnotwendig für ihn war.
»Besser wär’s, wenn man das Zeug schlucken könnte«, sagte er. »Daran würde ich mich gewöhnen.«
Weil er nach und nach ganz genau erforschen wollte, wie man zu solch einer Krankheit überhaupt käme, zog sich die Zeit mit einem solchen Gespräch immer in die Länge. An diesem Tage verkündete er Dr. Norden jedoch, daß er sich Informationsmaterial besorgt hätte und nun ganz genau Bescheid wüßte.
»Mein Frau studiert es auch«, erklärte er, »und nun sieht sie auch endlich ein, daß ich diese Spritzen brauche. Sie ist nämlich mehr für Tee, Herr Doktor. Spritzen sind ihr ein Greuel.«
Und in solchen Fällen ist nur dadurch ein Menschenleben zu verlängern, dachte Daniel. Die Entdeckung des Insulins ist eine wahrhaft medizinische Großtat, so erfolgreich wie kaum eine andere.
»Es ist ein Wunder, daß es so etwas gibt«, sagte Herr Hieber, »und ich weiß nicht, wie ich es Ihnen danken soll, Herr Doktor.«
»Ich habe es nicht erfunden«, sagte Daniel. »Das waren zwei Kanadier, Banting und Best. Aber bei denen können Sie sich nicht mehr bedanken, Herr Hieber. Wir Ärzte haben ihnen zu danken, daß wir vielen Menschen helfen können.«
»Was Sie so alles wissen müssen«, sagte Herr Hieber bewundernd. Und dann gestand er doch ein bißchen verlegen ein, daß er es nun selbst mit den Injektionen versuchen wollte.
»Damit ich Ihnen nicht zuviel von Ihrer Zeit stehle, Herr Doktor«, meinte er. »Es gibt andere, die noch schlimmer dran sind.«
Uschi Glimmer war so verlegen, daß sie eigentlich nicht mehr viel zu sagen brauchte. Daniel ahnte schon, was sie bedrückte.
»Na, wir bekommen wohl ein Baby«, half er ihr weiter, als sie kein Wort über die Lippen brachte.
»Sieht man mir es schon an?« fragte sie bebend.
»So etwas fühlt man mehr«, erwiderte er. »Weit kann es noch nicht sein.«
»Und wie ich es meinen Eltern beibringen soll, weiß ich auch nicht. Der Eugen studiert doch noch, Herr Doktor. Vati ist da ziemlich altmodisch.«
»Aber er wird sich an den Gedanken gewöhnen«, sagte Daniel nachsichtig.
»Er wird uns was husten«, sagte Uschi kleinlaut.
»Ich glaube, Ihre Eltern ganz gut zu kennen, Uschi«, sagte Daniel. »Zuerst werden sie sich ein bißchen aufregen, und dann werden sie natürlich auf baldige Heirat drängen.«
»Meinen Sie?« fragte sie zweifelnd.
»Das Kind muß doch einen Namen haben«, sagte Daniel lächelnd. »Was sagt denn der Papa?«
»Der weiß es noch gar nicht. Mir ist das so peinlich, Herr Doktor. Ich möchte eigentlich nicht geheiratet werden, weil ein Kind unterwegs ist.«
»Aber ihr mögt euch doch.«
»Das schon. Eugen ist da auch eigen. Er kann eine Familie noch nicht ernähren. Und ich habe doch auch noch keine Ahnung, was man mit so einem kleinen Baby anfangen soll. Ich finde Kinder ja süß, aber Vati hat doch bestimmt gedacht, daß ich ihn noch entlaste. Er redet immer davon, daß er sich mit Mutti nun auch mal ein schönes Leben machen will.
Es tut mir mächtig leid, wenn ich meine Eltern enttäusche.«
»Aber das Kind möchten Sie schon haben«, sagte Daniel.
»Denken Sie etwa, ich will es loswerden?« fragte Uschi bestürzt.
»Nein, das brächte ich nicht übers Herz. Aber wenn meine Eltern mich nun vor die Tür setzen? Ich kann Eugen doch nicht die ganze Zukunft zerstören. Er hat doch so geschuftet, daß er es zu etwas bringt.«
»Und das wird Ihr Vater sicher anerkennen, Uschi, oder hat er etwas gegen Eugen?«
»Nein, das nicht. Er mag ihn gern. Er blubbert nur immer gleich los, und wenn ich ihm jetzt damit komme, wird er sagen, daß er bloß mal aus dem Hause sein muß, und schon geht alles drunter und drüber. Er soll sich doch nicht aufregen. Wie soll ich es ihm nur sagen, Herr Doktor?«
»Soll ich es ihm sagen?« fragte Daniel väterlich. Ja, er hatte richtig väterliche Gefühle in diesem Moment, als Uschi fragte:
»Würden Sie das tun? Ich wäre Ihnen ja so dankbar. Sie wissen genau, wenn Vati zu kochen anfängt. Ich will doch nicht, daß er sich aufregt. Ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, wie es mal sein wird, wenn ich nicht mehr bei meinen Eltern bin. Maxl ist zwar da, aber…«
Da hörte Daniel gar nicht mehr so richtig hin, denn unwillkürlich mußte er jetzt wieder an einen anderen Max denken. An Max Lamprecht. Wie mochte wohl diese Nacht für ihn zu Ende gegangen sein?
»Wann soll ich denn mit Ihrem Vater sprechen, Uschi?« fragte er, als er sich wieder in die Gegenwart zurückgefunden hatte. »Bald, oder wollen wir noch warten?« »Bald wäre mir schon lieber«, erwiderte sie. »Er macht sich sonst noch Gedanken, weil ich so wenig Appetit habe und weil es mir oft so schlecht wird. Er denkt doch, daß es auch der Magen ist bei mir.«
Sie sagte es so treuherzig, daß er lächeln mußte.
»Ich werde Sie erst einmal zu einem sehr netten Kollegen schicken, der Sie gründlich untersuchen wird«, sagte er. »Und wenn ich dann Bescheid habe, spreche ich mit Ihrem Vater. Okay?«
»Danke«, sagte Uschi schüchtern. »Aber was soll ich machen, wenn mich die Eltern wirklich rauswerfen?«
»Dann schicke ich Sie auf die Insel«, sagte Daniel schmunzelnd, denn er war überzeugt, daß die Glimmers ihre Tochter bestimmt nicht vor die Tür setzen würden.
Er gab ihr die Adresse von Dr. Leitner. »Warten Sie, ich rufe ihn gleich an und frage, wann Sie kommen können, damit Sie nicht so lange warten müssen«, sagte er.
Er erreichte Schorsch zwischen zwei Operationen. Er schien ziemlich aufgeregt.
»Ich versuche schon dauernd, Mutter zu erreichen«, sagte er. »Es meldet sich niemand. Mir ist ganz komisch, Dan. Ich hätte doch lieber nach Hause fahren sollen.«
Er hat mehr als ein Problem, dachte Daniel. »Ich werde es noch einmal versuchen«, sagte er, »vielleicht ist euer Telefon gestört. Ich habe jetzt noch eine Patientin, und bevor ich dann meine Krankenbesuche mache, fahre ich zu deiner Mutter, wenn ich sie nicht erreichen sollte. Wann kann ich dir meine Patientin schicken?«
»Können Sie gegen elf Uhr in der Klinik sein, Uschi?« fragte er, die Hand auf die Sprechmuschel legend. Uschi nickte zustimmend.
»Gut, um elf Uhr, Schorsch. Es ist ein nettes Mädchen.«
Uschi stieg heiße Röte in die Wangen, als er es sagte.
»Sie denken nicht schlecht von mir, Herr Doktor?« fragte sie.
»Dummerchen«, erwiderte Daniel freundlich. »Auf bald.«
Nun kam Frau Kießling an die Reihe. Sie hatte es mit der Bandscheibe, aber um nichts in der Welt wollte sie sich in die Behandlung eines Orthopäden begeben.
»Das habe ich früher mal gemacht«, sagte sie, als er es ihr nochmals ans Herz legte. »Geholfen hat es auch nichts.«
»Wie wär’s, wenn wir ein paar Pfund abnehmen würden?« fragte Daniel. »Weniger essen und viel laufen.«
Er wußte schon, woran es bei ihr haperte.
»Wenn ich laufe, kriege ich noch mehr Appetit«, bekannte sie offenherzig. »Ich habe schon überlegt, ob ich nicht auch einmal in Ihr Sanatorium gehen soll. Frau Seidel hat mir nämlich geschrieben. Sie ist ja so begeistert.«
Die gute Frau Seidel meinte wohl, Propaganda machen zu müssen. So, wie damals, als er hier seine Praxis angefangen hatte.
»Da bekommen Sie aber keine Sahnetorten, Frau Kießling«, sagte er schmunzelnd. »Und dort wird man mit Ihnen auch bedeutend strenger sein als ich. Überlegen Sie es sich lieber gut. Sie würden auf strenge Diät gesetzt werden.«
»In Gesellschaft fällt das Hungern vielleicht leichter«, meinte sie. »Na, und ehrlich gesagt, neugierig bin ich auch. Es muß ja ein Paradies sein.«
»Zur Zeit voll belegt«, sagte Daniel, und da machte sie ein enttäuschtes Gesicht.
»Aber wenn es Ihnen ernst ist, kann ich anfragen, wann ein Zimmer frei wird«, meinte Daniel.
»Ich halte mich auf Abruf bereit«, sagte sie rasch. »Ich brauche ja niemanden zu fragen. Und nicht, daß Sie denken, ich könnte es nicht zahlen, Herr Doktor. Ich habe schon immer etwas auf die Seite gelegt für meine Beerdigung, aber wen kümmert das nachher schon. Da ist es doch besser, wenn man noch ein bißchen was vom Leben hat.«
In solchen Situationen, und die waren gar nicht so selten in seiner Praxis, wußte Daniel Norden nicht, was er sagen sollte. Er war einfach gerührt.
»Dann kann ich nur von Herzen hoffen, daß es Ihnen gefällt, Frau Kießling«, sagte er.
»Die Insel wird wachsen müssen, wenn es so weitergeht«, sagte Molly, als Frau Kießling gegangen war.
Ob Vater es sich so vorgestellt hat? dachte Daniel, und dann griff er zum Telefon und wählte Frau Leitners Nummer, aber sie meldete sich wieder nicht.
*
Eine halbe Stunde später stand er vor dem Haus, das verwittert in einem verwilderten Garten stand. So hatte es schon vor zehn Jahren ausgesehen, als er Schorsch einmal besucht hatte. Ja, gute zehn Jahre war es her, und damals war gerade der Vater von Schorsch gestorben. Und jetzt schien die Zeit zusammenzuschmelzen, weil das Gartentor noch genauso knarrte und die Frau, die in der Tür erschien, noch genauso aussah wie damals. Hatte sie nicht auch das gleiche dunkelgraue Kleid getragen?
Ein staunender Ausdruck trat in ihre Augen, als er dicht vor ihr stand. Sie hatte die Hand an die Stirn gelegt, weil das Licht sie wohl blendete.
»Verzeihung, Frau Leitner«, sagte Daniel, »aber ich habe vergeblich versucht, Sie telefonisch zu erreichen, und Schorsch auch.«
»Der Bagger hat die Leitung heruntergerissen«, erwiderte sie. »Daniel Norden, ich täusche mich doch nicht?«
»In Lebensgröße. Nett, daß Sie mich erkannt haben.«
»Wie könnte ich das nicht. Sie haben sich kaum verändert. Sie haben mit Hans-Georg gesprochen?«
Sie hatte ihn immer so genannt. Der Schorsch war er wohl nur für die Kommilitonen gewesen.
»Ich habe ihn gestern abend zufällig getroffen, und er hat der Einfachheit halber bei mir geschlafen«, erwiderte er. »Sie haben sich hoffentlich keine Sorgen gemacht.«
»Er ist doch wohl erwachsen«, erwiderte sie mit einem flüchtigen Lächeln. »Außerdem hatte ich eine Schlaftablette genommen, weil Föhn war. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ich freue mich sehr, Sie einmal wiederzusehen.«
Schauspielert sie oder ist das ehrlich? fragte er sich. Verkennt Schorsch seine Mutter, oder tut sie nach außen hin nur so, als würde sie ihm alle Freiheiten lassen? Es war ganz interessant für ihn, seine eigene Meinung zu bilden.
Sie schauspielerte nicht, wie er bald herausfand. »Vielleicht können Sie Hans-Georg ein bißchen aufmöbeln, Dr. Norden«, sagte Frau Leitner, nachdem sie ein Glas wirklich köstlichen Sherry getrunken hatten. »Früher wart ihr doch eine so vergnügte Gesellschaft. Jetzt läßt er sich von der Arbeit aufzehren. Und womöglich meint er auch, daß er ewig an meinem Rockzipfel hängen müßte.«
»Vielleicht sind Sie zu besorgt um ihn, Frau Leitner«, sagte Daniel vorsichtig.
»Mein Gott, welche Mutter ist das nicht, solange der Sohn keine eigene Familie hat«, sagte sie. »Freilich hänge ich an ihm, aber ewig werde ich auch nicht leben. Und Sorgen muß ich mir doch um ihn machen, wenn er schon sein ganzes Herz an eine verheiratete Frau gehängt hat. Ich sollte wohl nicht darüber sprechen, aber heute nacht ist es mir wieder gekommen, bevor ich eingeschlafen bin. Ich habe mich gefragt, was ich falsch gemacht habe.«
»Vielleicht sollten Sie ihm morgens vor allem keine Haferflocken vorsetzen«, sagte Daniel mit einem humorvollen Augenzwinkern.
Ganz verschreckt sah sie ihn an. »Aber ich dachte doch, er mag sie«, sagte sie leise. »Hat er sich darüber beschwert?«
»Wenn Sie mich so direkt fragen, mag ich nicht herumreden. Sie reden oder denken einfach aneinander vorbei«, sagte Daniel. »Sie hängen an ihm, und er hängt an Ihnen. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert, und er war ganz aufgeregt, weil er keine Verbindung mit Ihnen bekommen hat. Packen Sie einmal Ihre Sachen, Frau Leitner. Lassen Sie ihn allein, ohne Haferflocken und mütterliche Fürsorge.«
»Würden Sie sich dann ein bißchen um ihn kümmern?« fragte sie leise. »Er hat sich doch völlig verirrt in seinen Gefühlen.«
»Das sagt sich leicht«, meinte Daniel. »Liebe geht oft seltsame Wege, Frau Leitner. Ich will mich nicht weiter dazu äußern und mir auch kein Urteil erlauben, aber was würden Sie denn sagen, wenn er eine geschiedene Frau heiraten würde?«
»Was ich vorhin schon gesagt habe. Er ist erwachsen. Ich möchte nur gern, daß er glücklich wird. Sie werden wohl auch denken, daß sich bei uns gar nichts verändert hat. Das Haus ist noch so wie früher und ich auch, aber wofür soll ich etwas verändern? Das Haus zu renovieren, lohnt sich doch nicht mehr. Wenn Schorsch einmal heiratet«, tatsächlich hatte sie Schorsch gesagt, »dann würde ich in ein nettes Altersheim gehen. Er könnte das Haus niederreißen lassen und ein neues auf dem Grundstück bauen. Mein Gott, warum erzähle ich Ihnen das alles?«
Wie Schorsch, dachte Daniel. Sie hängen aneinander, und sie haben nie miteinander geredet. Warum war das nur so häufig, obgleich doch ein paar offene Worte alle Schranken beseitigen konnten?
Bei ihm und Fee war es ja auch einmal so gewesen. Der Gedanke, daß sie keinen Weg zueinander gefunden hätten, war ihm entsetzlich.
Frau Leitner lächelte, als er sich von ihr verabschiedete.
»Jetzt bin ich ganz froh, daß die Bagger die Telefonleitung zerstört haben«, sagte sie. »So ein persönliches Gespräch ist doch durch nichts zu ersetzen.«
Und so dachte er auch. »Vielleicht kommt Schorsch heute wieder nicht heim«, sagte er. »Dann wissen Sie, wo er steckt.«
Er hatte viel zu denken, als er zurückfuhr. Es mochte wohl möglich sein, daß sie Schorsch manchmal Vorhaltungen gemacht hatte, denn ganz gewiß hatte sie Opfer für sein Studium gebracht. Auch eine gute Mutter wie Frau Leitner war Stimmungen unterworfen, haderte wohl manches Mal mit dem Schicksal, so früh schon Witwe geworden zu sein, und auch damit, daß ihr Sohn ihr nicht eine Schwiegertochter ins Haus brachte, bei der sie ihn glücklich wußte.
Und Schorsch als Mann, eingespannt in einen verantwortungsvollen Beruf, keinen Ausgleich findend in einem glücklichen Privatleben, war auch Stimmungen unterworfen, in denen er jedes Wort auf die Goldwaage legte, seine Mutter egoistisch fand und ihre Fürsorge lästig. All dies war menschlich, vielleicht auch ein Generationsproblem. Doch es brauchte solche Probleme nicht zu geben, wenn man ehrlich zueinander war.
Unwillkürlich wanderten seine Gedanken nun wieder zu Astrid Kürten. War es wirklich erst der dritte Tag, daß er ihren Vater ins Krankenhaus gebracht hatte? Soviel war seither schon wieder geschehen, doch so war es nun einmal in der Praxis eines Arztes. So vielerlei Schicksale Tag für Tag, so viele Konflikte, die nicht spurlos an ihm vorübergehen konnten. Es war ja keine Ware, mit der er sich beschäftigte, es waren Menschen, für deren Leben er Verantwortung übernahm, wenn sie zu ihm kamen.
Wie Fee sich über seinen morgendlichen Anruf gefreut hatte! Ein Lächeln glitt über sein Gesicht. Er könnte doch ruhig etwas aufmerksamer sein, ging es ihm durch den Sinn, öfter einmal anrufen, und ihr auch ab und zu Blumen schicken. Und da hielt er auch schon vor einem Blumengeschäft, aber erst, als er ausgestiegen war, bemerkte er, daß er sich direkt neben dem Hotel befand, das Karl Kürten gehörte.
Welche Blumen schickte man der geliebten Frau? Rote Rosen? Das war so gang und gäbe. Daniel wollte sich nicht daran halten. Er bestellte ein Gesteck aus zartlila Orchideen. Rosen gab es auf der Insel unzählige, deswegen war sie auch Roseninsel genannt worden. Doch jetzt war es die Insel der Hoffnung, eine Oase des Friedens in einer erbarmungslosen, hektischen Zeit.
»Grüß Gott, Fräulein Kürten«, hörte er eine Verkäuferin sagen, und da drehte er sich um und sah Astrid an der Tür stehen. Knabenhaft schlank in einem beigen Hosenanzug, der sie noch farbloser erschienen ließ, als sie war.
Warum nur wählt sie nicht vorteilhaftere Kleidung? dachte er. War das auch eine Art von Protest oder Resignation?
Sie war schrecklich verlegen, als er sie mit einer leichten Verbeugung begrüßte.
»Ein Arrangement für eine Festtafel«, sagte sie stockend zu der Verkäuferin, die nach ihren Wünschen gefragt hatte. »Rosa Rosen und Veilchen. Geht das?«
»Selbstverständlich«, wurde ihr geantwortet, und schon war sie wieder im Gehen begriffen.
»Geht es wieder besser?« erkundigte sich Daniel bei ihr, als sie gemeinsam auf die Straße traten.
»Ja, danke«, erwiderte sie scheu. »Auf Wiedersehen, Herr Doktor.«
Aber dann drehte sie sich doch noch einmal um und lächelte flüchtig. »Besuchen Sie Papa ab und zu?« fragte sie.
Er nickte und wunderte sich doch ein bißchen, daß sie noch einmal grüßend die Hand hob und ihm leicht zuwinkte. Er kannte Wolfgang Bender nicht und wußte nicht, daß er eben in der Tür des Hotels erschienen war. Und er konnte auch nicht ahnen, daß dieser jetzt dachte, daß diese Begegnung zwischen Daniel Norden und Astrid Kürten nicht eine rein zufällige gewesen war.
Also hat Lilly doch nicht gelogen, ging es Wolfgang Bender durch den Sinn.
Er hatte seinen Vorsatz, mit Astrid zu sprechen, noch nicht ausführen können. Sie war ihm geflissentlich aus dem Wege gegangen. Zweimal war sie im Hotel gewesen, um nach dem Rechten zu schauen, seit ihr Vater im Krankenhaus war, aber immer waren dann andere Angestellte um sie herum gewesen.
Astrid ging mit entschlossener Miene an ihm vorbei. Flüchtig erwiderte sie seinen höflichen Gruß. Sie wußte selbst nicht, wie trotzig sie wirkte.
Vor denAngestellten hatten sie nie jene Vertraulichkeit gezeigt, die ihre lange Freundschaft mit sich brachte.
Ja, für sie war es eine schöne Freundschaft gewesen, die schon begonnen hatte, als sie noch in den Kinderschuhen steckte und Wolfgang als Volontär im Unternehmen ihres Vaters anfing. Durch sie hatte er auch Lilly kennengelernt. Lilly hatte ihre Chancen genutzt, während sie, Astrid, viel zu schüchtern gewesen war, Wolfgang ihre Gefühle nur anzudeuten.
Ihr Mädchentraum war es gewesen, mit ihm Hand in Hand zu arbeiten, ihm zu beweisen, daß sie nicht nur die Tochter eines reichen Vaters sein wollte.
Daß Astrid Kürten tüchtig war, bezweifelte jetzt niemand mehr. Seltsamerweise war sie gar nicht unsicher, wenn es um geschäftliche Entscheidungen ging. Sehr sachlich sprach sie mit der Beschließerin, bemängelte einige Nachlässigkeiten der Zimmermädchen, erkundigte sich bei einigen Gästen, die abreisen wollten, ob sie zufrieden gewesen seien. Dann sah sie die Post durch, die an ihren Vater persönlich gerichtet war, erledigte einige Telefonanrufe und inspizierte dann die Küche. Sie tat alles das, was ihr Vater sonst auch persönlich tat.
Endlich fand Wolfgang Bender einen Augenblick, der günstig schien, sie allein zu sprechen.
»Darf ich etwas klarstellen, Astrid?« fragte er ohne Umschweife.
»Ich wüßte nicht, was es klarzustellen gäbe«, erwiderte sie kühl. »Ich fahre jetzt in die Klinik. Sorgen Sie dafür, daß für die Verlobungsfeier alles in Ordnung geht.«
Er sah sie verstört an, denn augenblicklich dachte er nicht daran, daß der kleine Speisesaal für den heutigen Abend für ein Verlobungsessen reserviert worden war.
»Die Blumen habe ich bestellt«, fuhr Astrid fort.
»Die Zahl der Gäste hat sich auf achtundzwanzig erhöht. Sonst noch Fragen?« Es klang ein bißchen herablassend, und es verschaffte ihr eine gewisse Genugtuung, daß sie seine gewohnte Selbstsicherheit ins Wanken gebracht hatte.
»Ich wollte wegen Lilly mit Ihnen sprechen«, stieß er hervor.
»Das erübrigt sich. Meinen Glückwunsch zur Verlobung«, sagte Astrid. Dann eilte sie auch schon hinaus, ohne sich darüber klar zu sein, daß sie gerade mit dieser Reaktion mehr verraten hatte, als sie wollte.
Wolfgang stand momentan zur Bildsäule erstarrt, und dann wurde es ihm schwindelig, als er sah, daß Lilly über die Straße kam und direkt auf Astrid zuging.
»Ich habe bei euch angerufen«, sagte Lilly unverfroren. »Deine Mutter sagte mir, daß du hier bist. Ich dachte, wir könnten gemeinsam essen.«
Das hatten sie früher auch manchmal getan, und sicher hatte Lilly dies mit gleicher Selbstverständlichkeit wie jetzt vorgeschlagen, aber da war Astrid ja auch noch völlig arglos gewesen und hatte es schon gar nicht als Aufdringlichkeit empfunden.
»Ich fahre zu Papa«, sagte sie abweisend.
»Warum bist du böse mit mir?« fragte Lilly.
»Ich bin nicht böse«, erwiderte Astrid, »ich habe nur über einiges nachgedacht.«
»Wenn es wegen Wolf ist, können wir doch reden, Astrid«, sagte Lilly. »Ich wußte nicht, daß du soviel für ihn übrig hast.«
»Woher willst du es jetzt wissen?« fragte Astrid spöttisch. »Ich habe nichts für ihn übrig, wenn es dich beruhigt.«
»Wenn unsere Freundschaft dadurch leidet, möchte ich diese Verlobung lieber ungeschehen machen«, sagte Lilly scheinheilig.
»Freundschaft?« sagte Astrid betont. »Ich war ziemlich naiv.«
Dann setzte sie sich ans Steuer ihres Wagens und fuhr davon. Lilly wartete noch ein paar Sekunden, dann betrat sie die Hotelhalle.
»Ich habe keine Zeit«, sagte Wolfgang sofort barsch, bevor sie noch den Mund auftun konnte. »Herr Kürten schätzt es nicht, wenn wir Privatbesuche während der Arbeitszeit empfangen. Ich mache dabei keine Ausnahme. Ich bin auch nur Angestellter.«
»Hat Astrid dich darauf hingewiesen?« fragte Lilly anzüglich.
»Es wäre ihr gutes Recht. Bitte, geh jetzt. Ich habe keine Zeit.«
»Ich habe die Absicht, hier zu essen«, sagte Lilly ironisch. »Das kannst du mir doch nicht verwehren.«
»Bitte«, sagte er, »und guten Appetit.«
Nun konnte Lilly auch darüber nachdenken, daß sie wohl doch unüberlegt gehandelt hatte. Was war nur plötzlich in Astrid gefahren? Was für einen herrischen Ton schlug sie an? Ob sie jetzt gar ihren Vater beeinflussen würde, Wolf zu entlassen? Der Appetit war Lilly vergangen, außerdem hatte sie nicht die Absicht, das teure Essen selbst zu bezahlen.
Sie dachte über all die Annehmlichkeiten nach, die sie durch Astrid gehabt hatte, die diese Freundschaft so nützlich gemacht hatte. Das mußte sich doch wieder einrenken lassen!
*
Für Astrid sah die Welt plötzlich ganz anders aus. Es war, als wäre sie plötzlich ein ganzes Stück gewachsen.
Die Miene ihres Vaters hellte sich auf, als sie das Krankenzimmer betrat.
»Lieb, daß du kommst, Kleine«, sagte er. »Ich langweile mich furchtbar.«
»Pssst«, machte sie. »Das darfst du nicht sagen Paps. Langweile dich gesund, schalte ab, entspanne dich. Ich gebe mir Mühe, dich würdig zu vertreten.«
Ihre Stimme klang munter, und Karl Kürten sah seine Tochter verwundert an.
»Du bist so verändert«, sagte er, »du hast eine andere Frisur? So solltest du das Haar immer tragen, Astrid. So siehst du viel weiblicher aus.«
»Paps macht wieder Komplimente«, sagte Astrid lächelnd. »Es geht schon wieder aufwärts. Ich bin froh, lieber Paps.« Sie küßte ihn und war in diesem Augenblick doch wieder das kleine Mädchen.
»Ist alles in Ordnung?« fragte er. »Klappt der Laden?«
»Keine besonderen Vorkommnisse. Ein paar Unterschriften brauche ich von dir.«
»Wolf hat doch Prokura«, sagte Karl Kürten.
»Ich denke, daß man ihm nicht zuviel Rechte einräumen sollte«, erklärte Astrid. Wohl war ihr dabei nicht, aber irgendwie mußte sie sich abreagieren.
»Hast du plötzlich etwas gegen ihn?« fragte Karl Kürten. »Ihr habt euch doch immer gut verstanden.«
»Gewiß«, erwiderte sie ausweichend.
»Und ich habe auch in die Zukunft hineingedacht, Astrid«, sagte Karl Kürten gedankenvoll. »Du magst ihn doch.«
Es war ihr sehr unbehaglich, daß er ausgerechnet jetzt damit anfing.
»Er ist tüchtig«, sagte sie. Ungerecht wollte sie nicht sein. Sie mußte schließlich zugeben, daß Wolfgang unersetzlich für ihren Vater war. Gerade jetzt.
»Du bist ja auch noch jung. Man braucht nichts zu überstürzen«, sagte er.
»Du willst mich doch nicht etwa mit ihm verheiraten, Paps?« fragte Astrid leichthin. »Das schlag dir aus dem Sinn. Ich bin gerade erst dabei, eine selbständige Frau zu werden.«
»Es steht dir jedenfalls gut«, sagte er zufrieden und arglos. »Trag nicht immer diese faden Farben, Astrid. Nimm dir ein Beispiel an deiner Freundin Lilly. Sie weiß, wie man sich in Szene setzt.«
»Ja, das weiß sie«, sagte Astrid nachdenklich. »Als Beispiel möchte ich sie mir nicht nehmen, Paps.«
»Ist die Busenfreundin in Ungnade gefallen?« fragte er.
»Ich war ein ziemlich törichtes Mädchen, Paps, und ihr habt mir nie dreingeredet. Eigentlich hätte ich mich schneller entwickeln sollen.«
»Meine Güte, was sind das für Töne«, wunderte er sich
»Gefällt es dir nicht, wenn ich mich jetzt auf meine eigenen Füße stelle? Wollt ihr ewig nur euer Kind in mir sehen?«
»Das wirst du hoffentlich immer bleiben«, sagte er ernsthaft.
»Du sollst mich nicht mißverstehen, Paps. Ich habe euch lieb. Ihr seid wunderbare Eltern, aber ich bin nun mal nicht der Typ, der sich gern verwöhnen läßt. Ich habe nur zu wenig Courage.«
»Die zeigst du aber jetzt schon«, sagte er lächelnd. »Wer hat dich aufgestachelt?«
»Es sind verschiedene Komponente, Paps. Dr. Norden hat mir eine ganz bezaubernde Kollegin geschickt. Mama hat dir sicher von Fräulein Dr. Cornelius erzählt. Wenn ich solch eine Freundin gehabt hätte«, sie unterbrach sich, weil ihre Stimme zu beben begann.
»Sprich dich doch aus, Kleines«, sagte Karl Kürten weich. »Ich möchte wissen, was dich bedrückt.«
»Man wird nur durch Erfahrung klüger«, sagte sie. »Das hast du mir doch gesagt, als ich von der Schule kam. Reifer wird man nur durch schmerzliche Erfahrungen.«
»Durch die man sich aber nicht dazu verleiten lassen soll, jedem zu mißtrauen, mein Kind«, sagte Karl Kürten. »Das Fräulein Dr. Cornelius hat dir also gefallen, und nun willst du mich wohl bearbeiten, daß ich mich in das Sanatorium begebe?« Er warf ihr einen verschmitzten Blick zu.
»Das wollte ich mir eigentlich für später aufheben, Paps, aber da du selbst davon anfängst, bestreite ich es nicht. Es wird dir bestimmt guttun.«
»Und du willst mich begleiten?«
Das hatte sie sich eigentlich gewünscht, aber jetzt stellte sie andere Überlegungen an.
»Ich werde mich indessen bemühen, dich so gut wie möglich zu vertreten«, sagte sie. »Und ab und zu kann ich dich ja besuchen.«
»Ich meine, daß Wolfgang zuverlässig genug ist, um ein paar Wochen allein fertig zu werden«, sagte Karl Kürten, »oder bist du anderer Ansicht?«
Paps hat volles Vertrauen zu ihm, dachte Astrid, und das hatte Wolfgang ja auch immer gerechtfertigt. Sie konnte ihm jetzt nichts anhängen, nur weil sie persönlich von ihm enttäuscht worden war.
Immerhin war es besser so, als daß sie das Gefühl haben müßte, nur als Tochter von Karl Kürten von ihm geheiratet zu werden.
Sie erschrak bei diesem Gedanken, der ihr bewußt machte, daß dies ihr heimlicher Wunsch gewesen war.
»Was ist nun eigentlich mit Wolfgang?« fragte ihr Vater. »Mama redet um den heißen Brei herum, und du schweigst dich aus. Nutzt er meine Krankheit etwa aus, um sich aufzuspielen, oder sind Unregelmäßigkeiten vorgekommen?«
»Nein, Paps«, erwiderte sie. »Er ist sehr gewissenhaft.«
Von der Verlobung mit Lilly wollte sie lieber nichts erwähnen. Sie wußte, daß sich ihr Vater darüber aufregen würde, und er konnte sehr heftig reagieren, wenn ihm etwas nicht in den Kram paßte.
»Wenn du ihn magst, darfst du nicht zu schüchtern sein«, sagte er. »Du bist doch in der besseren Position. Du bist meine Tochter, und dadurch hat er womöglich Hemmungen.«
»Mir liegt es nicht, einem Mann entgegenzukommen«, sagte Astrid mit erzwungener Ruhe. »Bitte, versteife dich nicht darauf, daß Wolfgang dein Schwiegersohn wird.«
Das werden wir ja sehen, dachte Karl Kürten. Ich werde schon dahinterkommen, was da gespielt wird. Sollte da etwa dieses kleine Biest, diese Lilly, dazwischenfunken? Der Gedanke kam ihm, als er dann später, wieder allein, über das Gespräch mit seiner Tochter nachdachte.
*
Astrid war nicht gleich heimgefahren. Sie hatte in einem kleinen Café nahe der Klinik einen Mokka getrunken und dabei einen Entschluß gefaßt, der ihre Mutter ein paar Stunden später in sprachloses Staunen versetzte. Sie erschien mit einer neuen Frisur und in ein zauberhaftes türkisfarbenes Kostüm gekleidet daheim. Sie brachte auch noch einige Pakete mit.
»Paps hat gesagt, ich soll mich nicht immer in fade Farben kleiden«, sagte sie entschuldigend.
»Er mußte wohl erst einmal richtig krank werden, um unserem Äußeren Aufmerksamkeit zu schenken«, sagte Melanie Kürten lächelnd. »An mir hat er plötzlich auch allerhand auszusetzen.«
»I wo, Mami«, sagte Astrid, »du bist hübsch genug.«
»Na, na, ich dürfte auch etwas schicker sein, meint Papa. Immerhin ist es erfreulich, daß er sich über uns Gedanken macht und nicht nur über seine Geschäfte. Die Frisur steht dir gut, Astrid. Du siehst viel lieblicher aus.«
Jetzt mußte Astrid lachen. »Du hättest ja schon früher etwas sagen können, daß du dir eine flottere Tochter wünschst.«
Nachdenklich sah Melanie Kürten ihre Tochter an. »Wenn einem ein Mensch nahesteht, gefällt er so, wie er ist, Kleines«, sagte sie. »Es ist nicht meine Art, anderen etwas aufzwingen zu wollen. Äußerlichkeiten waren mir auch nie wichtig. Aber was sollen wir lange darüber reden. Ich finde, daß du reizend aussiehst.«
War sie tatsächlich in eine neue Haut geschlüpft? Astrid betrachtete ihr Spiegelbild, und es war ihr, als müßte sie sich selbst erst kennenlernen.
Jetzt, da sie sich von Lillys Einfluß freigemacht hatte, wurde es ihr ganz bewußt, daß diese nicht erst in jüngster Zeit, sondern schon immer, ganz raffiniert verstanden hatte, sie zu ihren Ungunsten zu beeinflussen. Wer hatte ihr denn die faden Farben aufgeschwatzt? Wer hatte denn stets gesagt, daß sie ihren knabenhaften Typ unterstreichen müßte. Und sie selbst hatte ja auch nicht auffallen wollen.
Sie fuhr sich mit den Fingern durch das Haar, strich ihre seidigen Augenbrauen glatt und ertappte sich dabei, wie sie lächelte und dieses Lächeln studierte. Dann zupfte sie noch ein paar Haarsträhnen in die Stirn, was noch kecker wirkte.
»Astrid, du warst ein Schaf«, sagte sie. »Ein richtiges, dummes Schaf. Aber das wird jetzt anders werden.«
*
Dr. Norden war länger unterwegs gewesen, als vorauszusehen gewesen war. Er hatte noch nicht mit seinem Kollegen Leitner telefonieren können. Als er in die Praxis kam, fand er eine Nachricht von Molly vor, daß Dr. Leitner angerufen hätte und um seinen Rückruf bäte.
Molly hatte Mittwochnachmittag frei, und das war auch nötig, denn ihren Haushalt mußte sie auch versorgen.
Daniel rief Dr. Leitner an.
Sie telefonierten eine Viertelstunde miteinander, und als Schorsch dann zu einer Entbindung gerufen wurde, verabredeten sie, daß er am Abend noch bei Daniel vorbeikommen würde.
Jedenfalls war nun bestätigt, daß Uschi ein Baby erwartete. Vielleicht sollte er doch lieber gleich mit ihren Eltern sprechen, bevor das Mädchen sich mit trüben Gedanken herumplagte.
Franz Glimmer begrüßte Daniel freudig. »Das Benzin schon wieder alle, Herr Doktor?« fragte er.
»Nachfüllen können wir«, erwiderte Daniel. »Ich habe heute eine Menge Besuche machen müssen.« So einfach war das gar nicht, einen richtigen Anfang zu finden. »Ich hätte auch gern mit Ihnen und Ihrer Frau gesprochen, Herr Glimmer.«
»Wegen Uschi? Fehlt ihr etwas Ernsthaftes?« fragte Franz Glimmer besorgt.
»Es kommt darauf an, wie man es betrachtet«, sagte Daniel.
Franz Glimmer wischte sich die Hände ab. »Na, dann gehen wir mal rein«, sagte er. »Uschi ist nicht da. Sie war heute den ganzen Tag unterwegs. Hat sich wohl noch mit ihrem Eugen getroffen. Na ja, da kann man nicht so sein. Das Mädel arbeitet ja auch genug.«
»Sie haben doch nichts gegen den netten Jungen?« fragte Daniel.
»Wo werd ich denn«, meinte Franz Glimmer. »Ordentlich und solide ist er. Und er hilft, wo er kann. Es ist schon gut, wenn ein Mädchen nicht an so einen Hallodri gerät.« Er rief nach seiner Frau. »Mutti, ich bringe Besuch mit«, sagte er.
Das veranlaßte Frau Glimmer, schnell ihre Schürze abzulegen. Wie immer, war sie sehr adrett gekleidet. Ihr Blick wanderte zwischen Dr. Norden und ihrem Mann hin und her, und Daniel hatte den Verdacht, daß sie schon etwas wußte oder zumindest ahnte.
Aber bevor Daniel noch eine Erklärung abgeben konnte, erschienen Uschi und Eugen.
Uschi wurde glühendrot, als sie Dr. Norden die Hand reichte. Eugen warf dem Arzt einen fragenden Blick zu, was Daniel veranlaßte zu sagen, daß er gerade erst gekommen wäre.
»Das ist auch meine Angelegenheit«, sagte Eugen schnell. Er ruckte seine Krawatte zurecht. Er sah sehr seriös aus in dem dunklen Anzug, fast feierlich.
Die Glimmers tauschten einen langen Blick, dann sagte Franz Glimmer: »Das ist es also. Du liebe Güte.«
»Wir haben doch noch gar nichts gesagt«, warf Uschi schüchtern ein.
»Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter«, sagte Eugen Bächler ohne Überleitung.
»Und Dr. Norden wollte mit uns sprechen«, brummte Franz Glimmer. »Da brauchen wir wohl keine lange Erklärung, was, Mutti?«
»Ist Uschi nicht noch ein bißchen jung?« fragte Frau Glimmer stockend.
»Wir lieben uns«, sagte Eugen.
»Und das kommt in den besten Familien vor«, erklärte der Herr des Hauses. »Gedacht habe ich mir so was ja schon.«
»Was?« fragte seine Frau.
»Daß wir Großeltern werden«, erwiderte er. »Deswegen habe ich Uschi ja auch zu Dr. Norden geschickt. Bevor sie Dummheiten macht, habe ich gedacht, ist es besser, er redet mit ihr.«
»Uschi ist ein sehr vernünftiges Mädchen«, warf Dr. Norden ein. »Sie würde keine Dummheiten machen.«
»Ich freue mich doch auf das Baby«, flüsterte sie, suchte dann aber doch Zuflucht in Eugens Armen.
»Ich freue mich auch«, erklärte der junge Mann.
»Ja, dann werden wir wohl anbauen müssen«, sagte Franz Glimmer.
»So schnell geht das doch nicht«, sagte seine Frau kleinlaut.
»Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte« sagte Daniel, erleichtert, daß es so ruhig abging. »Uschi und Eugen könnten doch Frau Seidels Wohnung vorerst nehmen. Sie bleibt doch auf der Insel.«
Da fiel ihm Uschi spontan um den Hals. »Sie wissen doch immer einen Rat«, sagte sie.
»Und wir können nur ja sagen«, meinte Franz Glimmer. »Haben Sie etwa gedacht, daß wir unser Mädel vor die Tür setzen, Herr Doktor?«
»Man weiß ja nie, wie Eltern reagieren«, sagte Daniei schmunzelnd.
»Und bei Vati kommt es doch immer auf die jeweilige Stimmung an«, warf Uschi ein.
»Sag nur nicht, daß ich launisch bin«, protestierte Franz Glimmer.
»Sag ich doch nicht, aber wenn du dich gerade erst über irgend etwas geärgert hast, gehst du in die Luft.«
»Früher vielleicht, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ja meine Magenschmerzen los, und wenn ich mich ärgere, denke ich ganz schnell an die Insel. So, nun werden wir beratschlagen, wann die Hochzeit stattfindet.«
Da konnte sich Daniel beruhigt verabschieden. Aber er mußte vorher noch versprechen, zumindest beim Hochzeitsessen Gast zu sein.
*
Daniel fuhr heim und fand Schorsch schon in seiner Wohnung vor. Lenchen hatte einmal wieder Anlaß zu herber Kritik.
»Man sieht’s ja, daß andere Ärzte eine geregelte Freizeit haben«, brummte sie.
»Auch nicht immer«, sagte Daniel und tätschelte ihre Wange.
»Es war ausnahmsweise eine ganz unkomplizierte Geburt«, sagte Schorsch entschuldigend. »Ich will mich nicht lange aufhalten. Mutter wartet mit dem Essen auf mich. Nett von dir, daß du mit ihr gesprochen hast, Dan. Sie hat sich mächtig gefreut, dich mal wiederzusehen.«
»Redet offen miteinander«, sagte Daniel.
»Ich sehe es ja ein, daß ich ungerecht war. Mutter ist nicht schuld an meinen Konflikten. Nimm es mir nicht übel, daß ich meine Sorgen bei dir abgeladen habe, Dan. Ich weiß, daß ich ein Depp bin«, fügte er mit einem flüchtigen Lächeln hinzu, »aber gegen Liebe ist kein Kraut gewachsen.«
Der eine wird glücklich, und der andere kann daran zugrunde gehen, ging es Daniel durch den Sinn. Er hoffte, daß das letzte für Schorsch nicht zutreffen würde.
»Laß von dir hören«, sagte er, als sie sich verabschiedeten.
Kaum war er gegangen, und Lenchen hatte energisch erklärt, daß sie das Essen jetzt nicht noch einmal warm machen würde, läutete das Telefon.
Es war Max Lamprecht, der Daniel vorschwärmte, daß Sibylle eine ganz tolle Frau sei, mit der man stundenlang reden könnte.
»Nur reden?« fragte Daniel freundschaftlich spottend.
Max schien bereit, ihm ausführlichste Auskünfte zu erteilen, aber Lenchen wurde ungeduldig. So sagte Daniel, daß er noch Besuche machen müßte, er hatte jetzt auch Hunger.
Und dann war er froh, noch einen geruhsamen Abend verbringen zu können. Es war es nicht mehr gewohnt, eine Nacht durchzubummeln.
Am nächsten Morgen wurde er von Fee geweckt. Sie wußte ja, daß Punkt sieben Uhr sein Wecker läutete. Sie rief fünf Minuten vor sieben an. Sie hatte noch am Abend die Orchideen bekommen und wollte sich bedanken.
»Du bist ja närrisch, Daniel«, sagte sie.
»Wieso?« fragte. er.
»Gibst ein Vermögen für Blumen aus. Es genügt, wenn du an mich denkst.«
»Ab und zu sollst du es auch sehen. Ich denke immer an dich«, sagte er zärtlich. »Es ist schön, von dir geweckt zu werden. Ich freue mich schon auf die Zeit, wo das jeden Morgen mit einem Kuß geschieht.«
Froh begann er diesen Tag. Molly dagegen machte einen niedergeschlagenen Eindruck. Es entging ihm nicht.
»Na, was ist denn los?« erkundigte er sich.
»Sie haben genug Sorgen«, sagte sie. »Mit meinen muß ich allein fertig werden.«
»Unsinn, ich schenke Ihnen ein geneigtes Ohr«, sagte er aufmunternd.
»Sabine ist erst um drei Uhr heimgekommen«, sagte sie seufzend.
»Sie wird flügge, Molly«, meinte er beschwichtigend. »Ab und zu schlägt man da über die Stränge. War es bei Ihnen nicht auch manchmal der Fall?«
»Ich hätte etwas von meiner Mutter zu hören bekommen, aber Sabine wirft den Kopf in den Nacken und verschwindet. Sie scheint einen neuen Freund zu haben.«
»Sie ist ein hübsches Mädchen«, sagte Daniel.
»Reden kann sie doch mit mir. Man macht sich als Mutter doch auch Sorgen.«
»Welche Mutter machte sie sich nicht? Sie hätte schon sehr gleichgültig sein müssen. Vielleicht war ihr selbst nicht ganz wohl, daß sie so spät heimgekommen ist. Reden Sie bei Gelegenheit mal vernünftig mit ihr, Molly. Ich glaube nicht, daß sich Sabine verplempert. Dazu ist sie viel zu realistisch.«
Er dachte unwillkürlich an Uschi Glimmer. Nun ja, ein Mädchen, auch ein realistisch eingestelltes Mädchen, konnte an den Falschen geraten. Uschi hatte Glück gehabt.
Das Telefon läutete, und da Daniel gerade daneben stand, nahm er selbst den Hörer ab.
Es war Sabine. Kleinlaut fragte sie, ob sie ihre Mutter sprechen könnte.
»Na also«, sagte Daniel zu Molly, »da haben wir schon die reuevolle Tochter.« Er reichte Molly den Hörer und freute sich, als ihre Miene sich aufhellte. Er war so gut gelaunt, und er wollte keine betrübten Mienen um sich sehen.
»Sie haben gestern Frau Guntrams Geburtstag gefeiert«, erklärte Molly. »Da haben sie sich verbummelt.«
Daniel hatte bisher nicht gewußt, wann Isabel Guntram Geburtstag hatte, aber nun schien es ihm doch angebracht, ihr auch seine Glückwünsche noch nachträglich zu übermitteln. Aber jetzt mußte er erst die Sprechstunde hinter sich bringen.
*
Astrid erschien an diesem Morgen schon um neun Uhr im Hotel. Der Portier sah sie fassungslos an, und noch fassungsloser war Wolfgang Bender, der gerade dem Lift entstieg.
Astrid trug zu einem hellblauen Leinenrock eine blauweißgemusterte Bluse und darüber einen schicken Pullunder. Ihr Haar war vom Wind etwas verweht, aber gerade das gab ihr einen gewissen Pfiff, den man bei ihr nun gar nicht gewohnt war. Sie konnte es jedoch nicht verhindern, daß ihr das Blut in die Wangen stieg, als sie so konsterniert gemustert wurde.
Weil sie ihrer neuen Rolle doch noch nicht ganz gewachsen war, verschwand sie fürs erste im Büro, das sie jedoch leer vorfand. Der Platz an der Schreibmaschine war verwaist. Gleich darauf erschien nach einem kurzen Anklopfen Wolfgang Bender.
»Frau Wolters ist krank«, erklärte er.
»Sie ist ziemlich oft krank«, stellte Astrid fest. »Wir werden uns nach einem Ersatz umsehen müssen. Vorerst werde ich die Schreibarbeiten erledigen. Liegt etwas Dringendes vor?«
Er brachte kein Wort über die Lippen. Astrid wiederholte ihre Frage ironisch.
»Soll Frau Wolters entlassen werden?« fragte er stockend.
»Ich werde überprüfen, ob sie tatsächlich krank ist oder nur bummelt. Oder paßt es ihr nicht, daß ich meinen Vater vertrete?«
»Sie hat auch früher schon öfter gefehlt«, sagte Wolfgang.
»Und mein Vater gewöhnt sich ungern an neue Gesichter«, bemerkte Astrid. Sie sah, daß er blaß wurde und diesen Worten anscheinend eine hintergründige Bedeutung beimaß, die sie nicht beabsichtigt hatte.
»Mein Vater wird noch einen längeren Kuraufenthalt brauchen«, fuhr sie rasch fort. »Ich möchte, daß er sich nicht die geringsten Sorgen zu machen braucht. Ihr Jahresurlaub wäre jetzt eigentlich fällig.«
»Das ist doch nicht wichtig«, sagte er heiser. »Ich habe keine Pläne gemacht.«
»Nein?« Sie sah ihn dabei nicht an.
»Würden Sie mir bitte Gelegenheit für eine Erklärung geben, Astrid«, sagte Wolfgang gepreßt. »Es stimmt nicht, wenn Lilly Ihnen sagte, daß wir uns verlobt haben.«
»Ihre Privatangelegenheiten interessieren mich nicht«, erklärte sie trotzig. »Wirklich nicht.«
»Ich wollte es nur klargestellt haben«, sagte er steif.
»Hat bei dem Verlobungsessen gestern alles geklappt?« lenkte Astrid ab.
»Zur vollsten Zufriedenheit«, erwiderte Wolfgang.
Zwischen ihnen stand eine Mauer. Mit ein paar Worten wäre sie niederzureißen gewesen, aber Wolfgang wagte diese Worte nicht zu sagen, und mittags sah er dann wieder Astrid und Dr. Norden vor dem Blumengeschäft. Auch in ihm regte sich jetzt ein gewisser Trotz.
Und dabei war auch diese Begegnung rein zufällig gewesen. Heute mußten sie beide lachen, aber gleichzeitig mußte auch Daniel über Astrids Verwandlung staunen.
»Wie ein junger Frühlingstag«, sagte er heiter. »Ich darf Ihnen doch ein Kompliment machen, Fräulein Kürten?«
»Ich bedanke mich«, erwiderte sie.
»Wenn wir uns öfter treffen, wird vielleicht jemand auf falsche Gedanken kommen«, sagte Daniel beiläufig.
»Fräulein Dr. Cornelius?« fragte sie schelmisch.
»Ich bin durchschaut«, erwiderte er belustigt. »Aber diesbezüglich können wir unbesorgt sein.« Sein Blick schweifte zum Hotel, und nun stieg glühende Röte in Astrids Gesicht.
»Haben Sie nicht Appetit auf frischen Hummer, eben eingetroffen?« fragte sie hastig.
»Ich habe leider nicht viel Zeit«, sagte er. »Appetit schon.«
»Sie werden bevorzugt bedient und auch ganz separat«, sagte sie.
Sieh da, die Eva in ihr regt sich, dachte Daniel. Aber warum sollte er ihr diese kleine Genugtuung nicht verschaffen?
»Also angenommen«, erwiderte er.
Ihre schönen Augen strahlten ihn an, und das entging Wolfgang nicht.
Für ihn hat sie sich so verwandelt, dachte er deprimiert. Und das dachten auch andere mit einiger Schadenfreude, vor allem der Portier, dem es gar nicht in den Kopf gewollt hatte, daß Wolfang Lilly den Vorzug gab.
»Sie müssen mir aber Gesellschaft leisten«, sagte Daniel zu Astrid, als sie ihn zu dem festlich gedeckten Tisch begleitete. »Allein esse ich nicht gern.«
Der Hummer war köstlich. Wolfang konnte nicht wissen, daß sich das Tischgespräch hauptsächlich um Felicitas Cornelius drehte und um die Insel der Hoffnung. Er hörte nur ab und zu ein Lachen, und seine Stimmung sank auf den Nullpunkt. Schließlich war Dr. Norden ein Mann, mit dem so schnell keiner konkurrieren konnte. Aber Wolfgang erinnerte sich auch, ihn mit einer blonden Frau im Auto gesehen zu haben. Mit einer Frau, die er geküßt hatte. Mit der Treue schien er es nicht so genau zu nehmen, und für einen Flirt war Astrid doch wahrhaftig zu schade.
Man konnte wohl sagen, daß Wolfgang Bender keinerlei Sympathie für Dr. Norden hegte. Er fand ihn arrogant, und kalte Wut stieg in ihm empor, als er sah, daß Daniel Astrid zum Abschied die Hand küßte. Das allerdings tat Daniel nur, weil er den zornfunkelnden Blick wahrgenommen hatte, denn im allgemeinen war er nicht für solche Gesten.
Als Daniel in die Praxis zurückkehrte, traf er vor dem Lift wieder mit Lilly zusammen. Sie warf ihm einen herausfordernden Blick zu.
»Von ärztlicher Schweigepflicht halten Sie wohl nicht viel?« fragte sie schnippisch.
»Ich wüßte nicht, daß ich sie jemals verletzt hätte«, erwiderte er.
»So? Ich möchte betonen, daß ich aus Besorgnis um Astrid mit Ihnen gesprochen habe, nicht, damit unsere Freundschaft zerstört wird.«
»Sie sprechen in Rätseln, Fräulein Friedinger«, sagte Daniel abweisend. »Aber vielleicht sollte ich Ihnen einen Rat geben. Freundschaft wird zu oft mißbraucht. Ich würde mich hüten, einen empfindsamen Menschen zu verletzen.«
*
Der Nachmittag ging ohne besondere Vorkommnisse vorbei, dennoch wurde die eigentliche Sprechzeit weit überschritten.
Gegen halb sieben Uhr rief Isabel an, die sich bei Daniel für die Blumen bedanken wollte.
»Woher weißt du denn, daß ich Geburtstag hatte?« fragte sie.
»Molly hat es mir erzählt«, erwiderte Daniel. »Sabine ist so spät nach Hause gekommen.«
»Soll das ein Vorwurf sein, Daniel?« fragte sie.
»Nicht die Spur. Du warst wieder mal unterwegs. Wir haben uns lange nicht gesehen.«
»Jetzt sag nur nicht, daß du Sehnsucht nach mir hast«, tönte ihre Stimme durch den Draht. »Wir können heute abend eine Nachfeier veranstalten, wenn du Zeit hast.«
»Gut«, sagte Daniel, »wie alt bist du eigentlich geworden?«
»Sei nicht so indiskret. Jetzt geht es mit Endspurt auf die Dreißig zu.«
»Ein interessantes Alter für eine Frau«, scherzte er. »Wo treffen wir uns?«
»Du kannst mich ja abholen, Daniel. Ich freue mich.«
Lenchen war natürlich unzufrieden, daß er schon wieder ausging.
»Nur keine Panik, Lenchen«, sagte er lächelnd, »wenn ich erst verheiratet bin, bleibe ich jeden Abend zu Hause.«
»Na, hoffentlich dauert das nicht mehr lange«, sagte sie.
Daniel zog seinen Trachtenanzug an, damit Isabel nicht etwa auf den Gedanken kommen könnte, mit ihm in eine Bar zu gehen, aber als er dann bei ihr läutete, eröffnete sie ihm gleich, daß sie nicht daran dachte, auszugehen.
»Heute bist du mein Gast, Daniel«, sagte sie ungezwungen.
Sie war schmaler geworden und sah angegriffen aus. Er wollte es ihr nicht sagen, aber sie spürte, wie er sie forschend musterte.
»Es wird Zeit, daß ich Urlaub mache«, sagte sie. »Hoffentlich hast du nichts dagegen, daß ich ihn auf der Insel verbringen will.«
»Sie sind ziemlich ausgebucht«, sagte er.
»Ja, ich weiß. Ich habe vorhin mit Fee telefoniert. Für mich haben sie noch Platz.«
»Wann fährst du?« fragte er hastig.
»Schon am Samstag. Es freut mich aber, daß Fee mir keine Absage erteilt hat.«
Herrliche Blumen standen überall im Zimmer. »Es freut mich auch, daß du mir gratuliert hast, Daniel«, sagte Isabel.
»Du hast mir nie gesagt, wann du Geburtstag hast«, sagte er.
»Du hast mich nicht gefragt. Was möchtest du als Aperitif?«
»Gar keinen. Ein Bier wär mir recht«, erwiderte er.
»Dann können wir ja gleich essen«, sagte Isabel. »Roastbeef, Spargelsalat und Käseplatte. Mehr habe ich nicht zu bieten.«
Daniel lächelte. »Es genügt vollauf. Sag mal, Isabel, du kriegst doch nicht etwa Torschlußpanik, weil du nächstes Jahr dreißig wirst?«
»Ach was, es sind nicht die Jahre«, erwiderte sie. »Mir ist manchmal alles über. Was würdest du sagen, wenn ich den Wunsch hätte, ein Kind zu adoptieren?«
»Nichts«, platzte er heraus.
»Wieso nichts?« fragte Isabel.
»Weil das wahrscheinlich schon von der gesetzlichen Seite her unmöglich ist. Du solltest es wissen, Isabel.«
»Auch wenn es sich um ein kleines
vietnamesisches Waisenkind handelt, das niemanden hat?«
»Nun mal mit der Ruhe«, sagte Daniel. »Du machst dir anscheinend gar keine Vorstellung über die Schwierigkeiten. Du hast im Augenblick nur Mitgefühl.«
»Erbarmen«, sagte sie. »Mir ist es ganz elend, seit ich diese Würmchen gesehen habe.«
»Wo?«
»In London. Es hatten sich Ehepaare gemeldet, die zur Adoption bereit waren, und als die Kinder dann ankamen, haben sie kapituliert. Ich sollte einen Artikel darüber schreiben, Daniel. Ich konnte es nicht. Mir war noch nie so elend.«
Und sie hatte sich wahrscheinlich den Kopf darüber zergrübelt. Das war eine andere Isabel als jene, die er kannte. Es war nicht mehr die ehrgeizige, emanzipierte, sondern nur eine mitleidvolle und mitleidende.
»Jetzt setz dich erst mal hin«, sagte er. »Darüber muß man sich aussprechen. Du bist schließlich eine berufstätige, alleinstehende Frau. Du bist doch gar nicht in der Situation, dich nur einem Kinde zu widmen. Du bräuchtest jemanden, der sich um das Kind kümmert, wenn du abwesend bist, oder du müßtest es in ein Heim geben. Allein das würde eine Adoption schon illusorisch machen. Dann kommen auch noch andere Schwierigkeiten hinzu, die du bedenken solltest. Das Kind behält auf jeden Fall seine Staatsangehörigkeit.«
»Das ist doch lächerlich«, begehrte Isabel auf.
»Es ist aber so. Ich kann mir schon vorstellen, daß adoptivbereite Eltern kapitulieren, wenn sie in die Mühle der Gesetze geraten sind. Und du machst dich jetzt erst mal frei von Emotionen, Isabel. Ich finde es wunderbar, daß du sie hast, aber man muß auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wenn du jetzt den Wunsch nach einem Kind verspürst, solltest du heiraten. Oder auch nicht, wenn du den Mann findest, den du dir als Vater deines Kindes wünschst.«
»Und wenn er unerreichbar für mich ist?« fragte sie heiser.
Habe ich etwa falsche Hoffnungen in ihr geweckt, weil ich ein paar Blumen zum Geburtstag schickte? fragte er sich beklommen. Habe ich sie in solchen Hoffnungen bestärkt, weil ich so rasch bereit war, den Abend mit ihr zu verbringen? Wieviel Fehler konnte ein Mensch eigentlich unüberlegt machen?
»Bilde dir nur nichts ein«, stieß Isabel hervor. »Du bist nicht der Mann.«
Nun hätte er eigentlich erleichtert sein können, aber er war es nicht. Bei
Isabel wußte man nie so recht, woran man war.
»Entschuldige, daß ich davon angefangen habe«, fuhr sie fort, »aber sie hatten mich wegen der Reportage so bekniet, und ich hatte ja auch die Absicht, sie zu schreiben. Es rührt die Menschheit, wenn man so was richtig verpackt. Es wird gelesen und wieder vergessen. Mich hat es richtig gepackt, und wenn man so etwas schreibt, muß man ja auch eine Lösung finden für solche Probleme. Ich hasse diese Geschichten mit dem Fragezeichen, bei denen jedem selbst überlassen bleibt, eine Lösung zu finden.«
»Du schreibst die Story also nicht?« fragte Daniel.
»Nein, ich schreibe sie nicht. Ich habe es satt, als die Sensationsreporterin betrachtet zu werden, die heiße Eisen anfaßt. Deswegen möchte ich jetzt auch Abstand gewinnen, Dan.«
Sie lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. Eine ungeheuer attraktive Frau war sie, faszinierend in ihrer Ausdrucksfähigkeit. Kein Püppchen, das nur schön war. Ihre Schönheit kam aus dem Geist, der sie belebte.
»Männer können das nicht verstehen«, sagte sie gedankenverloren. »Es ist keine Torschlußpanik, wenn man die Zahl Dreißig vor Augen hat. Man möchte seinem Leben nur einen Sinn geben. Gestern, als wir gefeiert haben, ist es mir so richtig bewußt geworden, Daniel. Anfangs waren wir eine große Runde, dann, um Mitternacht, hatten sich die Pärchen zusammengefunden, nur ich war allein. Ich habe sie betrachten können und blieb meinen Gedanken überlassen.
Sabine ist ein reizendes Mädchen. Ich habe zurückgedacht. Ich war genauso wie sie, als ich neunzehn war. Jung und ehrgeizig und auch hübsch.«
»Das bist du immer noch«, sagte Daniel. »Mehr als das.«
Er hatte es auch nicht sagen wollen, aber es tröstete ihn, daß sie jetzt unbefangen auflachte.
»Die kleine Sabine hatte mächtige Gewissenskonflikte, weil es so lange gedauert hat«, fuhr Isabel fort. »Sie hat sich sehr mit Uwe Winter angefreundet, unserem Lokalreporter. Und wenn sie gescheit ist, heiratet sie ihn. Er meint es ernst. Es wäre schade, wenn sie in zehn Jahren auch mal so dasitzen würde wie ich, um darüber nachzudenken, ob sie alles richtig gemacht hat.«
Daniel sah Isabel eine Weile schweigend an. »Ergehen wir uns also in Erinnerungen«, sagte er. »Ich entnehme deiner Bemerkung, daß du mit neunzehn auch verliebt warst.«
»Nicht nur mit neunzehn«, erwiderte Isabel. »Ich könnte längst verheiratet sein, wenn ich meine Karriere nicht so verdammt wichtig genommen hätte. Und sicher wäre ich auch glücklich geworden. Es waren alles unglaublich nette Männer. Diesbezüglich hat es das Schicksal immer gut gemeint. Auch damit, daß ich dich kennenlernte. Mit dir kann man über alles reden. Kindernärrisch war ich eigentlich nie. Das kam erst, als ich diese kleinen, hilflosen, halbverhungerten Geschöpfe sah.« Darauf versank sie in Schweigen, und auch Daniel dachte nach.
»Wie wäre es, Isabel, wenn du die Reportage doch schreiben würdest?« fragte er. »Mit dem Fragezeichen und ohne jede Beschönigung. Vielleicht finden sich dann Eltern für diese Kinder. Eltern, die sich vergeblich ein Kind wünschten und bei denen alle Voraussetzungen gegeben sind, daß sie es bekommen. Wenn du noch zehn Jahre älter wärest, würde ich sagen, du solltest es riskieren. Jetzt ist es noch zu früh.«
»Vielleicht hast du recht, Daniel«, sagte Isabel. »Solchen Entschluß muß man bis ins letzte durchdenken. Und als Appell könnte ich die Reportage schreiben. Ich will dir nicht verschweigen, daß ich heute einen gewaltigen Krach mit dem Chef deswegen hatte. Er hat mir an den Kopf geworfen, daß ich zu sentimental würde und vielleicht in die Frauenredaktion einer Illustrierten überwechseln sollte, die auf der Nostalgiewelle schwämme.«
»Das kannst du immer noch, wenn du mal für eine Zeit abgeschaltet hast, Isabel«, sagte Daniel. »Ich persönlich finde nichts Anrüchiges dabei. Ganz im Gegenteil! Ich trinke auf dein Wohl, auf einen neuen Lebensabschnitt, auf einen glücklichen für dich.«
»Dazu gehört eigentlich Sekt«, sagte sie.
»Laß mich beim Bier. Es bekommt mir besser. Mit meinen paar Pfunden brauche ich ja doch noch nicht zu kämpfen.«
»Aber essen mußt du jetzt«, sagte sie, »und dann, ehe ich es vergesse, sag deiner Molly, daß sie sich um Sabine keine Sorgen zu machen braucht. Das Mädchen ist in Ordnung, und wenn sie an Uwe hängenbleibt, hat sie bestimmt nicht falsch gewählt.«
»Ich werde es Molly sagen, und es wird sie beruhigen. Und dir möchte ich sagen, daß dir der Hauch von Sentimentalität gut steht.«
»Na denn«, sagte Isabel, »Prost, Daniel!«
*
Am nächsten Morgen wartete Daniel schon fünf Minuten vor sieben Uhr auf Fees Anruf, aber er blieb aus.
Ob Fee doch eifersüchtig ist wegen
Isabel? überlegte er.
Er hatte sich bald von ihr verabschiedet und war schon gegen elf Uhr daheim gewesen und dann auch sofort eingeschlafen.
Aber vielleicht hatte Fee ihn noch gestern abend angerufen?
Lenchen hatte nichts gehört, wie er von ihr erfuhr, als er sie fragte.
So rief er dann im Sanatorium an, nachdem er geduscht hatte.
Am Apparat war Anne Fischer, die ihm aufgeregt erzählte, daß Mr. Docker am frühen Morgen einen Kreislaufkollaps bekommen hätte und die Arzte noch um ihn bemüht wären.
Er bat sie, Fee auszurichten, daß er angerufen hätte und daß er, wenn es irgend möglich zu machen wäre, am Wochenende kommen würde.
»Wissen Sie, daß Frau Guntram sich angemeldet hat?« fragte Anne.
Er hätte es gestern gehört, erwiderte Daniel zögernd.
Hoffentlich dachte Fee nun nicht, daß er Isabels wegen kommen würde.
Aber Anne Fischer war viel zu taktvoll, um es Fee so nebenbei zu sagen.
Fee kam wenig später vom Kliniktrakt herüber. »Wie spät ist es denn schon?« fragte sie.
»Dr. Norden hat vor einer halben Stunde angerufen«, erwiderte Anne behutsam. »Ich habe ihm gesagt, was mit Mr. Docker los ist.«
»Etwas besser geht es ihm schon«, sagte Fee. »Gott sei Dank. Er ist ja hergekommen, um sich zu erholen.«
»Er hat Raubbau mit seinen Kräften getrieben, und nun kommt die Reaktion«, sagte Anne. »Dr. Norden will am Wochenende kommen, wenn es ihm irgendwie möglich ist.«
»Isabel kommt ja auch« sagte Fee. »Weiß er es schon?«
»Darüber haben wir nicht gesprochen«, erwiderte Anne, sich schnell in die Notlüge flüchtend.
»Isabel wird es ihm sicher sagen«, erklärte Fee geistesabwesend. »Sag mal, Anne, kennst du den Namen Woldan?«
»Woldan?« wiederholte Anne fragend. »Ich glaube, die Besitzer von der Riefler-Alm heißen so. Wer hat denn neulich mal darüber gesprochen? War es nicht Herr Glimmer? Er hat doch immer Ausflüge ins Gebirge gemacht. Warum willst du es wissen, Fee?«
»Mr. Docker hat den Namen mehrmals erwähnt.«
»Er hat aber noch keinen Ausflug gemacht, seit er hier ist.«
»Aber er muß den Namen kennen«, sagte Fee. »Ich glaube, Paps macht sich auch Gedanken darüber.«
Dr. Cornelius machte sich nicht nur Gedanken, er hatte schon einen Entschluß gefaßt.
»Kommt ihr ein paar Stunden ohne mich zurecht, Fee?« fragte er beim Mittagessen.
»Das muß wohl möglich sein, sonst könnten wir unser Lehrgeld zurückzahlen«, erwiderte sie. »Mr. Docker ist jetzt doch außer Gefahr.«
»Er braucht absolute Ruhe. Achtet bitte darauf. Ist Post für ihn gekommen?«
Anne Fischer nickte. »Ein paar Briefe«, erwiderte sie.
»Die haltet ihr zurück. Wir wissen nicht, was darin steht, und jede Aufregung muß von ihm ferngehalten werden. Er darf das Bett auch nicht verlassen.«
»Ich glaube nicht, daß ihm danach zumute ist«, warf Dr. Schoeller ein.
»Was hast du denn vor, Paps?« fragte Fee.
»Ich habe etwas zu erledigen«, erwiderte Dr. Cornelius ausweichend.
*
Anne Fischer hatte so eine ferne Ahnung, als sich Dr. Cornelius in seinen Wagen setzte und davonfuhr. Sie behielt sie für sich.
Sie gönnte sich eine halbe Stunde Mittagspause und setzte sich zu ihrer Tochter Katja auf die Terrasse.
Katja war in träumerischer Stimmung. Ihre Gedanken bewegten sich in einer fernen Welt. Ihre Augen hatten einen entrückten Ausdruck.
Anne meinte, daß es nun an der Zeit wäre, Katja ernsthaft zu beschäftigen. Die schrecklichen Folgen des Lawinenunglücks hatte sie überwunden, und ihr Körper hatte sich soweit gekräftigt, daß sie leichte Gymnastik machen konnte. Wenn sie ging, sah man ihr nicht mehr an, daß sie mehrere Monate gelähmt an den Rollstuhl gefesselt gewesen war.
Ob sie jemals so beschwingt durch das Leben gehen würde wie andere Mädchen ihres Alters, blieb fraglich. Ihr Wesen war verinnerlicht. Manchmal fragte sich Anne auch voller Angst, ob Katjas Zuneigung, sie weigerte sich, es Liebe zu nennen, für David Delorme neuen Schmerz in das Leben ihres einzigen Kindes bringen würde.
»Wann kommt Isabel?« fragte Katja plötzlich.
»Morgen«, erwiderte Anne.
»Ich freue mich. Sie kommt so weit herum und kann so phantastisch erzählen. Ich höre ihr gern zu.«
»Wenn du dich langweilst, könntest du dich nützlich machen«, sagte Anne.
Katja sah sie irritiert an. Durch ihre Behinderung war sie gewohnt gewesen, daß sich alles um sie drehte und sich jeder um sie bemühte. Vor allem ihre Mutter. Ihre Worte trafen sie jetzt wie ein Vorwurf.
»Was soll ich denn tun, Mutti?« fragte sie.
»Etwas, was dir Freude macht und dich auf andere Gedanken bringt«, erwiderte Anne.
Katja stand auf. »Ich gehe zu Henriette und helfe ihr«, sagte sie.
Es klang nicht nachgiebig, sondern eher trotzig, aber Anne machte keinen Versuch, sie zurückzuhalten. Sie fühlte sich Dr. Cornelius zutiefst zu Dank verpflichtet, weil er nicht nur sie, sondern auch Katja aufgenommen hatte, aber es war ihr peinlich, daß Katja dies als ganz selbstverständlich zu betrachten schien und ganz ihren Neigungen lebte.
Leichte Schritte nahten. Fee erschien. »Nanu, Anne, was ist denn mit Katja los?« fragte sie.
»Ich habe eben gehört, wie sie zu Henriette sagte, daß sie sich eine Stellung suchen würde. Gefällt es ihr bei uns nicht mehr?«
»Ich habe ihr gesagt, daß sie sich nützlich machen könnte«, erwiderte Anne ruhig. »Sie geht wie eine Traumwandlerin durch den Tag, und ihre Gedanken wandern durch die Welt. Es geht doch nicht an, daß ihr uns beide durchfüttert.«
»Na, hör mal, du arbeitest doch wahrhaftig genug. Von Durchfüttern kann keine Rede sein. Gut, daß Paps es nicht hört. Und was Katja anbetrifft, sollte man ihr noch Zeit lassen.«
»Sie denkt nur an David«, sagte Anne leise. »Sie träumt davon, daß er kommen und sie mitnehmen wird. Sie stellt sich alles so wunderbar vor und ahnt gar nicht, welche Opfer der Gefährtin eines Künstlers abverlangt werden, wenn es dazu überhaupt käme.«
»Beschwer dir doch damit nicht den Kopf«, sagte Fee. »Du weißt doch, daß man seinem Schicksal nicht davonlaufen kann. Es läuft einem nach. Katja steht am Anfang eines neuen Lebens. Das alte ist unter der Lawine begraben, und es ist gut, daß sie darüber hinweggekommen ist. Laß ihr Zeit, sich in dem jetzigen Leben zurechtzufinden, und denke nicht solchen Unsinn. Du bist Paps doch unentbehrlich. Ich finde es wunderbar, daß er einen Menschen um sich hat, dem er so vertraut und mit dem er sich so gut versteht. Und ich habe dich sehr gern, das muß ich dir doch einmal sagen.«
»Du bist lieb, Fee«, flüsterte Anne.
»Du auch. So, jetzt muß ich wieder zu Mr. Docker.«
*
Indessen hatte Dr. Cornelius den Parkplatz unterhalb der Riefler-Alm erreicht. Eine gute halbe Stunde mußte er noch bergan steigen, aber es gefiel ihm, daß man nicht bis vor die Haustür fahren konnte, wie es bei Ausflugszielen allgemein üblich geworden war.
Hier brauchte man keine Autoabgase mehr aufzuschnaufen, hier war noch ganz herrliche Natur und urwüchsige Berglandschaft.
Ein munteres Bächlein sprang über die blankgewaschenen Steine, und die Vögel jubilierten.
Von weitem sah er schon die Riefler-Alm, das große Haus mit hellen Mauern und dunklem Holz, Blumenkästen auf dem Balkon und einer großen Terrasse.
Er wunderte sich, daß niemand zu sehen war, und kein einziger Wanderer war ihm begegnet.
Zwei kleine Buben in Lederhosen und karierten Hemden tauchten plötzlich hinter Latschen vor ihm auf. Die blonden Köpfe lugten aus dem tiefdunklen Grün heraus.
»Willst du auf die Alm?« fragte der größere, der etwa fünf Jahre sein mochte. »Es ist Ruhetag.«
Deswegen also war alles so leer, aber Dr. Cornelius konnte das nur willkommen sein, sofern die Besitzer anwesend waren.
»Wohnt ihr dort?« fragte er freundlich.
»Freili«, erwiderte der Bub. »I heiß Flori, und das ist der Hannes.«
»Das ist aber nett. Ich heiße auch Johannes«, erwiderte Dr. Cornelius.
»Und da kommt die Mami«, rief Flori.
Eine junge Frau im hellen Dirndl nahte. Ein wenig mißtrauisch fühlte sich Dr. Cornelius gemustert, aber ihre Züge hellten sich schnell auf.
Johannes Cornelius stellte sich vor, und da trat ein Staunen in ihre Augen. Ein Lächeln legte sich um den vollen Mund.
Trotz des Dirndlkleides wirkte sie exotisch. Ihr Haar war blauschwarz, und auch ihre Augen wirkten so, mandelförmig geschnitten, von einem Kranz dichter, langer Wimpern umgeben, in dem bräunlichen Gesicht.
»Ich bin Milli Woldan«, sagte sie in fremdländisch klingendem Deutsch. »Sie sind der Doc von der Insel. Wie sagen die Leute: Insel der Hoffnung.«
Dr. Cornelius nickte. Er konnte sich kaum konzentrieren. Seine Gedanken überstürzten sich.
»Wir haben von Ihnen gehört. Ins Tal kommen wir selten«, sagte die junge Frau. »Heute ist zwar Ruhetag, aber eine Brotzeit können Sie schon bei uns bekommen, Herr Doktor.«
Jetzt sagte sie Doktor, vorhin hatte sie Doc gesagt, wie es in Amerika üblich war.
»Sag dem Papi Bescheid, daß wir Besuch haben, Flori«, forderte sie den Jungen auf. »Mein Mann ist gerade bei den Kühen.«
Es klang mit dem Akzent alles drollig, und sie selbst war wie ein fremder Vogel, der sich hierher verirrt hatte und doch heimisch geworden war.
Ihre Bewegungen waren flink und anmutig. Der Kleine folgte ihr auf Schritt und Tritt. Nur wenige Minuten hatte Dr. Cornelius Zeit zur Besinnung, als auch schon eine große Holzplatte mit köstlichem Schinken, Eiern und Gurken vor ihn hingestellt wurde, serviert von der Hausfrau persönlich, und bald darauf kam auch der Hausherr in Bundhosen und ebenfalls kariertem Hemd wie seine Söhne.
Er war groß und breitschultrig, hatte ein wettergegerbtes, flächiges Gesicht, helle Augen und strohblondes Haar. Er hieß Dr. Cornelius herzlich willkommen und servierte ihm zur Begrüßung einen aromatischen Enzianschnaps.
»Ich muß noch Auto fahren«, sagte Dr. Cornelius lächelnd.
»Bis Sie drunten sind, hat er sich schon verflüchtigt«, sagte Robert Woldan, der von seiner Frau Bob genannt wurde.
Dr. Cornelius erinnerte sich gar nicht gern daran, daß seine Anwesenheit einen triftigen Grund hatte. Er überlegte angestrengt, wie diese beiden Menschen eine Einmischung in sehr persönliche Dinge verstehen würden, nachdem ihm nun auch der Mann versichert hatte, wie sehr sie sich freuten, seine Bekanntschaft zu machen.
Die beiden Buben wurden auch schon zutraulicher. Sie wichen nicht vom Tisch, und in ihre Ohren hinein wollte Dr. Cornelius nicht sagen, was er auf dem Herzen hatte.
»Schön haben Sie es hier«, sagte er, »wunderschön.«
»Was für Sie die Insel ist, ist für uns die Alm, nicht wahr, Mildred?« meinte Bob Woldan.
Mildred hieß sie also, Milli hatte sie sich selbst genannt.
»Ich hoffe sehr, daß Sie uns auch einmal besuchen«, sagte Dr. Cornelius.
»Es ist schon viel Betrieb drunten, haben wir gehört«, sagte Bob.
»Geruhsamer Betrieb. Wir haben eine ganze Anzahl Patienten, aber sie verlaufen sich auf der Insel. Es ist nicht wie in einem Hotel. Sie werden manchmal auch viele Gäste haben.«
»Am Wochenende schon und im Sommer auch unter der Woche. Das ist dann ganz nett«, sagte Bob, »aber wir freuen uns auch, wenn dann wieder Ruhe herrscht. Wir haben uns dieses Leben gewünscht.«
»Und wir sind zufrieden«, sagte Mildred.
Sie waren aus einer anderen Welt, in der man sie nicht zufrieden ließ, geflohen, das konnte sich Dr. Cornelius nun schon zusammenreimen, obgleich er bis zu dieser Stunde nur Vermutungen gehegt hatte. Es war wirklich schön hier, aber er konnte nicht ewig bleiben, und er wollte auch nicht unverrichteterdinge gehen.
»Würden Sie bitte gestatten, daß ich mich ein paar Minuten mit Ihrem Mann allein unterhalte, Frau Woldan?« fragte Dr. Cornelius.
Sie war leicht verwirrt, nickte dann aber. »Ich würde mir gern die obere Alm ansehen«, sagte Dr. Cornelius leicht verlegen.
Mildred und Bob tauschten einen bedeutsamen Blick.
»Zum Verkauf steht hier nichts«, sagte Bob reserviert.
»Darum handelt es sich nicht«, sagte Dr. Cornelius. »Worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, ist nicht für Kinderohren bestimmt«, fügte er rasch hinzu, als die beiden Buben jetzt zu einem Wagen liefen, vor den ein Maulesel gespannt war, der von einem alten Mann geführt wurde.
Mit dem Ausruf: »Der Bastian kommt«, waren sie davongelaufen.
»Die Buben sind jetzt untergebracht«, sagte Bob Woldan. »Sie brauchen den beschwerlichen Weg nach droben nicht zu machen, Dr. Cornelius. Was gibt es denn Wichtiges? Worum handelt es sich?«
»Um einen Patienten namens William Docker«, sagte Dr. Cornelius rasch.
Er sah in zwei versteinerte Gesichter. »Er ist Patient bei Ihnen?« fragte Bob Woldan dann heiser.
»Und er hatte einen schweren Kreislaufkollaps. Ich nehme an, daß er nicht nur in diese Gegend kam, um eine Kur zu machen. Er hält sich ja für kerngesund, was durch die jüngsten Ereignisse jedoch widerlegt wurde. Er wollte seine Schlaflosigkeit bei uns auskurieren. Vielleicht wissen Sie den Grund für diese Schlaflosigkeit.«
»Was wissen Sie?« fragte Bob Woldan vorsichtig.
»Ich vermute nur und kombiniere. Er hat den Namen Woldan ein paarmal gemurmelt, als er halb bewußtlos war. Docker und Woldan haben keine Ähnlichkeit miteinander, aber Sie, Herr Woldan, haben eine unübersehbare Ähnlichkeit mit Mr. Docker. Sie sind sein Sohn, nicht wahr?«
»Ich war es«, stieß Bob zwischen den Zähnen hervor. »Es führt kein Weg zurück.«
»Sei nicht so hart, Bob«, sagte Mildred in englischer Sprache, in einem sehr guten Englisch ohne amerikanischem Akzent. »Was soll Dr. Cornelius denken?«
»Er kann gut kombinieren«, sagte Bob. »Und vielleicht weiß er mehr, als er zugeben will.«
»Mr. Docker ist ein kranker Mann, und er plagt sich mit seinem Gewissen«, sagte Dr. Cornelius.
»Mein Vater hat nie etwas im Leben bereut«, sagte Bob hart. »Er denkt in Zahlen. Er hat keine Gefühle.«
»Bob, ich bitte dich«, sagte Mildred.
»Du hast schon gar keinen Grund, einzulenken, Darling«, sagte Bob und streichelte zärtlich ihre Hand. »Dr. Cornelius, ich liebe meine Frau über alles. Mein Vater wollte das nicht verstehen. Weil Mildred sich ihren Lebensunterhalt in einer Bar verdienen mußte, hat er sie in eine Kategorie von Frauen eingeordnet, zu der sie nie gehört hat. Ich traf meine Entscheidung. Ich weiß, wohin ich gehöre. Wir sind glücklich und werden uns unser Glück nicht zerstören lassen.«
»Vielleicht will er gutmachen, nicht zerstören«, sagte Dr. Cornelius.
»Vielleicht will er das, Bob«, sagte auch Mildred. »Man soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten.«
»Soll ich zu ihm hingehen?« fragte Bob. »Nein, wenn er guten Willens ist, muß er den ersten Schritt tun. Das ist mein letztes Wort. Es tut mir leid, Dr. Cornelius. Ich habe Respekt vor Ihrer Tätigkeit. Sie wollen allen Menschen helfen. Meinem Vater werden Sie nicht helfen können. Er sitzt auf einem Thron. Er hat sich selbst darauf gesetzt. Er, nur er allein kann sich helfen, niemand sonst. Woldan ist übrigens der Mädchenname meiner Mutter. Sie hat hier gelebt. Ihrer Mutter gehörte diese Alm einmal. Für uns ist sie zur Heimat geworden. Auch für Mildred. Was heute daraus geworden ist, habe ich nur meiner Frau zu verdanken. Ich wurde nur zum Erben erzogen, zum Befehlen. Es hat mir nie gefallen. Hier befiehlt jedenfalls Mildred.«
»Er übertreibt, Dr. Cornelius«, sagte Mildred. »Er meint, alles gutmachen zu müssen, was Mr. Dockers Starrsinn uns versagen wollte.«
»Und wenn er doch den ersten Schritt tut?« fragte Dr. Cornelius leise.
»Er tut ihn aber nicht. Sie werden ihn noch kennenlernen«, sagte Bob. »Er müßte eine halbe Stunde bergan steigen, und das ist ihm zu mühsam. Er ist es gewohnt, bis vor jede Tür gefahren zu werden und daß ein roter Teppich unter seine Füße gebreitet wird. Er ist der King.«
Seine Worte klangen unversöhnlich. Dr. Cornelius fing einen bittenden Blick von Mildred auf.
Er erhob sich. »Ich muß jetzt wieder heim«, sagte er. »Ich wollte Sie nicht umstimmen. Es ist sinnlos, Menschen zu etwas überreden zu wollen, gegen das sich ihr Innerstes sträubt. Vielleicht kennen Sie Ihren Vater sogar besser als ich, Herr Woldan. Ich hätte mich wohl mehr mit ihm beschäftigen müssen, als mich spontan zu diesem Besuch zu entschließen.«
»Sie haben es gut gemeint«, warf Mildred ein.
Die Buben kamen wieder herbei. »Warum will der nette Herr schon gehen?« fragte Flori.
»Ich muß wieder heim«, erwiderte Dr. Cornelius.
»Kommst mal wieder?« fragte Flori.
»Das kann schon sein, wenn ich willkommen bin.«
»Sie sind immer willkommen, Dr. Cornelius«, sagte Mildred.
»Vielleicht geben Sie mir später doch mal die Möglichkeit, Ihre Gastfreundschaft zu erwidern«, sagte Dr. Cornelius. »Es würde mich freuen.«
*
»Was haben Sie mit mir gemacht«, polterte William Docker los, als Dr. Cornelius sein Appartement betrat.
»Was haben Sie mit sich oder aus sich selbst gemacht?« fragte der Arzt nachdenklich.
»So was ist mir noch nie passiert. Hier, ausgerechnet hier muß es geschehen.«
»Irgendwann wäre es überall geschehen«, erklärte Dr. Cornelius gelassen. »Ich bin gern bereit, Ihnen die Untersuchungsbefunde genau zu erklären. Aber Sie sind ja noch einmal davongekommen. Ärzte waren gleich zur Stelle. Erinnern Sie sich bitte, wie es angefangen hat.«
»Ich habe keine Luft mehr bekommen«, brummte William Docker. »Das Klima bekommt mir doch nicht.«
»Dann fahren Sie zurück in die Staaten, und machen Sie weiter so wie bisher«, sagte Dr. Cornelius. »Oder gehen Sie zu einem andern Arzt.«
»Reden Sie mit allen Ihren Patienten so?« fragte William Docker aggressiv.
»Mit jedem so, wie er es am besten versteht«, erwiderte Dr. Cornelius.
»Habe ich phantasiert?« fragte Docker nach einer kleinen Pause.
»Auch das.«
»Was habe ich gesagt?«
»Zusammenhanglose Worte. Wenn Sie meine Anordnungen jetzt strikt befolgen, werden Sie in ein paar Tagen auf den Beinen sein.«
»Oder tot, wenn ich nichts zu essen bekomme«, knurrte der andere.
»Sie werden zu essen bekommen, aber den Whisky lassen Sie gefälligst im Schrank.«
William Docker kniff die Augen zusammen. »Sie sind ein Tyrann«, sagte er.
»Sie auch«, gab Dr. Cornelius schlagfertig zurück.
Damit erschöpfte sich die Unterhaltung. William Docker sank in die Kissen zurück und schloß die Augen.
»Wie war er während meiner Abwesenheit?« fragte Dr. Cornelius seine Tochter.
»Zu mir war er eigentlich sehr nett«, erwiderte sie. »Er hat mich gefragt, ob ich die Umgebung gut kenne.«
»Hat er nach einem bestimmten Ort gefragt?«
»Nein, wieso, Paps?« fragte Fee.
»Darüber möchte ich jetzt noch nicht sprechen«, erwiderte Johannes Cornelius.
Für Fee war der Fall damit abgetan. Es gab öfter Dinge, über die ihr Vater nicht sprechen wollte. Das war keine Geheimniskrämerei, sondern einfach Prinzip.
»Vielleicht kommt Daniel morgen«, sagte sie.
»Na, da freut sich aber jemand«, sagte er weich.
»Du doch auch«, gab sie lächelnd zurück.
*
»Na, Molly, wie ist es?« fragte Dr. Norden. »Wollen Sie morgen nicht mitkommen und Ihren Mann besuchen?«
»Nein, er soll erst mit sich selbst ins reine kommen«, erklärte Molly. »Wir fahren morgen hinaus zu meinen Eltern, allerdings ohne Sabine. Sie hat etwas anderes vor.«
»Er heißt Uwe Winter, ist Lokalreporter und ein netter Junge«, sagte Daniel. »Das wollte ich Ihnen schon gestern sagen. Ich habe es vergessen.«
»Warum hat Sabine dann noch nicht von ihm gesprochen?« fragte Helga Moll.
»Vielleicht geniert sie sich ein bißchen, daß sie den Freund so schnell gewechselt hat«, meinte Daniel. »Sie ist jung, Molly. Vielleicht wird es nicht der letzte Freund sein.«
»Na, so erbaut bin ich nicht von ständigem Wechsel«, sagte sie.
»Vertrauen Sie ihr denn nicht?«
»Vertrauen ist gut, Wissen ist besser«, meinte sie trocken. »Na, ich will es nicht zu tragisch nehmen. Sabine weiß, was sie will.«
»Und wie geht es Peter jetzt in der Schule?« fragte Daniel.
»Keine Klagen.«
»Dann wünsche ich Ihnen ein geruhsames Wochenende«, sagte Daniel.
»Ich Ihnen auch.«
Sie konnte gehen. Er hatte noch einiges zu tun. Einige Patienten hätten es ihm sehr verübelt, wenn er ihnen nicht Bescheid gesagt hätte, daß er am Wochenende auswärts war.
Karl Kürten wollte er noch besuchen. Bei ihm traf er Frau Kürten an. Als er ihnen sagte, daß er das Wochenende auf der Insel der Hoffnung verbringen würde, sagte Karl Kürten, daß er ihm gleich ein Zimmer reservieren sollte, damit seine beiden Damen endlich Ruhe gäben. Außerdem könnte er jetzt beruhigt wegfahren, da Astrid ihn voll ersetzen würde.
»Sie haben ihr ganz schön das Rückgrat gestärkt«, warf Frau Kürten ein.
»Ich doch nicht«, widersprach Daniel.
»Dann war es Fräulein Dr. Cornelius«, sagte Karl Kürten.
»Vielleicht auch ein Fräulein Friedinger, wenn auch unbeabsichtigt«, erklärte Daniel.
Dann kam die Schwester mit dem Abendessen, und Daniel verabschiedete sich.
»Was mag er damit gemeint haben?« fragte Karl Kürten seine Frau.
»Er weiß, daß Lilly alles daran gesetzt hat, um Astrid Wolfgang wegzuschnappen.«
»Dieses hinterlistige kleine Biest«, brummte er. »Aber warum soll er jetzt nicht ein bißchen zappeln? Astrid hat allerhand gelernt. Sie soll nur ja nicht auf den Gedanken kommen, ihn wegzuekeln aus ihrem gekränkten Stolz heraus.«
»Was er dir wert ist, weiß ich ja«, sagte Melanie Kürten nachsichtig. »Und ihr hat eine kleine Aufmunterungsspritze gutgetan.«
»Ich möchte, daß sie glücklich wird«, sagte Karl Kürten. »Das ist mein größter Wunsch.«
*
Doch davon, glücklich zu sein, war Astrid augenblicklich weit entfernt. Zwischen sechzehn und achtzehn Uhr hatte Wolfgang immer frei. Irgendwann mußte er einmal Zeit für sich haben, das hätte Astrid durchaus eingesehen, wenn er diese Zeit nicht mit Lilly verbracht hätte. Aber zufällig hatte sie ihn mit ihr gesehen, als sie zum Hotel fuhr.
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
Wie traf es auf ihn zu und auch auf sie. Astrid hatte nur keine Ahnung, daß bei Wolfgang zu der Eifersucht auch noch ein unheiliger Zorn auf Lilly kam.
Ihre dauernden Anrufe waren ihm nicht nur lästig, sondern er fürchtete auch, daß Astrid davon wußte und ihn als Heuchler einschätzte. Er wollte endlich und endgültig klaren Tisch machen.
Lilly dagegen fühlte sich siegessicher, als er das Treffen vorgeschlagen hatte, aber ihr triumphierendes Lächeln erlosch rasch, als er so abweisend war.
Er hielt sich nicht lange bei der Vorrede auf. »Wir wollen einmal klarstellen, was an jenem Abend geschehen ist«, begann er ohne Umschweife. »Wir wollten mit Astrid ins Kino gehen. Du kamst allein und sagtest, daß sie keine Lust hätte.«
»Hatte sie auch nicht.«
»Wir sind nicht ins Kino gegangen, sondern in eine Bar, weil dir plötzlich nach Tanzen zumute war. Und ich habe mitgemacht, weil ich mich geärgert hatte, daß Astrid nicht mitgekommen war.«
»Sieh einer an«, sagte Lilly. »Was du nicht sagst.«
»Ja, so war es. Und du wußtest genau, wie sehr ich Astrid mag.«
»Ihr Geld«, sagte sie schrill.
»Nein, nicht ihr Geld, sondern sie selbst. Aber du hast ja so lange auf mich eingeredet, daß sie ganz andere Pläne hätte, daß ich mich ins Bockshorn jagen ließ. Nur habe ich deine Absichten nicht durchschaut, Lilly.«
»Du hast dich immerhin mit mir getröstet«, stieß sie hervor, »aber ein Lückenbüßer bin ich nicht.«
»Aber verlobt habe ich mich nicht mit dir, und ich finde es schäbig, daß du dies zu Astrid gesagt hast, nachdem ich dir doch mitgeteilt hatte, daß ihr Vater plötzlich so schwer erkrankt war. Du hast die Situation schamlos ausgenutzt für deine Zwecke, weil du genau weißt, wie leicht verletzlich sie ist und wie tief es sie treffen mußte, diese Nachricht in einem solchen Augenblick zu erfahren. Immerhin hast du erreicht, daß sie eine Mauer zwischen uns gesetzt hat, aber auch, daß ich dich endlich durchschaute. Wohl auch, daß auch Astrid dich durchschaute. Ich habe mit ihrem Vater ganz offen gesprochen.«
»Obwohl er so schwer krank ist?« fragte sie anzüglich.
»Er hat dieses Gespräch herausgefordert. Er befindet sich glücklicherweise auf dem Wege der Besserung. Ich habe ihm angeboten, meine Stellung aufzugeben.«
»Du hast es ihm angeboten?« fragte sie bestürzt. »Und er hat es angenommen?«
»Er hat gesagt, daß er mir nichts in den Weg legen wird. Und er hat mir auch deutlich zu verstehen gegeben, daß unser Vertrag ohnehin gelöst werden würde, wenn ich dich heiraten würde.«
»Dieser arrogante Bursche«, sagte sie wütend.
»Du hast kein Recht, so zu sprechen, Lilly. Du hast so viele Vorteile durch Astrid gehabt. Sie hätte dich niemals hintergangen. Sie hat dir wahre Freundschaft entgegengebracht, die du ihr schlecht lohntest.«
»Steig herab von deinem hohen Roß«, sagte Lilly scharf. »Dir ist doch auch der Weg geebnet worden, weil du es verstanden hast, dich Liebkind zu machen. Was wirst du sein ohne Karl Kürten im Rücken? Ein kleiner Niemand, der sich wieder heraufdienen muß.«
»Und um den es sich nicht lohnt, diese Tragikomödie weiterzuführen«, sagte er ruhig. »Hoffentlich ist dir das klar.«
Sie schnippte mit den Fingern. »Mir ist die ganze Sache zu dumm«, sagte sie. »Schade um die Zeit, die ich deinetwegen vergeudet habe.«
Man lernt doch nie aus, dachte Wolfgang, als er zum Hotel fuhr. Er war so felsenfest überzeugt gewesen, daß eine echte Freundschaft die beiden ungleichen Mädchen verband, und oft genug hatte er sich als den Dritten im Bunde bezeichnet.
Jetzt blieb ihm nur noch übrig, die Konsequenzen zu ziehen.
*
Pünktlich ist er wenigstens, dachte Astrid, als sie ihn die Hotelhalle betreten sah. Sie unterhielt sich mit ein paar Gästen, die gerade erst eingetroffen waren, und schenkte ihm keine Beachtung.
Vielleicht habe ich viel zuviel in ihn hineingedacht, ging es ihr durch den Sinn, als sie sich dann an den Schreibtisch setzte, um die Tagesabrechnung des vergangenen Tages nachzukontrollieren. Darauf legte ihr Vater den größten Wert. Alles mußte korrekt sein.
Aber an allem, was unter Wolfgangs Aufsicht stand, gab es nichts auszusetzen.
Sie traf dann erst mit ihm zusammen, als sie heimfahren wollte. Es war fast Mitternacht. Im Clubzimmer tagte noch immer eine fröhliche Gesellschaft. Wolfgang sah müde aus. Astrid dachte daran, daß er, die zwei Stunden Pause abgerechnet, schon gut sechzehn Stunden auf den Beinen war, denn heute hatte sein Arbeitstag schon um sechs Uhr begonnen, weil Lieferungen gekommen waren, die er stets selbst kontrollierte. Welcher Angestellte machte das heute schon?
»Ich gehe jetzt«, sagte sie zu ihm. »Wird es da noch lange dauern?« Sie deutete auf das Clubzimmer.
»Der Oberkellner kassiert bereits«, sagte er.
»Dann gute Nacht«, sagte sie.
»Gute Nacht«, erwiderte er.
Sie ging hinaus. Sie war auch müde und außerdem deprimiert. Und ausgerechnet heute wollte ihr Wagen nicht anspringen. Sie versuchte es mehrmals, aber er rührte sich nicht.
Die Mitglieder des Kegelklubs strömten jetzt aus dem Hotel. Singend zogen sie an ihr vorbei, als sie wieder hineinging, um nach einem Taxi zu telefonieren.
Da wird es morgen wieder Beschwerden hageln, dachte sie, und da stand Wolfgang an der Treppe. Sein Blick, der voller Kummer war, verwirrte sie.
»Ich muß ein Taxi rufen. Mein Wagen springt nicht an«, sagte sie stockend.
»Darf ich Sie heimbringen, Astrid?« fragte er.
Ihr Herz begann zu hämmern. Sie wollte widersprechen, aber plötzlich war sie wieder das scheue kleine Mädchen.
»Sie haben ja den gleichen Weg«, sagte sie tonlos.
Er hatte schon Jahr und Tag den gleichen Wagen, aber er ließ ihn nie im Stich. Wert auf Äußerlichkeiten legte er nicht.
Für ihn war ein Auto nur ein Fortbewegungsmittel. Renommieren lag ihm auch nicht. Das alles ging Astrid durch den Sinn, als sie durch die stillen Straßen fuhren, schweigend, mit jener Mauer zwischen sich, die sie aufgerichtet hatte.
»Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der wir uns duzten, wenn wir allein waren, Astrid«, sagte er plötzlich. »Ist sie für immer vorbei?«
»Ist es nicht besser so?« fragte sie.
»Es tut mir weh«, erwiderte er gepreßt. »Ich habe Lilly heute getroffen und ihr gesagt, was ich von ihrem Benehmen halte. Sie ist nicht mehr interessiert, dieses widerwärtige Spiel fortzuführen.«
»Dieses widerwärtige Spiel?« wiederholte Astrid tonlos.
»Mehr war es nicht. Bitte, glaube es mir, Astrid. Selbst wenn du dich jetzt Dr. Norden zugewendet hast, möchte ich, daß du die Wahrheit weißt. Du bist mir zu wertvoll, als daß ich deine Freundschaft verlieren möchte.«
»Waren wir jemals Freunde?« fragte Astrid leise. »Ich war ein sehr dummes, sehr törichtes Mädchen. Ich habe zehn Jahre mit Lilly die gleiche Schulbank gedrückt. Ich dachte, daß die Jahre zählen müßten. Du und ich, wir haben uns sehr lange gekannt. Für meinen Vater warst du wie ein Sohn, Wolfgang. Ich möchte nicht schuld sein, wenn das anders würde, aber jetzt bin ich kein törichtes Mädchen mehr. Ich habe gelernt, die Spreu vom Weizen zu scheiden.«
Ein paar Sekunden war Schweigen zwischen ihnen.
»Könnte dir dabei nicht auch ein Fehler unterlaufen sein, Astrid?« fragte er.
»Wie meinst du das?« fragte Astrid.
»Ich meine Dr. Norden. Bist du überzeugt, daß du die einzige Frau in seinem Leben bist?«
Ein Lachen stieg ihr plötzlich in die Kehle, aber sie unterdrückte es.
»Meinst du, daß ich so begehrenswert bin?« fragte sie ironisch.
»Ja, das meine ich«, erwiderte er. »Mädchen wie dich findet man selten. Und es ist sehr schlimm, wenn man sie wieder verliert.«
Astrid nahm ihren ganzen Mut zusammen. »Halt mal an, Wolf«, sagte sie, »wir sind nämlich gleich zu Hause, und jetzt wird das Thema interessant.«
War sie es selbst, die das sagte? Hatte sie wirklich den Mut dazu?
Ich bin eine Frau, sagte sie sich. Im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel recht, hieß es. Die Waffen einer Frau hätten mit Krieg nichts zu schaffen, hatte ihr Vater heute so ganz nebenbei gesagt, als sie ihn besuchte. Wußte er, was da vor sich ging?
Wolfgang hatte angehalten. Astrid rückte noch ein Stück weiter von ihm weg, was er schmerzhaft empfand.
»Du meinst also, daß Dr. Norden ernsthaftes Interesse für mich hätte?« fragte sie.
»Was sollte ich sonst denken?« fragte er. »Ihr habt euch jeden Mittag getroffen, und ihr habt gemeinsam gegessen.«
»Zweimal haben wir uns getroffen und einmal gemeinsam gegessen. Er ist ein attraktiver Mann.«
»Das begreife ich nicht, aber ich habe ihn schon mit einer sehr attraktiven Frau gesehen, und er hat sie geküßt!«
»Was du nicht sagst, ich bin erschüttert«, spottete Astrid. »So könnte ein eifersüchtiger Mann sprechen.«
»Ich bin eifersüchtig«, stieß er hervor. »Du hast dich von Lilly irremachen lassen.«
Der Teufel mochte in Astrid gefahren sein. Sie kannte sich selbst nicht wieder.
»Ich finde Dr. Norden sehr charmant«, sagte sie, »aber mit seiner zukünftigen Frau kann ich wohl kaum konkurrieren. Ich kenne meine Grenzen, Wolf, und ich kenne auch Fee Cornelius. Wahrscheinlich hat er sie geküßt, als du ihn beobachtet hast.«
»Ich sah es zufällig«, rechtfertigte er sich. »Dir macht es nichts aus?«
»Nein, es macht mir nichts aus. Ich kenne sie zwar beide noch nicht lange, aber ich glaube, daß ich ihnen mehr vertrauen kann als manchem andern.«
»Es trifft mich sehr, daß ich dein Vertrauen verloren habe, Astrid«, sagte Wolfgang leise.
Und dann trafen sich ihre Augen doch, versanken ineinander, und alles andere wurde nebensächlich.
»Ich liebe dich doch«, flüsterte er.
Und sie glaubte ihm, so voller Angst, wie er es sagte.
Sie überließ ihm ihre Hände, ließ sich an seine Brust ziehen und barg ihren Kopf an seiner Schulter.
»Ich wagte es nicht zu sagen, Astrid«, raunte er ihr ins Ohr. »Du erschienst mir noch so jung, und dann warst du so schnell, so plötzlich erwachsen.«
»Ich bin erst dabei, es zu werden, aber vielleicht war es gut, daß ich einen Schock bekam, sonst wäre ich womöglich noch lange in den Kinderschuhen steckengeblieben. Ich habe Lilly alles geglaubt, Wolf. Jetzt ist es mir unbegreiflich. Ich hätte nicht einfach klein beigeben dürfen. Man muß auch zu kämpfen verstehen.«
Ihr war es nicht bewußt, wie sie es verstanden hatte. Mit ihren Waffen, die frei von Gift waren, zu denen sie ganz instinktiv gegriffen hatte, als alles ins Wanken geriet, was sie wünschte.
Und nun war alles gut. Wolfgang nahm sie in seine Arme, und zum ersten Mal küßte er sie heiß und innig.
»Nichts mehr steht zwischen uns«, flüsterte er zwischen zwei Küssen. »Ich bin glücklich, Astrid, mein Liebes. Wirst du jetzt mit mir gehen, wohin uns der Weg auch führt?«
»Du, wach auf«, sagte sie plötzlich ganz gegenwärtig. »Willst du Paps etwa im Stich lassen und alles, was uns doch so viel bedeutet?«
»Nur du bedeutest mir alles«, sagte Wolfgang leise.
»Dann mußt du das übrige aber auch mit in Kauf nehmen«, sagte Astrid. »Paps braucht eine Kur. Wir wollen ihn ja noch recht lange behalten, und ich brauche dich, Wolf.«
»Und wenn dann Lilly zu dir kommt und sagt, ich würde dich ja doch nur heiraten, weil du die Tochter deines Vaters bist?« fragte er.
»Was meinst du wohl, was ich erwidern werde?«
»Sag es. Ich will es wissen, aber es muß die Wahrheit sein.«
»Einer Lügnerin mit der blanken Wahrheit begegnen? Ich werde sagen: Und wenn schon, wenigstens hast du ihn nicht gekriegt«, erwiderte Astrid lachend. Und dann umarmte sie ihn stürmisch.
»Du könntest auch sagen, daß du es von Anfang an gewußt hättest, daß ich nur dich liebe«, sagte Wolfgang leise.
»Aber das wußte ich nicht«, sagte Astrid. »Es wäre eine glatte Lüge. Wie hätte ich glauben können, daß du mich liebst?«
»Glauben nicht, fühlen«, erwiderte er. Astrid lächelte schelmisch, und das stand ihr ganz besonders gut.
»Mein Gefühl war anscheinend total verkümmert«, sagte sie mit einem tiefen Seufzer. Aber dann richteten sich ihre Augen strahlend auf ihn. »Oder sagen wir doch lieber, es hatte sich eingeschlossen in eine Kammer, die ganz plötzlich auseinandergesprengt wurde, als ich meinen ersten Kuß bekam.«
»Hat Dr. Norden dich nie geküßt?« fragte Wolfgang.
»Du liebe Güte, ich dachte immer, die Männer wüßten es gleich, wenn sie ein Mädchen im Arm halten, das noch nie geküßt worden ist«, seufzte Astrid.
»Ich kann es nicht glauben«, murmelte Wolfgang. »Vielleicht fehlt es mir auch noch an der nötigen Erfahrung.«
»Nachdem du beinahe verlobt warst mit Lilly?« neckte sie ihn.
»Ich war an diesem Abend nur gekränkt, weil du nicht mitgekommen warst.«
»Nicht mitgekommen? Du hattest doch angeblich keine Zeit.«
»Diese Schlange«, sagte Wolfgang zornig.
»Aber sie wird uns nicht mehr aus dem Paradies vertreiben können«, flüsterte Astrid. »Jetzt nicht mehr.« Und dann küßten sie sich wieder.
*
Daniel hätte Fee eine zusätzliche Freude machen können, wenn er das schon gewußt hätte, aber sie dachten vorerst doch nur an sich selbst, als sie sich in die Arme sinken konnten.
»Mir ist es, als hätten wir uns schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen«, sagt Daniel zärtlich. »Mein geliebtes kleines Mädchen.«
So sah Fee auch aus, als seine Hände ihr Gesicht umschlossen. So viel Glück war in ihr, daß es nicht in Worte zu fassen war. Und heute brachte Daniel ihr einen riesengroßen Strauß blutroter Rosen mit und dazu noch etwas.
»Schließ die Augen«, flüsterte er, als er ihre Hand ergriff. Dann fühlte sie, daß er einen Ring über ihren Finger streifte, und als sie die Augen öffnete, blinkte der schmale Brillantreif an ihrer Hand.
»Daß du es ja nie vergißt, zu wem du gehörst«, sagte Daniel.
»Wie könnte ich das vergessen«, sagte Fee innig.
»Es ist dein Verlobungsring«, sagte er.
»Ich werde heute deinen Vater in aller Form um deine Hand bitten.«
»In aller Form?« fragte sie schelmisch.
»Johannes und ich sind zwar gute Freunde, aber gewisse Augenblicke verlangen ihren Tribut. Mir wird es nicht schwerfallen, deinem Vater zu sagen, daß ich dich lieben werde, bis daß der Tod uns scheidet, Feelein.«
»Sprich nicht vom Tod, Daniel«, sagte sie. »Sprich bitte nur vom Leben. Was ist mein Leben ohne dich?«
So feierlich war es ihnen zumute, als ständen sie bereits vor dem Altar. Und eigentlich hätte es gar keiner Worte bedurft, als Johannes Cornelius ihnen die Haustür öffnete, aber für Daniel waren es mehr als Worte. Es war das Versprechen, das er dem Mann gab, der der beste Freund seines Vaters gewesen war, seine Tochter zu einer glücklichen Frau machen zu wollen.
»Und wann wollt ihr heiraten?« fragte Johannes Cornelius, sich mit einem Lächeln über seine tiefe Rührung hinwegrettend.
Daniel und Fee sahen sich an. »Ich würde vorschlagen im Oktober«, erwiderte Daniel.
»Und dann?« fragte Dr. Cornelius.
»Dann kommt der Winter, und du wirst mit Dr. Schoeller sicher allein zurechtkommen«. sagte Daniel. »Was meinst du, Fee?«
»Wir werden alles durchdenken«, sagte sie. »Und auch kalkulieren, Paps. Erst mal abwarten, ob uns die Saison einen Gewinn gebracht hat.«
Dr. Cornelius lächelte. »Ihr versteht es, Gefühle und Verstand unter einen Hut zu bringen«, sagte er.
»Schließlich müssen wir ja auch an unsere Kinder denken, Paps«, sagte Fee. Und da nahm Daniel sie wieder in die Arme, und Dr. Cornelius fühlte sich überflüssig. Er verschwand lautlos.
*
Dr. Cornelius pfiff fröhlich vor sich hin, als er durch den Park ging. Und dann hätte er fast einen schrillen Pfiff ausgestoßen, denn vor dem Verwaltungsgebäude hatte ein Jeep gehalten, dem Mildred Woldan und die beiden Jungen entstiegen.
Sie trug heute ein schlichtes dunkelgrünes Trachtenkostüm, das ihr aber ebensogut zu Gesicht stand wie das Dirndl.
»Mein Mann hat in der Stadt zu tun«, sagte sie, »da dachte ich, wir könnten Ihnen schnell einen Besuch abstatten, Dr. Cornelius.«
»Weiß Ihr Mann davon?« fragte er leise.
Sie schüttelte den Kopf. »Er ist mit seinem Wagen gefahren. Viel Zeit hab’ ich nicht. Bei uns geht der Trubel bald los. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es Mr. Docker geht.«
Und dazu hat sie die Kinder mitgebracht? überlegte Johannes Cornelius rasch.
Ob sie seine Gedanken erraten konnte? »Flori und Hannes sind samstags immer bei Bekannten im Dorf«, sagte Mildred verlegen. »Ich kann nicht auf sie achtgeben, wenn bei uns solch Trubel herrscht. Sie wollten die Insel so gern einmal sehen.«
»Und wie wäre es, wenn Sie die beiden hierlassen würden, anstatt sie zu den Bekannten zu bringen?« fragte er.
Wie sie sich verstanden. Mildred schenkte ihm einen dankbaren Blick.
»Ich weiß ja nicht, ob Mr. Docker Kinder überhaupt mag«, sagte sie leise. »Die Kleinen sollen herausgehalten werden aus diesem Wirrwarr. Wenn ein Weg zusammenführen kann, dann nur über die Kinder, Dr. Cornelius. Verstehen Sie mich?«
Und ob er sie verstand! »Kennt Mr. Docker Sie überhaupt persönlich?« fragte er Mildred.
»Gott bewahre«, rief sie aus.
»Da hat er aber viel versäumt, und das wird er noch schwer bereuen«, sagte Johannes Cornelius.
»Meinen Sie?« fragte Mildred.
»Da bin ich ziemlich sicher. Er wird auf der Terrasse sitzen. Überlassen Sie alles mir, Frau Woldan, sofern die Buben bleiben wollen.«
»Oh, da ist mir nicht bange«, sagte sie. »Sie sind sehr unternehmungslustig. Aber ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll.«
»Auf jeden Fall werden Sie die Kinder wohlbehalten zurückbekommen«, sagte Dr. Cornelius.
»Und Sie verstehen mich richtig? Ich denke nicht an Mr. Dockers Geld. Ich denke nur an einen alten Mann, der krank ist.«
»Und genauso habe ich es verstanden«, sagte Dr. Cornelius.
*
Flori und Hannes waren begeistert, daß sie hierbleiben durften. Für sie war das ein Erlebnis. Von Henriette Seidel bekamen sie erst mal Schokoladenpudding, mit Katja spielten sie Verstecken.
Von dem Kinderlachen angelockt, kamen Daniel und Fee.
»Zu wem gehören sie?« fragte Fee ihren Vater.
»In erster Linie zu ihren Eltern, in zweiter zu einem einsamen, alten Mann«, erwiderte Dr. Cornelius nachdenklich. »Hoppla, jetzt schließen sie anscheinend schon Bekanntschaft mit ihm. Da wollen wir uns mal nicht einmischen.«
»Mr. Docker?« fragte Fee verwundert.
»Gestern bin ich dir eine Antwort schuldig geblieben, Fee«, erwiderte Dr. Cornelius. »Jetzt erzähle ich euch, wo ich gestern war.«
Sie zogen sich zurück ins Haus. Flori stand indessen vor dem grauhaarigen Mann, der in eine Decke gehüllt auf der Terrasse des Gästehauses saß. »Darf ich mich bei dir verstecken?« fragte er. »Wir spielen mit Katja Verstecken.«
»Hier werden sie dich bestimmt nicht suchen«, brummte William Docker.
»Deswegen«, sagte Flori. »Katja hat gesagt, dich darf man nicht stören. Du bist krank. Wieso bist du krank?«
»Warst du noch nie krank?« fragte William Docker.
Flori schüttelte den Kopf. »Wir trinken viel Milch. Von unseren eigenen Kühen. Mami sagt, das ist das Beste. Trinkst du keine Milch?«
»Von der Kuh würde ich schon welche trinken«, erwiderte William Docker.
»Milch kommt immer von Kühen. Manchmal auch von Ziegen, aber die schmeckt nicht so gut«, erklärte Flori. »Aber unsere Kühe geben gute Milch und viel. Sie haben ja auch eine schöne Alm. Bei uns wird keiner krank. Darf ich mich jetzt bei dir verstecken?«
»Hier sucht dich doch keiner«, wiederholte William Docker. »Wo ist denn eure Alm?«
»Willst mal rauskommen?« fragte Flori. »Aber da mußt du steigen, oder mit dem Jeep mußt du fahren, sonst kommt man da nicht rauf. Gesund mußt du erst sein, sonst verschnaufst du dich nicht.«
»So, das meinst du? Wie heißt du überhaupt?«
»Der Flori bin ich, und mein Bruder heißt Hannes«, erwiderte Flori.
»Und dein Vater?«
»Papi heißt Bob, und Mami heißt Milli. Und wir wohnen auf der Riefler-Alm.«
Als hätte er es nicht geahnt. Aber irgendwie hatte er es gleich gewußt, als der Kleine vor ihm stand, denn er hatte gemeint, seinen Sohn Bob vor sich zu sehen. William Docker fuhr sich über die Augen.
»Und wo ist dein Papi jetzt?« fragte er.
»Och, der ist in der Stadt. Die Mami hat uns hergebracht, weil der Dr. Cornelius doch gestern bei uns war. Er ist mächtig nett. Papi weiß gar nicht, daß wir hier sind.«
»Und wo ist deine Mutter?« fragte William Docker heiser.
»Ist nicht Mutter, ist Mami«, sagte Flori. »Sie ist wieder ’naufgefahren, weil ja viele Gäste heute da sind. Nur der Hannes ist hier.«
Und da schrie es schon: »Flori, Flori, hab’ ich dich erwischt.« Und Hannes kam angerannt.
»Hast mich nicht erwischt«, sagte Flori. »Hab’ mich mit dem netten Großpapa unterhalten. Bist du einer?« fragte er, William Docker aufmerksam anblickend.
Der stand auf aus dem Sessel. Die Decke fiel herunter.
»Mr. Docker«, sagte Katja aufgeregt, »Sie sollen sich nicht anstrengen.«
»Papperlapapp«, sagte er, »macht mich nicht kränker, als ich bin. Ich brauche nur Milch von einer richtigen Kuh zu trinken, dann fehlt mir nichts mehr.«
»Hab’ ich ihm gesagt«, erklärte Flori wichtig.
Katja drehte sich um und eilte davon. Aufgeregt platzte sie in Dr. Cornelius’ Zimmer herein.
»Mr. Docker ist übergeschnappt«, stieß sie atemlos hervor. »Komm schnell, Onkel Johannes.«
»Was ist denn los?« fragte Dr. Cornelius.
»Er sagt, er brauche nur Milch von einer richtigen Kuh zu trinken, dann fehle ihm nichts mehr.«
»Bei uns gibt es die ja auch nur in Flaschen«, sagte Dr. Cornelius gelassen. »Auf der Riefler-Alm bei den Woldans bekommt er sie frisch.«
»Onkel Johannes«, sagte Katja verwirrt, »er ist krank.«
»Krank vor Sehnsucht«, sagte Dr. Cornelius gedankenverloren. »Aber ich werde nach ihm sehen.«
Er sah William Docker. An jeder Hand hatte er einen Jungen.
»Und ihr wollt mir zeigen, wie man auf die Alm kommt?« hörte er ihn fragen.
»Es ist aber weit zu Fuß, und Mami ist schon heimgefahren«, sagte Flori. »Sie muß der Zenzi helfen.«
»Gibt es bei euch ein gutes Essen?« fragte William Docker.
»Und was für ein gutes«, sagte Flori.
»Schokopudding hier schmeckt aber auch gut«, sagte Hannes.
»Und Sie sind auf Diät gesetzt, Mr. Docker«, schaltete sich Dr. Cornelius ein.
Der alte Herr warf ihm einen flammenden Blick zu. »Ich weiß, was mir guttut«, sagte er. »Ich will nur ein Glas frische Milch trinken.«
»Nur das?« fragte Dr. Cornelius, und da wußte William Docker, daß er nichts mehr zu verbergen brauchte. »Nein, nicht nur das«, sagte er leise. »Ich habe viel gutzumachen.«
»Aber doch nicht gerade, wenn dort droben Hochbetrieb ist«, sagte Dr. Cornelius. »Wie wäre es, wenn Sie diesen beiden Jungen erst mal eine Geschichte erzählen würden?«
»Eine Geschichte? Was für eine?«
»Die Geschichte von einem alten Mann, der eine weite Reise unternahm, um das wiederzufinden, was er verloren hatte«, sagte Dr. Cornelius.
»Kannst du Geschichten erzählen?« fragte Hannes. »Wir hören gern welche.«
»Mami hat wenig Zeit, weil meistens viel Leute da sind«, warf Flori ein.
»Dann werde ich euch eine Geschichte erzählen«, sagte William Docker, und der Blick, den er Dr. Cornelius zuwarf, bedeutete, daß er mit den beiden Buben allein sein wollte. Aber der Arzt hatte gar nicht die Absicht, sie zu stören. Und er mußte ja Daniel und Fee auch noch die Geschichte dieses Mannes erzählen, der einen weiten Weg, der ihn viel Selbstüberwindung gekostet hatte, gegangen war, um sein Ziel zu erreichen.
»Und was soll nun geschehen?« fragte Fee, als sie William Dockers Geschichte kannte.
»Gegen fünf Uhr wird Mildred Woldan kommen, um ihre Söhne zu holen. Und sie wird einen reuevollen Großvater mitnehmen.«
»Und hier wird ein Zimmer frei«, sagte Daniel. »Dann werde ich schnell mal Frau Leitner anrufen, daß sie gleich kommen kann.«
»Nur nicht so hastig, mein lieber Daniel«, sagte Dr. Cornelius. »Noch ist er nicht weg, und so wild brauchen wir auch nicht auf den Profit zu sein. Mr. Docker hat vorausbezahlt.«
»Aber auch bei anderen gibt es Familienprobleme zu lösen«, sagte Daniel.
»Immer mit der Ruhe. Man merkt die Hektik der Großstadtmenschen«, sagte Dr. Cornelius gelassen.
»Und da kommt Isabel«, rief Fee.
Doch vor ihr war schon Dr. Schoeller da, um Isabel willkommen zu heißen.
Dr. Cornelius und Daniel tauschten einen verständnisinnigen Blick.
»Was sagt man dazu«, murmelte Daniel.
»Isabel«, rief Katja freudig.
»Ein willkommener Gast«, sagte Dr. Cornelius. »Ich glaube nicht, daß wir uns noch Sorgen um die Zukunft unserer Insel machen müssen, mein Junge. Wird dir der Abschied von der Stadt immer noch schwer?«
»Nicht von der Stadt, Johannes. Von der Praxis, den Patienten, von Molly. Man kann nicht alles gleich über Bord werfen.«
Johannes Cornelius nickte. »Und sicher ist es für euch beide gut, wenn ihr eine Zeit allein seid.«
»Bis dahin werden immerhin noch einige Monate vergehen«, sagte Daniel. »Aber du wirst sicher öfter etwas finden, um Fee nach München zu schicken.«
»Ich werde mir Mühe geben«, erwiderte Dr. Cornelius lächelnd.
*
Daniel hatte Isabel und Dr. Schoeller im Park verschwinden sehen, als Mildred Woldan mit ihrem Jeep kam. Er legte seinen Arm um Fee.
»Nun bin ich aber doch gespannt«, sagte er. »Vielleicht werden wir gleich zum Großeinsatz gerufen.«
»Du bist ein Skeptiker«, sagte sie. »Paps weiß schon, was er verantworten kann.«
Davon wurde er überzeugt. »Paps hat mir viel voraus«, sagte er gedankenvoll.
»Ein Vierteljahrhundert«, sagte Fee leise. »Auch die Jahre zählen, Daniel.«
Als er sie küßte, ging Mildred Woldan auf William Docker zu, verhalten und ihre Augen auf die beiden Buben gerichtet.
»Das ist unser Großpapa, Mami«, sagte Florian eifrig. »Er hat es uns erzählt. Es war eine ganz lange Geschichte. Er ist auch von ganz weit hergekommen, um unsere Milch zu trinken. Was sagst du dazu?«
»Nur, um unsere Milch zu trinken?« fragte Mildred.
»Damit er wieder gesund wird«, sagte Hannes.
»Mit dem Jeep kannst du ihn doch bis vor die Tür fahren, Mami«, fiel Flori ein.
»Der Doktor erlaubt nämlich nicht, daß er schon bergan steigt.«
»Wir fahren ihn bis dicht vor unser Haus«, sagte Mildred. »Wenn er damit einverstanden ist.«
Sie sah ihn mit großen schwarzen Augen an. Dann streckte sie ihm zögernd die Hand entgegen, die er behutsam ergriff.
»Und was wird Bob sagen?« fragte er.
»Staunen wird Papi, wenn wir unseren Großpapa mitbringen, gell, Mami?« meinte Florian. »Er wird sich wundern, wo wir ihn endlich gefunden haben.«
»Ja, wundern wird er sich schon«, sagte Mildred.
»Aber unsere Milch wird ihm schmecken«, meinte Hannes. »Er mag Kühe nämlich gern. Als er klein war, war er auch immer bei Kühen auf der Alm. Weißt du das, Mami?«
»Ja, ich weiß es«, erwiderte sie.
»Ich hatte es leider zu lange vergessen«, sagte er mit zittrig klingender Stimme.
»Aber du hast dich daran erinnert«, sagte Mildred gedankenvoll, und ein Lächeln blühte um ihren schönen Mund.
Er hätte ihr noch so viel sagen wollen, aber die Buben wichen nicht von seiner Seite. Sie brannten darauf, dem Großpapa die Alm zu zeigen und die Kühe, und Mildred überlegte, was Bob nun wohl sagen würde.
*
Sagen konnte Bob Woldan gar nichts. Er war starr vor Staunen, als der Jeep hielt und die Kinder heraussprangen. Aber er blickte nur in das Gesicht seines Vaters, über das ein Zucken lief.
»Da staunst du wohl, Papi«, rief Flori, »wir haben unseren Großpapa gefunden. Er war schon auf der Insel.«
Mildred warf ihrem Mann einen bittenden Blick zu, und ihren Augen hatte er noch nie widerstehen können.
Es wurde kein roter Teppich unter Williams Füße gebreitet, aber Bob ging ihm doch ein paar Schritte entgegen, als Mildred sagte: »Herzlich willkommen daheim, Vater.«
»Du hast eine wunderbare Frau, Bob«, sagte William Docker. »Ich schäme mich und bitte euch um Vergebung.«
Wer ihn so kannte wie sein Sohn, wußte, was solche Worte für ihn bedeuteten und daß sie aus dem tiefsten Herzen kamen.
»Dann sage ich auch herzlich willkommen, Vater«, sagte Bob.
»Jetzt muß Großpapa aber Milch trinken, viel Milch«, sagte Hannes. »Er war nämlich krank.«
»Aber jetzt beginnt das Leben noch einmal«, sagte der alte Herr, und ganz zärtlich, wie man es diesen großen Händen nicht zutraute, streichelten sie die blonden Köpfe der beiden kleinen Jungen. »Ich danke euch«, murmelte er.
»Wofür denn?« fragte Flori.
»Daß ihr mir diesen Tag geschenkt habt.«
Und da waren die beiden Kleinen auch still, denn sie fühlten, daß dies ein ganz feierlicher Augenblick war.
*
Isabel konnte auf der Insel bleiben, Daniel mußte wieder zurück nach München. »Das nächste Wochenende komme ich«, versprach Fee, und das tröstete ihn.
»Wir wechseln uns immer schön ab«, sagte er zärtlich, »dann werden die paar Monate auch noch vergehen.«
Ereignisreich sollten die kommenden Wochen zur Genüge werden. Auf zwei Hochzeiten waren sie eingeladen. Uschi Glummer und Eugen Bächler heirateten schon am Ende dieses Monats, und währenddessen erholte sich Karl Kürten auf der Insel der Hoffnung von seiner Krankheit, um für die Hochzeit seiner Tochter Astrid ganz fit zu sein.
Eine Überraschung war das für Dr. Norden schon gewesen, denn mit einer so schnellen Lösung aller Konflikte hatte er nicht gerechnet.
Lilly Friedinger traf er nicht mehr. Sie schien von der Bildfläche verschwunden zu sein. Es wäre wohl ein bißchen viel für sie gewesen, Astrid als glückliche Braut zu sehen. Und wie war diese glücklich!
»Ich beneide Wolfgang Bender«, raunte Daniel Fee zu, als das Brautpaar nach der Trauung die weiße Hochzeitskutsche bestieg.
»Um Astrid?« fragte Fee schelmisch.
»Um die Flitterwochen«, gab er leise zurück.
»Die Zeit hat Flügel«, sagte Fee sinnend.
»Du hast immer einen Trost«, raunte er ihr ins Ohr. »Mir wird die Zeit manchmal schrecklich lang. Und es gefällt mir gar nicht so sehr, die andern zu betrachten, die am Ziel ihrer Wünsche sind.«
»Wir sollten nicht vergessen, daß auch wir beneidet werden von denen, die nicht so glücklich sind wie wir«, sagte Fee leise. »Zum Beispiel von deinem Freund Schorsch.«
»Ja«, erwiderte Daniel sinnend. »Ich habe schon wieder ein paar Wochen nichts mehr von ihm gehört.«
»Du wirst ihn sehen, wenn du am Wochenende zu uns kommst. Wir wollen Frau Leitners Geburtstag feiern. Ihr könntet ja auch gemeinsam kommen. Er ist nicht glücklich, Daniel.«
»Und es gibt noch viele andere, die auch nicht glücklich sind. Du hast recht, Fee, wie immer hast du recht. Was ist in den vergangenen Wochen alles geschehen! Wenn wir darüber schreiben würden, wie würden wir dieses Kapitel unseres Leben nennen?«
»Laß mich überlegen, Liebster. Denken wir an Uschi Glimmer.«
»Hächler heißt sie jetzt, mein Liebes«, warf er ein.
»Also Frau Hächler«, nickte Fee lächelnd. »Dann Astrid und ihr Wolf.«
»William Docker dürfen wir auch nicht vergessen. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie es ihm geht.«
»Prächtig. Er hütet die Kühe, und seine Enkel helfen ihm dabei«, erwiderte Fee lachend.
»Und was machen seine Fabriken in den Staaten?«
»An die denkt er nicht mehr. Er bleibt auf der Alm. Er hat wieder Geschmack am einfachen Leben gewonnen.«
»Vielleicht hat das Leben für ihn erst jetzt den richtigen Sinn bekommen«, sagte Daniel gedankenverloren. »Das gilt nicht nur für ihn, es könnte auch für Astrid gelten.«
»Überall ist Liebe die beste Medizin«, sagte Fee. »Wir müßten dieses Kapitel wohl ›Die Macht der Liebe‹ nennen.«
Er sah ihr tief in die Augen. »Sie hat mich gepackt, die Macht der Liebe, mein Feelein«, sagte er zärtlich, und dann küßte er sie lange und innig.
- E N D E -