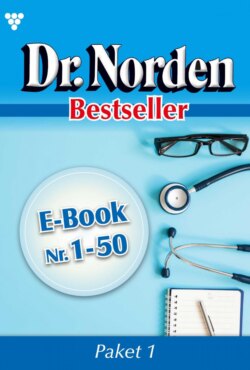Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Praxis Dr. Norden«, meldete sich Felicitas Norden, als das Telefon läutete. Eine kleine Pause entstand, in der Helga Moll, Dr. Nordens Sprechstundenhilfe, eine aufgeregte Stimme durch den Draht schallen hörte.
»Ja, Frau von Rosen, ich verstehe, dass Sie besorgt sind. Falls mein Mann nicht sofort abkömmlich ist, werde ich kommen.«
Fee legte den Hörer auf und sah Molly, wie Helga Moll von allen genannt wurde, mit einem flüchtigen Lächeln an.
»Ein Hotelgast ist schwer erkrankt«, erklärte sie. »Frau von Rosen ist sehr aufgeregt, aber erbaut scheint sie nicht davon zu sein, dass ich in Vertretung meines Mannes kommen will. Es ist nicht einfach, die Frau eines vielbegehrten Arztes zu sein, Molly.«
»Sie machen das schon recht, Frau Doktor«, sagte Molly im Tone höchster Anerkennung. »Die Leut können sich halt noch nicht daran gewöhnen, dass es hier nun auch eine Frau Dr. Norden gibt.«
Herr Dr. Norden entließ gerade einen Patienten aus seinem Sprechzimmer. Das Wartezimmer war allerdings noch voll.
»Was gibt es denn, Fee?«, fragte er in Eile.
»Pension Rosengarten. Ein Gast hat hohes Fieber. Frau von Rosen befürchtet Ansteckungsgefahr. Er ist vor ein paar Tagen aus Portugal gekommen.«
»Da werde ich doch lieber selbst hinfahren. Mach du hier weiter, Liebes«, sagte Dr. Daniel Norden. »In Portugal ist doch Cholera aufgetreten. Na, hoffentlich ist es nicht so schlimm.«
Er holte schon seinen Koffer, nickte seinen Damen zu und verschwand.
Schnell hatte Dr. Norden die Pension Rosengarten erreicht. Frau von Rosen, die Besitzerin, früh verwitwet und Mutter von drei Kindern, hatte aus der Not, in die sie durch den Tod ihres Mannes geraten war, eine Tugend gemacht und die prachtvolle Villa, die inmitten eines großen Parkes gelegen war, zu einem Gästehaus umgestaltet.
Über mangelnden Zuspruch hatte sie sich nicht zu beklagen. Es sprach sich herum, wie angenehm man hier wohnen konnte, und es gab viele Durchreisende, die die Ruhe genossen, wenn sie anstrengende Geschäfte erledigen mussten.
Dr. Norden betreute die Familie Rosen als Arzt und manchmal auch einen Gast, aber einen so schwierigen Fall wie diesen, dessentwegen Frau von Rosen ihn gerufen hatte, hatte es hier noch nicht gegeben.
Der Mann hieß André Clermont, und Frau von Rosen hatte ihn vor drei Tagen erfreut aufgenommen, weil er ein Appartement für zwei Wochen gemietet hatte.
»Ein sehr feiner vornehmer Mensch, Herr Doktor«, erklärte sie. »Schon gestern ging es ihm nicht gut, aber er wollte keinen Arzt, obgleich ich es ihm dringend ans Herz legte.«
André Clermont lag schweißgebadet in seinem Bett. Dr. Norden überzeugte sich, dass das Fieber bereits über vierzig Grad gestiegen war, ansprechbar war der Patient auch nicht mehr, kein Hautausschlag und auch keine Anzeichen für eine Grippe waren vorhanden. Der Puls war stark beschleunigt.
»Sofort in die Klinik«, sagte Dr. Norden. Nicht nur, weil man Frau von Rosen die Pflege eines schwerkranken Gastes nicht zumuten konnte, sondern auch deshalb, weil er eine klinische Untersuchung für dringend erforderlich hielt, um die Ursachen dieses rasenden Fiebers festzustellen.
Dr. Norden rief seinen Kollegen Dr. Dieter Behnisch an, der Besitzer einer Privatklinik war. Sie waren befreundet und arbeiteten gern zusammen. Daniel Norden interessierte dieser Fall, hier konnte er wieder etwas dazulernen.
Der Krankenwagen kam. André Clermont war völlig apathisch, halb bewusstlos. Er öffnete nur zweimal kurz die Augen und murmelte etwas Unverständliches.
Dr. Norden fuhr dem Krankenwagen nach zur Behnisch-Klinik. Er wurde dort von Frau Dr. Jenny Lenz empfangen, die seit ein paar Wochen Assistentin bei Dr. Behnisch war. Er selbst hatte diese Zusammenarbeit vermittelt, und Jenny Lenz war ihm dafür sehr dankbar. Sie war aus Uganda gekommen und hatte nicht erwartet, dass sie so bald eine so gute Stellung bekommen würde.
»Nun, wie geht’s?«, erkundigte sich Dr. Norden herzlich.
»Probezeit bestanden«, erwiderte sie knapp, aber doch mit einem Lächeln.
Sie machte niemals viele Worte, und gerade das hatte ihr bei Dr. Behnisch schon große Sympathie eingebracht. Und wie viel sie von ihrem Beruf verstand, konnte sie gerade heute unter Beweis stellen. Allerdings kam ihr bei dieser Diagnose auch ihr Aufenthalt in Afrika zugute.
»Der Patient hat eine schleichende Sepsis«, stellte sie ruhig fest. »Sie ist jetzt in ein akutes Stadium getreten.«
»Und Sie können auch aus dem Handgelenk schütteln, wodurch sie hervorgerufen worden ist?«, fragte Dr. Behnisch sarkastisch.
Dr. Jenny Lenz blieb gelassen. »Aus dem Handgelenk nicht, aber aus gewissen Erfahrungen kann ich es vermuten. Der Patient mag mit einer exotischen Pflanze in Berührung gekommen sein, hatte vielleicht eine kleine Wunde an der Hand.
Ja, da ist eine kleine Narbe zu sehen, wie Sie sehen, schlecht verheilt. Diese Pflanzen, es gibt mehrere, sind giftig.« Sie errötete, als beide Ärzte sie fasziniert anblickten.
»Das ist ja phänomenal«, sagte Dr. Behnisch.
»Überhaupt nicht«, erklärte Jenny Lenz bescheiden. »Es ist in diesem Fall einfach ein Glück, dass ich Ähnliches schon erlebt habe. Ich weiß, wie man eine solche Sepsis behandeln muss. Sein Herz würde dieses Fieber, dem bald Schüttelfröste folgen werden, nicht lange aushalten, obgleich er ein gesundes Herz hat. Sonst würde er wahrscheinlich gar nicht mehr leben.«
»Dann ans Werk«, sagte Dieter Behnisch forsch, um nicht deutlich zu zeigen, wie sehr er von seiner Assistenzärztin beeindruckt war.
»Wie gut, dass Sie hier sind, Jenny«, sagte Dr. Norden warm. »Wir hätten wohl noch gerätselt, was die Ursache sein könnte.«
»Ich will nicht sagen, ob das Leben des Patienten zu retten ist«, sagte Jenny Lenz leise. »Leider habe ich sehr trübe Erfahrungen machen müssen.«
»Haltet mich auf dem Laufenden«, sagte Dr. Norden. »Ich kann doch Frau von Rosen hoffentlich beruhigen, dass keine Quarantäne verhängt werden muss?«
»Ansteckend ist es auf keinen Fall«, erwiderte Jenny. »Das wäre ja auch furchtbar. Und hier ist ja Penicillin in jeder Menge verfügbar.«
Er rief sofort Frau von Rosen an und beruhigte sie, so weit er dies konnte, denn sie zeigte sich äußerst besorgt um ihren Gast.
Fee war noch im Sprechzimmer. Er störte sie nicht, denn er wusste, dass sie sich unsicher fühlte. Molly
hatte ihm gesagt, dass Herr Billing bei ihr war. Das war ihm nicht gerade angenehm, denn Herr Billing war ein schneidiger junger Mann, der sich für unwiderstehlich hielt. Er war gespannt, wie Fee mit ihm fertig wurde.
Er musste dann mit ansehen, wie der Herr Billing seiner Fee zum Abschied die Hand küsste, und seine Stirn umwölkte sich.
»Man kann Sie nur beglückwünschen, Herr Doktor«, sagte Herr Billing dann auch noch, bevor er verschwand, und als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, seufzte Fee abgrundtief.
»Der Bursche ist unausstehlich«, schimpfte Daniel.
»Ich werde mit solchen Burschen schon fertig, aber natürlich frage ich mich jetzt, wie du mit deinen Anbeterinnen fertig wirst, mein Schatz.«
»Na, da kann ich Sie beruhigen, Frau Doktor«, mischte sich Molly ein. »Er wird’s aus dem Effeff.«
»Nach wie viel Fehlschlägen?«, fragte Fee schelmisch.
»Nach gar keinen, Fee. Du traust mir doch wohl zu, dass ich mich meiner Haut auch zu wehren verstehe. Sind wir fertig?«
»Ja. Ein paar sind gegangen. Ich fürchte, unsere Heirat bewirkt einen Rückgang der Patientinnen.«
»Meinetwegen. Dann kommen andere, die gleich wissen, dass es eine bezaubernde Frau gibt, mit der sie nicht konkurrieren können. Und wenn alle Stränge reißen, ziehen wir uns auf die Insel zurück.«
Das wäre Fee allerdings am liebsten gewesen. Das Sanatorium »Insel der Hoffnung« wurde von ihrem Vater geleitet, der mit Daniels Vater eng befreundet gewesen war. Entstanden war es nach den Plänen von Daniels Vater, aber die Verwirklichung hatte dieser Arzt und Menschenfreund nicht mehr erlebt. Daniel hatte sich nicht entschließen können, seine Stadtpraxis aufzugeben. Jetzt wusste Fee allerdings auch schon den Grund dafür. Er wollte ihrem Vater, Dr. Johannes Cornelius, nicht ins Handwerk pfuschen, wie er sagte.
Molly fuhr heim. Da Fee jetzt hier war, brauchte sie nur noch halbtags zu arbeiten, was ihrer Familie zugute kam. Hätte sie ihre Tätigkeit jedoch ganz aufgeben müssen, wäre sie todunglücklich gewesen, denn sie war auch schon bei dem alten Dr. Norden Sprechstundenhilfe gewesen. Molly gehörte fast zur Familie, doch von ihrer eigenen wurde sie auch beansprucht wenn die Kinder auch aus dem Gröbsten heraus waren und ihr Mann – nach jahrelanger räumlicher Trennung lebten sie jetzt wieder in einem Haushalt – sich sehr zu seinem Vorteil verändert hatte.
Fee und Daniel fuhren mit dem Lift aufwärts in ihre Penthousewohnung, wo Lenchen schon mit dem Essen auf sie wartete.
Es war eine traumhaft schöne Wohnung, umgeben von einem Dachgarten, der das Gefühl vermittelte, hoch über den Dächern der Stadt in einer kleinen Welt für sich zu sein.
Lenchen, die treue Seele, sorgte mit Hingabe für Ordnung und das leibliche Wohl »ihrer« Kinder. Fee brauchte sich um nichts zu kümmern, und so war sie froh, sich in der Praxis nützlich machen zu können, denn sonst wäre ihr das Leben wohl doch zu langweilig geworden.
Lange Zeit für eine Mittagspause hatten sie nicht. Daniel musste Besuche machen.
In aller Eile hatte er Fee vom Fall Clermont erzählt, und zu Daniels Überraschung wurde Fee bei dem Namen stutzig.
»Der Biologe?«, fragte sie.
»Keine Ahnung, wie kommst du darauf?«
»Ich habe mal eine Abhandlung gelesen. Ein Dr. Clermont hat mal einen sensationellen Selbstversuch gemacht, um ein Mittel gegen Pilzvergiftung auszuprobieren. Das liegt zwei Jahre etwa zurück. Es ist mir in der Erinnerung haften geblieben, weil es mir gewaltig imponiert hat.«
»Und der Versuch ist gelungen, sonst würde er jetzt nicht noch leben. Aber wenn er wieder ein neues Experiment gewagt hat, scheint es nicht gelungen zu sein, denn jetzt schwebt er in Lebensgefahr.«
»Ich könnte mir auch kaum vorstellen, dass er ein Experiment in einer Pension macht«, sagte Fee nachdenklich. »Oder war es gar ein Selbstmordversuch? Sein Bruder, daran erinnere ich mich auch, ist durch Selbstmord aus dem Leben geschieden.«
»Was du für ein Gedächtnis hast. Es ist mir direkt unheimlich«, sagte Daniel.
*
André Clermont hatte die ersten beiden Penicillin-Injektionen schon bekommen. Das Fieber war zwar nur leicht gesunken, aber auf Jennys Zureden hatte sich Dr. Behnisch doch entschlossen, die so schlecht verheilte Wunde an der Hand zu öffnen und auf einen Fäulnisherd zu untersuchen. Das war wohl das Beste, was sie tun konnten, und auch das Beste für André Clermont, denn ihnen bot sich ein schrecklicher Anblick. Eiter quoll hervor, der ekelerregend gefärbt war.
Jenny sah in das fahle Gesicht des Patienten. Ein schmales, intelligentes Gesicht romanischen Charakters. Eine hohe Stirn, schmale, leicht gebogene Nase, dichte schwarze Augenbrauen und dichte, für einen Mann sehr lange Wimpern.
»Haben wir eigentlich die Personalien?«, fragte Jenny. »Man müsste etwaige Angehörige auf jeden Fall verständigen.«
»Sein Name ist André Clermont. Mehr weiß ich auch noch nicht«, erwiderte Dr. Behnsich.
»Clermont? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist er Franzose?«, fragte Jenny.
»Keine Ahnung, er hat noch nicht mit uns gesprochen, Frau Doktor«, entgegnete Dr. Behnisch mit einem flüchtigen Lächeln.
»So bald wird er auch nicht mit uns reden«, sagte sie gedankenvoll. »Wir müssen uns erkundigen.«
»Daniel weiß sicher mehr«, sagte Dr. Behnisch vor sich hin. »Ich rufe ihn dann an.«
Das geschah eine halbe Stunde später. Dr. Norden war von seinen Besuchen noch nicht zurück. Fee nahm den Anruf entgegen. Sie war mit Dieter Behnisch schon per Du. Er war auch Gast auf ihrer Hochzeit gewesen, denn das hatte er sich nicht entgehen lassen wollen, dass sein Freund Daniel, den er für einen genauso eingefleischten Junggesellen gehalten hatte, wie er selbst einer war, seine Freiheit aufgab. Allerdings musste er zugeben, dass man für eine so bezaubernde Frau seine Freiheit gern aufgeben könnte.
Fee sagte ihm, dass sie überlege, ob es sich bei dem Patienten um den Biologen Dr. Clermont handeln könne, und versprach, sich mit Frau von Rosen in Verbindung zu setzen, um mehr zu erfahren.
Das tat sie dann auch gleich und bekam zur Antwort, dass er sich zwar als Dr. Clermont eingetragen hätte, aber man sonst auch nichts wisse. Eben wäre allerdings ein Herr gekommen, der Dr. Clermont besuchen wolle.
»Schicken Sie ihn bitte zuerst zu uns in die Praxis, Frau von Rosen«, sagte Fee, um im Nachhinein zu überlegen, warum sie darum gebeten habe.
Ich bin ja neugierig, ging es ihr durch den Sinn, doch bald wurde sie wieder abgelenkt. Patienten riefen sie an, baten um einen Termin oder um einen Besuch.
Dann kamen auch schon ein paar ganz Pünktliche, obgleich die Nachmittagssprechstunde erst um vier Uhr begann. Daniel rief an und fragte, ob etwas Besonderes vorläge. Aber sie ahnte, dass er nur Sehnsucht nach ihrer Stimme hatte. Das kannte sie ja schon. Dennoch sagte sie ihm, dass es wohl gut wäre, wenn er schnell bei der Behnisch-Klinik vorbeifahren würde.
Und gleich darauf erschien Leopold Steiger, der sich als Freund von Dr. Clermont vorstellte.
Er machte einen ausgesprochen sympathischen Eindruck, war mittelgroß, untersetzt und hatte humorvolle Augen, die Fee sofort gefielen. Allerdings nahmen diese einen ernsten Ausdruck an, als sie ihm sagte, dass Dr. Clermonts Zustand bedenklich sei.
»Ich dachte, Frau von Rosen übertreibe mit ihrer Besorgnis«, sagte er. »André ist nicht so schnell umzubringen.«
»Er soll auch nicht umgebracht, sondern gerettet werden«, erklärte Fee. »Verzeihen Sie meine Wissbegierde, Herr Steiger, aber handelt es sich bei dem Patienten um den Biologen Dr. Clermont?«
»Sie kennen ihn?«, fragte Leopold Steiger überrascht.
»Seinen Namen. Ich habe in einigen Fachzeitschriften Abhandlungen über ihn gelesen.«
»Die stammen von mir, aber André hat es nicht gern, wenn man darüber spricht. Unsere Freundschaft wäre fast darüber in die Brüche gegangen, aber es ist meine Meinung, dass alles, was der Menschheit dient, nicht im Verborgenen blühen soll.«
»Das ist auch meine Meinung. Besteht Grund zu der Annahme, dass er wieder ein Experiment an sich vorgenommen hat? Es ist eine Frage, die Sie natürlich nicht beantworten müssen.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss ein unglückseliger Zufall sein. André hätte niemals andere in Schwierigkeiten gebracht, wenn er experimentiert.«
»Jedenfalls ist sein Zustand ernst. Ich habe es eben aus der Klinik erfahren, aber es ist wohl doch besser, wenn Sie sich direkt mit Dr. Behnisch in Verbindung setzen.«
Leopold Steiger sah sie nachdenklich an. »Nahe Verwandte hat mein Freund André nicht mehr. Sein Bruder starb vor drei Jahren, seine Mutter vor einem Jahr.«
»Sein Bruder war Chemiker und beging Selbstmord«, sagte Fee sinnend.
»Ja, er beging Selbstmord. Er hatte seine Gründe dafür«, erklärte Leopold Steiger nun kühl.
»Verzeihen Sie mir, wenn ich aufdringlich erscheine«, sagte Fee.
»Nein, so fass ich das nicht auf. Ich glaube, dass ich ein ganz guter Menschenkenner bin. Sie sind an André Clermont, dem Forscher, interessiert.«
»So ist es. Es mag wohl nicht jedem begreiflich sein, aber ich finde es fantastisch, wenn ein Mensch sein eigenes Leben einsetzt, um das Leben anderer zu retten.«
»André bedeutet sein eigenes Leben nichts mehr, das ist das Traurige«, sagte Leopold Steiger leise. »Aber nun glauben Sie bitte nicht, dass er es auch wegwerfen würde. Was ist eigentlich los mit ihm?«
»Das wird Ihnen Herr Dr. Behnisch sagen. Wenn er Sie fragen sollte, warum ich mit Ihnen gesprochen habe, dann erwidern Sie ihm ruhig, dass ich es selber nicht weiß.«
Auf Leopold Steigers sehr ernst gewordenem Gesicht erschien ein flüchtiges Lächeln.
»Ich freue mich jedenfalls, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben«, sagte er, und auch er küsste ihr zum Abschied die Hand.
*
Dr. Norden hatte nicht viel in Erfahrung bringen können und auch nicht mehr erfahren, als Dr. Behnisch im Augenblick sagen konnte.
Der hatte sich in den höchsten Tönen über Jenny Lenz ausgelassen und sich bei Daniel bedankt, dass er durch ihn zu einer so überaus tüchtigen Assistentin gekommen war.
Daniel fuhr in die Praxis. Dr. Behnisch lernte Leopold Steiger kennen, der anscheinend der einzige Mensch war, der Dr. Clermont freundschaftlich verbunden war. So jedenfalls sah es während der nächsten Tage aus.
Doch während das Leben des Patienten noch immer in Gefahr war und Fee sich bemühte, so viel wie nur möglich über diesen Dr. Clermont in Erfahrung zu bringen, sollte sie am dritten Tage eine Überraschung erleben.
Der Tag hatte schon turbulent begonnen, dann gegen halb fünf Uhr morgens war Daniel zu einem Patienten gerufen worden, der einen schweren Herzanfall hatte. Natürlich war Fee auch aufgewacht, als das Telefon läutete, und sie hatte nicht mehr einschlafen können.
Fees Gedanken wanderten zu ihrem Schwiegervater, der nicht mehr erlebt hatte, dass sein größter Wunsch in Erfüllung ging und die Insel der Hoffnung zu einem wahren Paradies geworden war, aber vielleicht wäre es ein noch größeres Glück für ihn gewesen, dass sie und Daniel sich gefunden hatten.
Geliebt hatte sie ihn immer, nur hatte sie gemeint, dass es eine unerfüllbare Liebe bleiben würde.
Mein Gott, war ich dumm, dachte sie. Wir könnten längst verheiratet sein und Kinder haben. Aber auf ein Kind brauchten sie nicht mehr lange zu warten!
Als sie daran dachte, flog ein heller Schein über Fees Gesicht. Sie konnte den Tag kaum noch erwarten, bis sich das Kind in ihrem Leib regte, bis sie wirklich an das Wunder glauben konnte.
Wie würde sie dieses Kind lieben! Daniels Kind. Mit aller Zärtlichkeit wollte sie es einhüllen, bevor es noch seinen ersten Schrei tat.
Endlich kam Daniel von seinem Besuch heim. Sie sah ihn lange an, als er am Frühstückstisch saß. Sie liebte dieses Gesicht, die kleinen Lachfalten in seinen Augenwinkeln, wenn er zu ihr herüberblinzelte, die Lippen, die kräftigen Zähne, die die schönsten waren, die sie je bei einem Mann gesehen hatte. Seine Augen, seine Hände, seine selbstsichere Männlichkeit und vor allem seine Intelligenz.
»Ich liebe dich«, sagte sie aus diesen Gedanken heraus.
»Das will ich doch hoffen«, gab er lächelnd zurück, und dann bekamen seine Augen jenen Ausdruck, der ihr Blut schneller pulsieren ließ und ihr Herz zum Rasen brachte. »Ich liebe dich auch«, sagte er mit ganz weicher Stimme, »und es ist wundervoll, jeden Tag mit dir beginnen zu können.«
Ja, es war wundervoll, und Fee wusste noch nicht, was dieser Tag ihr noch bringen würde.
*
Es war gegen zehn Uhr, und Daniel musste gerade einen Jungen versorgen, der schwer mit dem Rad gestürzt war. Fee hatte sich wieder ein wenig geärgert, weil zwei Patientinnen lieber längere Wartezeiten in Kauf nehmen wollten als sie zu akzeptieren, als Molly zu ihr ins Labor kam und ihr den Besuch einer Dame ankündigte.
»Herzog ist ihr Name«, sagte Molly.
»Und sie will nicht zu meinem Mann, sondern zu mir?«, fragte Fee.
»Sie kommt anscheinend gar nicht als Patientin«, sagte Molly.
»Eine Vertreterin?«
»Nein, so sieht sie nicht aus.«
»Nun, dann herein mit ihr!«
Eine vollendete junge Dame erschien.
»Mein Name ist Bettina Herzog«, sagte sie mit leiser, angenehmer Stimme. »Poldi sagte«, sie unterbrach sich und errötete, »ich meine Herrn Steiger, er war neulich bei Ihnen.«
Sie sprach stockend, was eigentlich nicht zu ihr passte, denn sie machte einen sehr selbstbewussten Eindruck, aber jetzt war sie sichtlich verlegen. »Es handelt sich um André Clermont«, fügte sie überstürzt hinzu.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz«, sagte Fee. Sie betrachtete ihr Gegenüber forschend und stellte fest, dass es eine äußerst aparte Erscheinung war. Ein Gesicht, das klassisch geschnitten und unglaublich ausdrucksvoll war, graugrüne Augen, weit geschnitten, wachsam, aber doch nicht kühl wirkend, was bei dieser Farbe leicht der Fall war.
Die vollen, wunderschön geschnittenen Lippen zuckten leicht.
»Ich wollte mich nicht an die Klinik wenden, in der André liegt«, fuhr Bettina Herzog fort. »Er soll nicht wissen, dass ich mich nach ihm erkundige.«
Und warum nicht?, fragte sich Fee, aber auf die Erklärung musste sie noch geraume Zeit warten.
»Es ist nicht leicht, das zu erklären«, fuhr Bettina fort, »aber mit einer Frau kann man besser sprechen als mit einem Mann. Poldi, wir sind gute Freunde, sagte mir, dass ich zu Ihnen Vertrauen haben könnte.«
»Das ehrt mich«, erwiderte Fee mit einem flüchtigen Lächeln.
Und dann erfuhr Fee eine Geschichte, die vor drei Jahren begonnen hatte, für Bettina Herzog jedoch noch nicht beendet war.
Schon bei der Einleitung hielt Fee den Atem an. »Ich war mit Bob Clermont verlobt«, begann Bettina. »Er war als Chemiker in unserer Fabrik beschäftigt. Mein Vater hielt sehr viel von ihm. Er ging bei uns ein und aus, und anfangs war ich ziemlich verliebt in ihn. Ich spreche nicht gern darüber, aber wie sollten Sie das andere sonst verstehen.«
Bettina schien bewusst zu werden, dass sie da ihre intimsten Gedanken preisgab, und lächelte gequält.
»Betrachten Sie mich bitte als Patientin, Frau Dr. Norden«, sagte sie leise. »Es ist ja auch wie eine Krankheit, die mich verzehrt, mir den Schlaf raubt und mein Seelenleben belastet. Ja, vielleicht bin ich wirklich krank. Psychisch!«
»Niemand wird etwas von mir erfahren«, warf Fee ein. »Sprechen Sie ruhig. Wenn ich Ihnen helfen kann, will ich es gern tun.«
»Ja, ich war also etwa acht Wochen mit Bob verlobt, als er sich ganz merkwürdig veränderte. Er machte einen gehetzten Eindruck. Mein Vater schob es auf Überarbeitung. Tatsächlich hatte er ganz selten Zeit für mich und kam kaum noch zu uns. Er arbeitete mit einem Team an der Entwicklung eines neuen Kunststoffes.
Dann kam der sechzigste Geburtstag meines Vaters, an dem zugleich das fünfundzwanzigjährige Jubiläum unseres Werkes gefeiert werden sollte. Bobs Mutter und André kamen zu uns. Ich kannte beide noch nicht. Ich sollte mich kurz fassen«, murmelte sie. »Wenn wir unterbrochen werden, verliere ich wieder den Mut.«
»Dann schlage ich vor, dass wir in unserer Privatwohnung weitersprechen. Wir fahren nach oben«, sagte Fee.
Bettina folgte ihr wie eine Marionette. Ihre Gedanken weilten in der Vergangenheit. Leise sagte Fee zu Molly, dass sie oben nicht gestört werden wolle.
Das musste etwas sehr Wichtiges sein. Molly war schon ein bisschen neugierig. Daniel dagegen war verblüfft, als sie es ihm sagte.
»Herzog? Kenne ich nicht«, brummte er. Auf die chemische Fabrik gleichen Namens wäre er nicht gekommen.
Fee dagegen wusste es nun schon, und demzufoge auch, dass sehr viel Geld dahinterstand. Sie erfuhr dann auch, dass dies bei den Clermonts nicht vorhanden gewesen war. Sie hatten bei einem Bankkrach alles verloren.
»Davon hatte Bob nie gesprochen, und es hätte für mich auch keine Rolle gespielt«, sagte Bettina, »nicht, wenn es zwischen uns die große Liebe gewesen wäre. Aber die lernte ich erst durch André kennen. Ich hoffte, dass Bob dafür Verständnis haben würde, da ich ohnehin den Eindruck hatte, dass er sich immer weiter von mir entfernte. Zufällig sah ich ihn dann auch einmal mit einer sehr schönen Frau, und da sagte ich ihm dann, dass wir die Verlobung lösen sollten. Ich sagte ihm, dass ich André liebte. Er zuckte nur die Schultern, und am Abend dieses Tages nahm er sich das Leben. Es war schrecklich. Seine Mutter warf mir vor, dass ich schuld daran sei. André war sehr distanziert. Erst eine Woche später erfuhr ich dann von meinem Vater den wahren Grund für diesen Selbstmord. Bob hatte wichtige Forschungsergebnisse an die Konkurrenz verkauft. Es hätte einen Riesenskandal gegeben, wenn ich Vater nicht hätte veranlassen können, diese Tatsache zu vertuschen. Ich tat es im Interesse von André. Ich glaubte doch, dass er mich genauso liebt wie ich ihn und dass wir doch eines Tages wieder zueinanderfinden würden.
Aber er verschwand. Ich sah ihn nicht mehr wieder. Er war unerreichbar für mich. Auch für Poldi, der die ganze Wahrheit allerdings bis heute nicht weiß. Ich musste annehmen, dass André mit seiner Mutter einer Meinung wäre und sich vielleicht auch mitschuldig fühlte am Tode seines Bruders.
Von Poldi erfuhr ich dann, dass Frau Clermont vor ein paar Monaten starb. Er hatte endlich Nachricht von André bekommen, aber er brachte mir sehr diplomatisch bei, dass André keine Verbindung mehr zu mir aufnehmen wolle. Sie wollten sich dann hier in München treffen, und das geschah dann auch. Und bevor Poldi noch von André erfahren konnte, warum er alle Brücken zu mir abgebrochen hatte, wurde André krank. Poldi rief mich an, und ich bin sofort gekommen. Ich liebe André, Frau Dr. Norden. Wenn er Hilfe braucht, möchte ich ihm helfen, ohne dass er es erfährt. Ich brauche dabei die Hilfe eines Menschen, den er nicht mit mir in Zusammenhang bringen kann. Ich fühle, dass etwas zwischen uns steht, was ich mir nicht erklären kann, denn ich bin überzeugt, dass Bob mich aus Berechnung heiraten wollte und André dies wusste.«
»Und mir vertrauen Sie? Ich danke Ihnen«, sagte Fee herzlich. »Ich werde mich bemühen, alles herauszubekommen, was wissenswert für Sie sein kann. Wir sind mit Dr. Behnisch befreundet.«
»Das hörte ich, und deshalb wagte ich es überhaupt, mich an Sie zu wenden.«
»Sie bleiben in München?«
»Ja. Ich habe mir ein Appartement in der Pension Rosengarten genommen. Frau von Rosen weiß allerdings nicht, dass ich André kenne.«
Sicher gab es manches, was Bettina Herzog verschwiegen hatte, aber Fee konnte nicht erwarten, dass sie jede Einzelheit erzählte. Jedenfalls liebte diese Frau André Clermont, dessen war Fee sicher, und sie ließ sich auch nicht von Daniel irremachen, der mit merkwürdigen Argumenten aufwartete.
Er trat erst in Erscheinung, nachdem Bettina sich verabschiedet hatte.
Aber ein bisschen mehr erfuhr er dann doch, denn Fee meinte, dass sie ihn doch brauchen würde, da Dr. Behnisch ihm mehr erzählen könnte.
Daniel runzelte die Stirn und legte die Hand auf Fees Rechte. »Pass mal auf, Liebes«, begann er zögernd. »Du hast ihre Geschichte gehört. Vielleicht würde André Clermont eine ganz andere erzählen. Kannst du denn sicher sein, dass es nicht nur ein Märchen ist? Industriespionage ist ein übles Geschäft, wenn es auch oft als Kavaliersdelikt bezeichnet wird. Nehmen wir mal an, ihr Verlobter Bob habe jene umwälzende Erfindung gemacht, und Herzog wollte ihn übers Ohr hauen. Seine Tochter wusste davon und machte mit ihm gemeinsame Sache. Ich meine, mit dem Vater. André Clermont kam dahinter. Und …«
»Du entwickelst eine blühende Fantasie, Liebster«, lächelte Fee. »Wenn die Praxis nicht mehr geht, schreibst du Krimis. Bettina Herzog liebt diesen Mann. Ein bisschen Menschenkenntnis darfst du mir schon zutrauen.«
»Nicht gleich wild werden«, sagte er und zog sie an sich. »Sie hat dich beeindruckt, also muss sie eine bemerkenswerte Frau sein. Molly sagt, dass sie sehr attraktiv ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man schön, reich und klug dazu ist, und drei Jahre einem Mann nachweint?«
»Und was habe ich getan? Zugegeben, ich bin weder schön noch reich gewesen, aber ich habe doch insgeheim darauf gehofft, dass ein gewisser Daniel Norden mal bemerkt, dass ich wenigstens als Ärztin etwas tauge.«
»Das ist allerdings ein schwerwiegendes Argument«, sagte er mit leisem Lachen. »Du bist für mich die schönste Frau der Welt, und du bist auch unheimlich klug, und eine gute Ärztin bist du auch.«
»Du bist ein Schatz«, sagte Fee zärtlich und gab ihm einen langen Kuss. »Also, dann frage deinen Freund Dieter mal aus. Er würde sich wohl doch wundern, wenn ich mich so brennend für den Patienten André Clermont interessiere.«
»Und auf fatale Gedanken kommen«, nickte Daniel. »Ich werde mich also beeilen, meine Besuche hinter mich zu bringen. Sprechstunde haben wir ja heute keine mehr. Und dann werde ich in die Klinik fahren. Allerdings hätte ich den Nachmittag lieber mit dir verbracht.«
»Ich muss sowieso mal wieder zum Friseur«, sagte Fee. »Morgen Abend kommt Isabel, und morgen habe ich keine Zeit.«
Er lächelte in sich hinein. Weil Isabel kommen würde, wollte Fee zum Friseur gehen. Seinetwegen brauchte sie das wahrhaftig nicht, denn ihm gefiel sie so, wie sie war, und wahrscheinlich würde ihr Haar morgen früh genauso aussehen wie jetzt, da es unter der Dusche doch nass werden würde.
Aber Fee wollte ja nicht nur zum Friseur. Sie wollte schnell einmal bei Isabel Guntram hineinschauen und sie einiges fragen.
Fee fuhr mit der S-Bahn in die Stadt. Den Wagen ließ sie am Bahnhof stehen. Es ging schneller und war bequemer mit der Bahn.
Parkplatzsorgen brauchte man da auch nicht zu haben, und sie konnte fast bis vor den Verlag fahren, in dem Isabel Redakteurin war.
Isabel war sehr überrascht, Fee zu sehen. »Jetzt sag nur nicht, dass ihr mich ausladen wollt?«, rief sie aus. »Ich habe mich schon so auf morgen gefreut.«
»Es bleibt auch dabei, Isabel«, erwiderte Fee, »aber ich wollte dich einiges fragen, was Daniel nicht zu wissen braucht.«
»Du interessierst dich für einen
anderen Mann?«, fragte sie konsterniert.
»Nicht so direkt. Ich kann dir keine nähere Erklärung geben, aber vielleicht weißt du mehr über ihn.«
»Wissenschaftler fallen nicht in mein Resort, aber gehen wir doch ins Archiv. Vielleicht finden wir da etwas über ihn.«
Sie gingen durch das Vorzimmer. Dort saß Sabine Moll, Mollys Tochter, inzwischen bereits Jungredakteurin geworden. Natürlich kannten sie sich, und Fee begrüßte das hübsche junge Mädchen freundlich, das sehr erstaunt zu sein schien, Frau Dr. Norden hier zu sehen.
»Sabine wird sich jetzt den Kopf zerbrechen, was du bei mir suchst, anstatt den freien Mittwochnachmittag mit deinem Göttergatten zu verbringen«, meinte Isabel neckend.
»Daniel muss noch Besuche machen, und ich wollte zum Friseur.«
»Du Glückliche brauchst doch keinen Friseur«, sagte Isabel.
»Eigentlich wollte ich auch zu dir, aber Daniel sollte nicht denken, dass ich neugierig bin.«
»Oder dich zu sehr für einen anderen Mann interessierst?«
»Er ist schwer krank«, entgegnete Fee errötend. »Es ist rein berufliches Interesse. Ich kenne ihn persönlich gar nicht.«
»Na, dann wollen wir mal sehen, ob wir etwas finden. Du meinst doch den Clermont, der den Selbstmordversuch gemacht hat?«
Es gab nicht viel, was Isabel nicht wusste, sobald die Zeitungen mal davon berichtet hatten. Ihr Gedächtnis war phänomenal.
Sie hatte auch bald gefunden, was sie suchte. »Robert Clermont, Chemiker, beging im Alter von dreiunddreißig Jahren Selbstmord durch Erschießen. Man nannte als Grund eine unglückliche Liebe zur Tochter seines Chefs, die die Verlobung gelöst hatte.«
»Das stand in der Zeitung?«, fragte Fee entsetzt.
»In verschiedenen, Fee. Sensationen sind das Brot der Reporter. Aber du interessierst dich doch für André Clermont.« Forschend ruhten ihre Augen auf Fees verwirrtem Gesicht.
»Sie waren Brüder.«
»Und es missfällt mir, dass der Ältere aus unglücklicher Liebe seinem Leben selbst ein Ende setzte? Da besteht doch ein Zusammenhang. Ich meine, du siehst Zusammenhänge, oder du weißt von ihnen.«
Isabel konnte man so leicht nichts vormachen. »Ich wusste nicht, dass damals Zeitungen darüber berichteten«, sagte Fee ausweichend.
»Das hat man bereits vergessen. Ich denke, dass sich kaum noch jemand an den Namen Clermont erinnert, denn André ist doch auch von der Bildfläche verschwunden gewesen. Sagtest du nicht, er sei ein Patient?« In ihren Augen brannte Wissbegierde.
»Du musst mir versprechen, dass du nichts darüber schreibst, Isabel«, sagte Fee flehend.
»Ich sagte dir schon, dass es nicht mein Ressort ist. Also kommen wir zu André Clermont. Was haben wir denn da? – Also, er ist drei Jahre jünger als sein Bruder und anscheinend ein Wunderknabe, denn er machte schon mit dreiundzwanzig Jahren seinen Doktor an der Sorbonne. Der Vater war elsässischer Landedelmann, verarmt durch einen Bankkrach.«
Obgleich Fee das schon wusste, unterbrach sie Isabel nicht, aber sie blickte über die Schulter, und sah die Fotografie eines noch jungen Mannes, der selbst auf diesem Zeitungsbild eine eigentümliche Faszination ausstrahlte.
»Fescher Bursche«, bemerkte Isabel beiläufig. »Man sagte ihm eine große Karriere voraus, aber er entpuppte sich als Einzelgänger, ein Veilchen, das im Verborgenen blühte. – Ja, was haben wir denn da? André Clermont ging nach Indien, ohne den Erfolg seines Selbstversuches materiell auszunutzen. Und dann, meine liebe Fee, schweigen sogar die Zeitungen über ihn. Und jetzt ist er hier?«
»Ja, er ist hier, aber ihm würde es sicher nicht lieb sein, wenn das bekannt würde, und manchem anderen auch nicht.«
»Ich bin zwar von Beruf aus neugierig, aber die Intimsphäre der Menschen, die sie gewahrt wissen wollen, ist mir heilig. Wenn es dich interessiert, werde ich mich bemühen, bis morgen noch mehr über André Clermont in Erfahrung zu bringen.
»Ich wäre dir dankbar. Ich bin in diesem Falle Vermittlerin oder Übermittlerin.«
»Und wenn du jetzt noch zum Friseur willst, musst du dich sputen, Fee«, sagte Isabel lächelnd. »Aber meinetwegen brauchst du dich nicht besonders schön machen zu lassen. Ich bekomme in deiner Nähe sowieso Komplexe.«
»So siehst du aus«, erwiderte Fee lächelnd.
Dass Isabel Guntram Komplexe bekommen könnte, war kaum vorzustellen. Sie war einfach perfekt, immer nach der neuesten Mode gekleidet und auch im Übrigen sehenswert. Gedankenvoll blickte sie der jungen Frau Dr. Norden nach. Und Fee gestand sich an diesem Nachmittag ehrlich und ohne Eifersucht ein, dass Isabel die einzige Frau gewesen wäre, die sie sich an Daniels Seite hätte vorstellen können. Aber sein Gefühl hatte sich für sie entschieden. Und nun schien sie ihre große Liebe in Dr. Jürgen Schoeller gefunden zu haben, der als Arzt ebenfalls auf der Insel der Hoffnung wirkte. Jedenfalls hoffte Fee, dass es bei beiden eine beständige und tiefe Liebe sein möge. Als Überraschung für Isabel würde jedenfalls Jürgen Schoeller morgen auch zu ihnen kommen.
Bei den beiden geht es noch langsamer zu als bei uns, dachte Fee, als sie unter der Friseurhaube saß. Aber bei Bettina Herzog und André Clermont ist es ein richtiges Drama. Ob sie überhaupt noch mal zusammenkommen? Konnte eine so attraktive Frau wie Bettina Herzog tatsächlich ein Leben lang einer Liebe nachtrauern?
*
Bettina hätte sich wohlfühlen können in dem schönen Appartement, das sie nun in der Pension Rosengarten bewohnte, aber da sie unentwegt an André dachte, fand sie auch in dieser schönen Umgebung keine innere Ruhe.
Sie hatte Frau von Rosen unterrichtet, dass sie eventuell einige Anrufe bekommen würde. Das war keine Schwierigkeit, denn jedes Appartement hatte sein eigenes Telefon. Die Zentrale wurde nachmittags von Cécile, der ältesten Tochter von Frau von Rosen, bedient. Sie war ein entzückendes Mädchen, wie Bettina schon hatte feststellen können. Um ihrer inneren Unruhe und Einsamkeit zu entfliehen, war Bettina hinuntergegangen in die Halle und fragte, ob sie einen Kaffee haben könne.
»Aber gern, Frau Herzog«, sagte Cécile höflich. »Soll er Ihnen auf dem Zimmer serviert werden?«
»Aber nein, ich trinke ihn gleich hier«, erwiderte Bettina.
»Dann hole ich ihn«, erklärte Cécile. »Unsere Jovanna ist mächtig erkältet. Ich habe gesagt, sie solle sich ein bisschen hinlegen.«
Jovanna war eine nette junge Kroatin, die Bettina schon kennengelernt hatte. Es berührte sie angenehm, dass Cécile so besorgt um sie war.
»Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, könnten Sie mir Gesellschaft leisten«, sagte Bettina zu dem jungen Mädchen. Ganz plötzlich verspürte sie Verlangen nach Gesellschaft.
»Nachmittags ist hier nicht viel los«, sagte Cécile. »Meistens wohnen Geschäftsleute hier, die den ganzen Tag unterwegs sind. Wir müssen uns ja auch ein bisschen darauf einstellen, sonst wird es für Mami einfach zu viel. Ist sowieso toll, wie sie es gepackt hat.«
»Aber Sie sind Ihrer Mutter ja schon eine tüchtige Hilfe«, sagte Bettina.
»Ich möchte es sein, aber nächstes Jahr wird es hart. Dann muss ich nämlich mein Abitur machen, und die beiden Kleinen können ja noch nicht helfen. Aber jetzt läuft das Geschäft schon. Vielleicht bekommen wir auch mal eine deutsche Jovanna, der nichts zu viel wird, und mit der die Gäste sich verständigen können.
»Wie alt sind Sie eigentlich, Cécile?«, fragte Bettina.
»Siebzehn. Gott sei Dank ist in der Schule alles glatt bei mir gegangen. Ein paar Jahre helfe ich Mami dann schon noch.«
»Und was haben Sie für Zukunftspläne?«
»Eigentlich hätte ich wahnsinnig gern Medizin studiert, aber das wird zu teuer. Vielleicht werde ich Fürsorgerin. Mami meinte jedenfalls, dass ich das Abitur auf alle Fälle haben müsste, damit mir später nichts verbaut ist. Sie ist großartig. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir solche Mutter haben. Sie hätte sich es doch nicht träumen lassen, dass sie sich mal auf eigene Füße stellen muss.«
»Ich habe meine Mutter früh verloren«, sagte Bettina gedankenvoll.
»Und wir unseren Vater. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass er jemals gesund war. Rede ich zu viel?«
»Nein, gar nicht. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen.«
Da läutete das Telefon. Cécile sprang auf und meldete sich.
»Für Sie, Frau Herzog«, sagte sie. »Soll ich es in die Zelle legen oder auf Ihr Zimmer?«
»Wer ist es denn?«
»Herr Herzog«, erwiderte Cécile.
»Sie brauchen nicht umzustellen«, sagte Bettina, dann nahm sie den Hörer ans Ohr.
»Nein, Daddy, noch gar nichts«, sagte sie leise. »Ich bleibe noch. Sei nicht böse. – Ja, du kannst mich jederzeit hier erreichen. – Danke, und mach dir keine Sorgen.«
»Sie haben eine fürsorgliche Mutter und ich einen fürsorglichen Vater«, sagte Bettina. »Er meint, dass ich nie erwachsen werde.«
»So sind gute Eltern immer«, sagte Cécile. »Mami macht sich auch hunderttausend Gedanken, wenn ich ihr ein bisschen Arbeit abnehme, und dabei brauche ich mich gar nicht anzustrengen. Ich müsste jetzt nur noch meine Hausaufgaben machen.«
»Kann ich dabei vielleicht helfen?«, fragte Bettina.
»Französisch ist mein schwächstes Fach«, erklärte Cécile seufzend.
»Und ausgerechnet da bin ich perfekt«, sagte Bettina lächelnd. »Dann versuchen wir es doch mal.«
*
Dr. Norden hatte seine Krankenbesuche hinter sich gebracht und war dann in die Behnisch-Klinik gefahren. Dr. Behnisch war beschäftigt, aber mit Jenny konnte er sprechen.
»Im Westen nichts Neues«, sagte sie.
»Besteht noch immer Lebensgefahr für Dr. Clermont?«
»Gebannt ist sie noch nicht. Das dauert noch mindestens fünf Tage. Vielleicht war es doch keine zufällige Infektion. Aber …« Sie unterbrach sich.
»Was, aber?«, fragte Dr. Norden.
»Er ist Biologe. Er hätte doch etwas unternommen, wenn er gewusst hätte, dass es um sein Leben geht. Er kennt alle pflanzlichen Gifte besser als jeder von uns.«
»War es ein pflanzliches Gift?«, fragte Daniel.
»Doch, das glaube ich mit Bestimmtheit. Dr. Clermont war auch Toxikologe. Ach, ich tappe im Dunkeln, und da kommen einem die rätselhaften Gedanken.«
»Sprechen Sie sich aus, Jenny, es interessiert mich.«
»Nach den erweiterten Pupillen und seinen Fieberfantasien hätte ich auf Atropa belladonna getippt, auf die Tollkirsche. Ich habe ewig überlegt, aber ich kann da keine Zusammenhänge finden. Er würde keine Tollkirsche essen und sich kein Atropin in Überdosis spritzen. Die Wirkungen sind erforscht.«
Sie machte eine kleine Pause. »Er spricht von einer Bettina, dann wieder von einer Laila, zusammenhanglos zwar, aber man könnte doch daraus schließen, dass diese beiden Frauen eine beträchtliche Rolle in seinem Leben gespielt haben!«
»Wieso?«, fragte Daniel lakonisch.
»Er fantasiert zwar, aber wenn er Bettina ruft, klingt es jammervoll, und wenn er Laila sagt … Es lässt sich schwer erklären, aber er bäumt sich dann immer auf. Er ist ein schwieriger Patient, bisher mein rätselhaftester. Ich möchte sagen, er ist nicht der Typ eines Selbstmörders. Wissen Sie, dass sein Bruder sich umgebracht hat?«
»Ja«, erwiderte Daniel lakonisch.
»Vielleicht wäre man geneigt zu sagen, es läge in der Familie, aber André Clermont ist ein genialer Wissenschaftler, der der Menschheit dienen will. Er vernichtet sich nicht selbst, davon bin ich überzeugt. Entweder ist es ein unglückseliger Zufall oder ein Mordversuch.«
»Jenny!«, rief Daniel erschrocken aus. Und dann trat ein langes Schweigen ein.
*
Bettina hatte sich mit Poldi in einem Restaurant verabredet. Er wartete schon auf sie. Er war in der Klinik gewesen, konnte ihr aber auch nichts anderes berichten, als sie schon von Fee erfahren hatte.
»Er ist jedenfalls in guten Händen. Da können wir beruhigt sein, Bettina. Diese Frau Dr. Lenz kennt sich aus mit solchen Infektionen, aber mir ist nicht klar, wie André dazu gekommen ist.«
Darüber zu rätseln war sinnlos. Bettina wollte jetzt auch über etwas anderes sprechen, was sie bisher noch nicht anzurühren gewagt hatte.
»Wie ist eigentlich Andrés finanzielle Situation?«, fragte sie.
»Anscheinend doch gut. Er macht nicht den Eindruck, als würde er Not leiden, und er konnte es sich leisten, in der gewiss nicht billigen Pension zu wohnen.« Poldi war immer gradeheraus.
»Ich weiß so wenig von ihm«, sagte Bettina leise.
»Ich auch, zumindest, was die letzten Jahre betrifft. Ich dachte doch auch schon, er sei verschollen.«
»Wie war eigentlich sein Verhältnis zu seiner Mutter nach Bobs Tod?«
»Keine Ahnung. Aber sie bevorzugte ja immer Bob, was mich erstaunte, da Mütter meist die jüngeren Kinder bevorzugen. Ich kann noch immer nicht begreifen, dass Bob damals so durchdrehte.«
Sollte sie Poldi die Wahrheit sagen? Nein, nicht die ganze!
»Meinetwegen hat er sich jedenfalls nicht umgebracht«, erwiderte sie mit einem Anflug von Bitterkeit.
»Wegen einer anderen?«
»Es ist nicht auszuschließen.« Sie hatte nie erfahren, wer jene andere Frau war, mit der sie Bob gesehen hatte.
Sie hatte sich oft gefragt, welche Rolle sie in seinem Leben, vielleicht auch in dieser bösen Affäre gespielt hatte. Aber sie hatte diese Frau nie wiedergesehen.
»Hast du mit Frau Dr. Norden gesprochen?«, fragte Poldi nun.
»Ja.«
»Redselig bist du nicht gerade, Bettina.«
»Es gibt noch nicht viel zu sagen.«
»Du machst dir selbst alles verdammt schwer, Mädchen. André ist mein Freund, aber dass er so viel Liebe verdient, wage ich nicht zu behaupten.«
»Vielleicht gibt es längst eine andere Frau in seinem Leben«, flüsterte sie.
»Nein, das glaube ich nicht. Das hätte er mir gesagt.«
»Habt ihr über mich gesprochen?«
»Ich habe es nicht gewagt, gleich am ersten Tag. Nun iss doch endlich etwas, Bettina. Es hat doch keinen Sinn, dass du dich kaputt machst.«
»Ich habe Angst um ihn«, sagte sie bebend.
*
Bettina war überrascht, als Fee sie am nächsten Morgen anrief und sie bat, sie doch am Vormittag in der Praxis aufzusuchen. Ihr Herz begann bange zu klopfen.
Als sie aber das Haus verlassen wollte, erlebte sie einen Schrecken, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Durch die Glastür sah sie einen Wagen ausländischen Modells, dem eine elegante Frau entstieg, und das leuchtend rote Haar weckte eine Erinnerung in ihr, die sich bestätigte, als diese Frau sich umdrehte.
Schnell wich Bettina in ihr Zimmer zurück. Wie kam jene Frau, die sie an Bobs Seite gesehen hatte, hierher? Was wollte sie?
Ihr war ganz schwindelig, aber sie nahm alle Kraft zusammen und presste ihr Ohr an die Tür.
Sie wollte hören, was diese Frau wollte. Sie durfte sich jetzt nicht gehenlassen.
Sie konnte zuerst nur Gemurmel vernehmen, dann aber wurde die helle Stimme der Frau lauter und erregter.
»Ich bin Frau Clermont. Bitte überzeugen Sie sich. Ich möchte ein paar Sachen für meinen Mann abholen. Würden Sie mir jetzt bitte sein Zimmer zeigen?«
Sie ist Andrés Frau, dachte Bettina mit heißem Erschrecken. Es war ihr, als würde eine gewaltige Faust ihre Kehle zusammenpressen.
»Ich verstehe nicht«, sagte jetzt Frau von Rosen. »Die Sachen von Herrn Dr. Clermont sind doch heute Morgen schon von Herrn Steiger abgeholt worden.«
Zitternd lehnte Bettina an der
Tür. Davon hatte Poldi ihr auch nichts gesagt. Was wurde da gespielt? Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen.
»So, Herr Steiger hat die Sachen bereits abgeholt, das wusste ich nicht«, sagte die helle Stimme. »Nun, es wird schon seine Richtigkeit haben. Herr Steiger ist ein Freund meines Mannes.«
Dann herrschte Stille, und bald darauf hörte Bettina, wie ein Motor aufheulte und der Wagen davonfuhr.
Schnell ging sie jetzt in die Halle. Frau von Rosen stand an der Rezeption. Geistesabwesend blickte sie Bettina an, um dann auszurufen: »Mein Gott, sind Sie krank? Sie sind ja weiß wie die Wand. Oh, es wäre schrecklich, wenn es doch eine ansteckende Krankheit wäre.«
»Ich bin nicht krank, Frau von Rosen«, sagte Bettina stockend. »Ich habe nur Kreislaufstörungen, deswegen fahre ich jetzt auch wieder zu Dr. Norden.«
»Ach, Sie sind bei ihm in Behandlung«, sagte Annette von Rosen. »Er ist ein guter Arzt. Entschuldigen Sie bitte meine Bemerkung, aber wir hatten vor ein paar Tagen einen rätselhaften Krankheitsfall. Sie können sich wohl vorstellen, dass ich jetzt sehr besorgt bin. – Merkwürdig«, fuhr sie dann geistesabwesend fort, »hoffentlich bekomme ich keine Schwierigkeiten.«
»Wegen dieses kranken Gastes?«, fragte Bettina, nun schon wieder gefasster.
»Wegen seiner Sachen. Sein Freund hat sie heute Morgen abgeholt, und eben kam seine Frau. Eine merkwürdige Frau. Ich muss um Verzeihung bitten, dass ich schwatze, aber manchmal fühle ich mich diesem Betrieb einfach nicht gewachsen. Nein, diese Frau passt ganz und gar nicht zu Dr. Clermont. Aber ich sollte mich einer persönlichen Ansicht wohl besser enthalten.«
Bettina hätte gern erfahren, warum Frau von Rosen dieser Ansicht war, aber dann hätte sie sich wohl doch verraten.
»Diese Frau ist mir unheimlich«, sagte Frau von Rosen seufzend.
Und Bettina hatte sie jede Hoffnung geraubt. Fee konnte es nicht entgehen, dass sie eine völlig Verzweifelte vor sich hatte.
»Sie sollten nicht so deprimiert sein, Frau Herzog«, sagte sie tröstend. »Wir haben erfahren, dass sich Dr. Clermonts Zustand sehr gebessert hat.«
»Weil seine Frau bei ihm ist?«, fragte Bettina tonlos.
»Seine Frau?«, rief Fee überrascht. »Davon weiß ich nichts. Das hätte Dr. Behnisch uns doch gesagt. Wie kommen Sie darauf?«
Bettina erklärte es ihr. Fee war fürs Erste sprachlos und zutiefst bestürzt. Sie überlegte dann, ob Isabel sich nicht doch getäuscht hätte.
»Ich muss schnell eine Freundin anrufen«, sagte sie zu Bettina. »Entschuldigen Sie bitte, aber ich brauche eine Auskunft.«
Sie hatte Glück und erreichte Isabel. Bettina hob lauschend den Kopf, als der Name Clermont fiel. Wieso erkundigte sich Fee Norden nach Bob?
»Es kann kein Irrtum sein?«, fragte Fee. Dann atmete sie auf.
»Deshalb bat ich Sie um Ihren Besuch, Frau Herzog. Frau Guntram ist Redakteurin. Sie rief mich gestern Abend an und sagte mir«, Fee unterbrach sich, »hoffentlich ist das nicht ein neuer Schock für Sie.«
»Jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen. Sie erwähnten Bob bei dem Gespräch?«
»Ja, Bob Clermont. Er war verheiratet.«
»Bob?«, stieß Bettina verblüfft hervor. »Bob war verheiratet?«
»Mit Laila Clifford. Die Ehe wurde vor vier Jahren geschlossen. Was ist Ihnen?«, fragte Fee dann erschrocken, denn Bettina sank in sich zusammen.
»Clifford«, flüsterte Bettina, »Laila Clifford. O mein Gott.«
»Kennen Sie diese Frau?«
Bettina schüttelte den Kopf. »Den Namen Clifford kenne ich. Dazu kann ich mich nicht äußern. Es ist alles so verworren. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch denken soll.«
»Nun, vielleicht ist André Clermont gar nicht verheiratet. Isabel sagte jedenfalls, dass darüber nichts bekannt ist.«
»Bob hat es ja auch verheimlicht«, sagte Bettina mit erstickter Stimme. »Das kann mich nicht treffen. Es gehört der Vergangenheit an. Er ist tot, er war doch ganz anders.«
»Ich möchte jetzt selbst erfahren, was an der ganzen Geschichte dran ist. Heute kommt Frau Guntram zu
uns. Sie weiß sehr viel, was wir nicht wissen. Kommen Sie auch. Unterhalten Sie sich mit ihr. Man soll nie auf halbem Wege stehen bleiben. Wenn die Tatsachen, die dann dabei herauskommen, auch schmerzlich für Sie sein mögen, so ist es doch besser, ganz klar zu sehen.«
»Ja, Sie mögen recht haben. Ich werde dann also kommen. Ich danke Ihnen sehr.«
*
Fee hatte darüber ganz vergessen, dass Dr. Jürgen Schoeller heute Abend auch kommen würde. Sollte sie ihm absagen?
Nein, dachte sie, dann macht er sich wieder hunderttausend Gedanken um Isabel. Er soll ruhig mal mitmachen, was wir so alles erleben.
Mitzumachen hatte auch Annette von Rosen noch allerhand, nachdem Bettina das Haus verlassen hatte. Bald darauf erschien ein junger Mann, der sie über Dr. Clermont ausfragen wollte.
Sie sagte, dass er nicht mehr in der Pension wohne. Zu mehr war sie nicht bereit. Nein, sie wollte sich nicht ausfragen lassen. Sie hatte jetzt das Gefühl, dass es viele Geheimnisse um diesen ihr so sympathischen Dr. Clermont gab. Da war ihre siebzehnjährige Tochter wohl klüger als sie. Cécile hatte gesagt, dass man Männern nie trauen dürfe, besonders so interessanten Männern nicht.
Annette von Rosen hatte den jungen Mann abwimmeln können, aber danach packte sie das heulende Elend.
»Ich schaffe es nicht«, murmelte sie vor sich hin. »Ich habe mir zu viel zugemutet. Die Kinder, dieses dauernde Kommen und Gehen …« Sie legte ihre Stirn auf die gefalteten Hände.
»Weltschmerz?«, fragte eine tiefe Männerstimme. Ihr Kopf ruckte empor. Sie sah in zwei gütige graue Augen, die sie durch eine goldgeränderte Brille anschauten. »Verzeihung«, stammelte sie. »Sie wünschen, bitte?«
»Mein Name ist Herzog. Meine Tochter wohnt bei Ihnen. Ist sie im Hause?«
Annette von Rosen schüttelte den Kopf und sah den hochgewachsenen Mann hilflos an.
»Frau Herzog hat das Haus vor einer Stunde verlassen. Sie ist zu Dr. Norden gefahren«, erwiderte sie stockend.
»Ich kann hier doch warten?«, fragte er und lächelte flüchtig. »Ärger mit dem Chef?«, fragte er dann.
»Der Chef bin ich«, erwiderte Annette deprimiert, »aber eben habe ich festgestellt, dass ich kein guter Chef bin.«
»Und warum nicht? Sind die Gäste nicht zufrieden oder zu anspruchsvoll?«
Annette sträubte sich dagegen, ihn sympathisch und vertrauenerweckend zu finden, und sie dachte an Cécile, die immer sagte, dass sie ein viel zu argloses Gemüt hätte. Aber Cécile war immerhin sehr begeistert von Bettina Herzog gewesen, und das schien Annette jetzt als Rechtfertigung dafür, dass sie Herrn Herzog vertrauenswürdig fand.
»Warum haben wir denn Kummer?«, fragte er gutmütig.
»Man hat so seine Sorgen«, erwiderte sie ausweichend.
»Vielleicht wegen Dr. Clermont?«
Schon wieder dieser Name! Annettes Augen weiteten sich schreckensvoll.
»Habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen?«, fragte Karl Herzog.
»Woher wissen Sie von Clermont?«, fragte Annette von Rosen atemlos.
Er stutzte nur kurz, dann griff er nach ihrer Hand, die nach einem Halt suchte.
»Reden wir doch mal offen miteinander. Meine Tochter hat anscheinend nicht verlauten lassen, dass sie wegen Dr. Clermont hier ist. Ich bin für Klarheit. Darf ich mich höflichst erkundigen, mit wem ich das Vergnügen habe?«
»Annette von Rosen. Mir gehört die Pension. Verzeihen Sie, dass ich mich nicht vorgestellt habe.«
»Gnädige Frau, es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen«, sagte Karl Herzog schmunzelnd.
Man hatte ihm immer bestätigt, dass er es wunderbar verstand, mit Menschen umzugehen. Er war ein vorbildlicher Chef, er hielt die Fäden immer in der Hand. Einmal hatte er sich in einem Menschen restlos getäuscht, das war Bob Clermont gewesen, aber er war weit davon entfernt, nun gegen alle und jeden misstrauisch zu sein, denn welchem Menschen blieben Irrtümer erspart?
Durch die Halle schallte plötzlich der Ruf: »Daddy!« Er stand auf, Bettina fiel ihm um den Hals. »O Daddy, wusstest du, wie nötig ich dich brauche?«, flüsterte sie.
»Intuition, mein Herzblatt«, erwiderte er, und Annette von Rosen nahm zur Kenntnis, wie zärtlich dieser Mann seine Tochter umarmte. »Du hast dir wohl ein wenig zu viel zugemutet, mein Kleinchen«, fuhr er fort. Dann wandte er sich zu Annette von Rosen um. »Haben Sie ein Zimmer für mich? Ich möchte bleiben.«
»Dr. Clermonts ist freigegeben«, erwiderte Annette von Rosen stockend. »Wenn Sie das nehmen wollen?«
»Aber mit ganz besonderem Vergnügen«, erwiderte er.
Bettina weigerte sich, das Zimmer zu betreten, das bereits gereinigt worden war.
»Mir wäre es lieber, wir würden gleich heute Abend abreisen, Daddy«, sagte sie. »Ich muss nur noch eineVerabredung wahrnehmen.«
»Warum plötzlich diese Hast? Ich habe mich extra freigemacht. Ich möchte bleiben«, erklärte Karl Herzog.
»Du weißt nicht alles.«
»Dann möchte ich es erfahren, Bébé.«
Es gab ihr einen schmerzenden Stich, als er sie mit diesem Namen ansprach, den auch André für sie gehabt hatte, als sie sich ihre Liebe gestanden.
Er kann doch nicht genauso wie Bob gewesen sein, dachte sie.
»Erzähle«, wurde sie von ihrem Vater aufgefordert.
Sie verschlang die Hände ineinander. »Was hast du Frau von Rosen gesagt?«, fragte sie.
»Wir haben uns sehr nett unterhalten. Ich traf sie in Tränen aufgelöst, weil sie auch nichts als Schwierigkeiten mit André Clermont hat. Bitte, jetzt keine Sentimentalitäten, Bébé. Lass deinen Verstand sprechen.«
»Dann sag nicht Bébé zu mir«, schluchzte sie auf.
Augenblicklich fühlte er sich hilflos. Er konnte es nicht ertragen, wenn sein Kind weinte, und für ihn blieb Bettina das Kind, das er über alles liebte, dem er jeden Wunsch erfüllt hätte.
Er war über seinen Schatten gesprungen, als sie ihn damals bat, die üble Affäre um Bob zu vertuschen. André zuliebe hatte sie es gewollt, aber musste sie dafür nicht heute noch bezahlen?
Stockend erzählte sie ihm dann alles.
Er unterbrach sie nicht. Sein Gesicht verdüsterte sich immer mehr, und es trat minutenlanges Schweigen ein, als sie alles berichtet hatte.
»Gut«, sagte er nachdenklich, »ich war immer voller Misstrauen, aber eines weiß ich gewiss, mit aller Bestimmtheit.«
»Was?«, fiel Bettina ihm ins Wort.
»Dass diese Frau, die heute hier war, nicht Andrés Frau ist.«
»Woher weißt du das?«, fragte Bettina erregt.
»Nun mal ruhig, meine Kleine. Ich habe drei Jahre lang Detektive beschäftigt, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich habe nicht immer das erfahren, was ich erfahren wollte, aber die Spur von Bobs Frau haben sie doch gefunden und verfolgt. Und es war seine Frau Laila, die sie bis hierher verfolgt haben. Ich bekam gestern einen Anruf, dass sie sich in München aufhält. Ich bin sofort gestartet und habe heute Vormittag erfahren, dass sie die Pension Rosengarten aufgesucht hat. Ich hoffe, dass sie jetzt an ihren Fersen bleiben.«
Bettina starrte ihren Vater an. »Es war Bobs Frau, nicht Andrés?«, fragte sie stockend.
»Sie heißt Clermont, und so kann sie natürlich leicht lügen. Es ist eine gefährliche Frau, die vor nichts zurückschreckt.«
»Sie hieß Clifford«, flüsterte Bettina.
»Das weiß du?«, fragte Karl Herzog überrascht.
»Frau Dr. Norden hat es mir gesagt. Sie hat Verbindung zu einer Journalistin, die Erkundigungen eingezogen hat.«
»Wie interessant. So werden wir ein Steinchen an das andere fügen, bis das Puzzlespiel vollkommen ist. Jetzt gebe ich keine Ruhe mehr, damit du endlich deine Ruhe findest, mein Kind. Außerdem gefällt es mir sehr
gut hier, und die arme kleine Frau von Rosen braucht auch ein bisschen seelische Aufrüstung.«
»O je, Cécile wird von mir enttäuscht sein. Ich wollte doch französische Konversation mit ihr treiben.«
»Das kannst du doch, oder wir können es zu dritt. Mir tut es auch ganz gut, wenn ich meine Sprachkenntnisse auffrische, falls ich dann auch noch ins Elsass fahren muss.«
»Wozu?«
»Um alles über die Familie Clermont herauszubekommen.«
»Solltest du dich nicht mehr für die Familie Clifford interessieren?«
»O nein, ich weiß, dass Clifford die Forschungsergebnisse an sich bringen wollte. Aber er kann sie nicht verwerten. Er hat nicht die nötigen Leute, die diese Forschung zu Ende führen. Er hat die letzte Formel nicht. Bob hat es vorgezogen, sich vorher doch lieber umzubringen. Ich habe mich schwer in ihm getäuscht, Bettina. Du glaubst nicht, wie sehr es mich treffen würde, wenn du dich in André auch getäuscht haben solltest, denn ich bin überzeugt, dass er wusste, was sein Bruder getan hat. Aber ich habe niemals angenommen, dass er es billigte.«
*
Dr. Jenny Lenz war im Laufschritt zu André Clermonts Zimmer geeilt, als man sie benachrichtigt hatte, dass er bei Bewusstsein sei.
Er lag mit weit offenen Augen im Bett. Sein Arm zuckte zurück, als sie nach seinem Puls greifen wollte.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Dr. Lenz, die Assistentin von Dr. Behnisch«, erwiderte sie. »Ihm gehört die Klinik.«
»Und warum bin ich hier?«, fragte er. »Ich hasse Krankenhäuser.«
»Es ist eine Privatklinik, und wenn Sie nicht hier wären, lägen Sie jetzt in einem kühlen Grab.«
Es bewies sich wieder einmal, dass Jenny Lenz den richtigen Ton fand für jeden Patienten, wenn dieser auch brutal klingen mochte.
»Was habe ich?«, fragte André Clermont friedfertiger.
»Eine lebensbedrohende Sepsis, und ich möchte Ihnen gleich sagen, dass Sie noch nicht über den Berg sind.«
Er schien erst jetzt zu bemerken, dass sein Arm bis zur Beuge verbunden war.
»Was ist das?«, fragte er heiser.
»Ja, darüber rätseln wir auch noch nach. Vielleicht können Sie uns sagen, was Sie angestellt haben?«
»Was sollte ich angestellt haben?«
»Sie hatten eine Wunde an der Hand.«
»Den Stich? Den habe ich mit antiseptischer Salbe behandelt.«
»Und innen hat sich ein Fäulnisherd gebildet, hochgeehrter Herr Dr. Clermont«, sagte Jenny Lenz. »Das ist Ihnen wohl entgangen?«
»Die Wunde heilte schlecht.« Er sah sie gedankenvoll an. Sein Blick wurde lebhafter. »Ich wusste auch nicht warum.«
»Es hätte leicht böse Folgen haben können. Hatte es ja auch schon. Woran haben Sie sich infiziert, Herr Dr. Clermont?«
»Ich weiß es nicht.«
Als er es aussprach, kamen ihm seltsame Gedanken, aber sie überstürzten sich und waren viel zu wirr, als dass er einen Sinn darin hätte finden können.
»Sie haben sich diese Wunde nicht selbst beigebracht?«, fragte Jenny.
»Ich bin doch kein Selbstmörder«, murmelte er.
»Sie haben aber schon mal einen Selbstversuch gemacht«, sagte sie ruhig.
»Da hatte ich das Serum. Ich musste es ausprobieren. An wem sonst hätte ich es erproben sollen?«
»Und wenn es da schiefgegangen wäre?«
»Dann hätte ich Pech gehabt, aber es ging für mich um viel. Nein, nicht für mich, für viele andere Menschen. Aber wenn man einmal solche Schmerzen erlitten hat, versucht man es ein zweites Mal nicht mehr.«
»Hatten Sie jetzt Schmerzen?«, fragte sie weiter.
»Jetzt? Nein, ich war wie betäubt.«
»Wann fühlten Sie sich wie betäubt?«, fragte sie drängend.
»Wann? Ich weiß nicht. Ich muss überlegen.«
Jenny sah ihn gedankenvoll an.
»Ich war einige Jahre in Uganda. Dort habe ich erlebt, dass Menschen sich an Pflanzen infizierten und daran starben. Aber alles an Symptomen stimmt bei den Ihren nicht überein.«
»Und Sie wollen es ganz genau wissen«, sagte er sarkastisch.
»Jetzt sind Sie wieder ganz schön munter. Ja, ich will es ganz genau wissen.«
»Worauf deuteten die Symptome bei mir?«, fragte André.
»Auf Atropin, allerdings in einer Überdosis. So, als hätten Sie mindesten zehn Tollkirschen gegessen.«
»Sie sind ganz schön makaber«, sagte Andre.
»Ich glaube nicht, dass man Ihnen anders beikommen kann. Atropin erzeugt Wahnideen.«
»Habe ich fantasiert?«, fragte er erschrocken.
»Auch, aber wenn man über vierzig Fieber hat, bleibt das nicht aus. Vielleicht helfen Sie mir doch weiter, Herr Dr. Clermont. Ich gehe auch gern ins Detail, genau wie Sie.«
»Vielleicht habe ich mich irgendwo gerissen?«
Seine Stimme sank zum Flüstern hinab. »Es sind schon viele Menschen an einem verrosteten Nagel gestorben. Tetanusbazillen«, seine Stimme wurde schleppend. »Es war kein Nagel, eine Nadel, eine Nadel, eine Nadel –« Und dann fielen seine Augen zu, und Dr. Jenny Lenz blickte gedankenvoll in das erschöpfte Gesicht.
»Es war eine Nadel«, sagte sie zu sich selbst, als sie den Gang entlangging.
»Was für eine Nadel?«, fragte eine Männerstimme hinter ihr.
Sie drehte sich schnell um und sah in Dieter Behnischs freundliches Gesicht.
»Führe ich mal wieder Selbstgespräche?«, fragte sie.
»Sie haben von einer Nadel geredet.«
»Dr. Clermont hat von einer Nadel geredet, aber ich finde keinen Zusammenhang. Wie viel Gift kann man in eine Nadel praktizieren, das tödlich ist?«
»Wohin versteigen sich Ihre Gedanken? Wollen Sie den Borgias Konkurrenz machen?«, fragte er anzüglich.
»Sie wissen genau, worauf ich hinauswill«, begehrte sie auf.
»Es kommt auf das Gift an, aber die Dosis war nicht tödlich, wenn ich Sie darauf aufmerksam machen darf, Frau Dr. Lenz.«
»Ich muss nachdenken«, sagte sie gedankenverloren. »Atropin ruft Wahnideen hervor, die aber wieder abklingen. Wenn man nur etwas von ihm in Erfahrung bringen wollte? Ihn gefügig machen wollte?«
»Sie wissen für alles eine Erklärung«, brummte Dieter Behnisch.
»Nein, eine weiß ich nicht. Aber ich muss es herausfinden. Es lässt mir keine Ruhe.«
»Wie wär’s denn mit einer kleinen Dosis Heroin durch eine rostige Nadel?«, fragte er hintergründig.
Sie starrte ihn an. »Damit scherzt man nicht«, sagte sie zornig.
»Mir ist jedenfalls nicht danach zumute.«
Mit sich selbst unzufrieden ging
Dr. Behnisch in Dr. Clermonts Zimmer.
Der Kranke warf sich unruhig hin und her. Unverständliche Worte kamen über seine Lippen, und zu gern hätte Dr. Behnisch gewusst, was hinter dieser hohen schweißbedeckten Stirn vor sich ging.
*
Molly konnte es auf den Tod nicht leiden, wenn jemand darauf pochte, als Privatpatient bevorzugt behandelt zu werden. Einen Vormittag und einen Nachmittag in jeder Woche hielten sie für Voranmeldungen frei. Das sagte sie auch der eleganten jungen Frau, die gegen vier Uhr in der Praxis erschien und sofort von Dr. Norden empfangen zu werden wünschte.
»Ich habe ein sehr wichtiges Anliegen, das keinen Aufschub duldet«, erklärte die Fremde, deren halblanges, glänzendes blauschwarzes Haar den Verdacht in Molly aufkommen ließ, dass sie eine Perücke trüge. Die Kleidung verriet Eleganz, dafür hatte Molly einen Blick.
»Sagen Sie Dr. Norden, dass ich im Auftrag von Dr. Clermont komme«, erklärte die Besucherin.
Der Name war nun auch Molly schon wohlbekannt, denn von ihrer Tochter Sabine hatte sie doch manches erfahren.
So wenig sympathisch ihr die angebliche Patientin auch war, beschloss sie doch, Dr. Norden zu informieren. Fee war augenblicklich nicht anwesend. Sie machte einen Besuch bei einem kranken Kind.
»Ein paar Minuten müssen Sie sich aber gedulden«, sagte Molly dann unwillig. »Der Herr Doktor ist noch beschäftigt.«
Die Fremde setzte sich und griff nach ihrem Zigarettenetui.
»Rauchen ist hier nicht erlaubt«, zischte Molly gereizt.
»Sind Sie immer so freundlich?«, fragte die Fremde zynisch.
Molly blieb die Antwort schuldig und dann geleitete Dr. Norden seinen Patienten auch schon wieder zurück zur Tür.
»Also übermorgen, Herr Jung«, sagte er. »Nicht vergessen.«
»Bestimmt nicht, Herr Doktor. Vielen Dank«, entgegnete der alte Herr Jung.
»Das ist die Dame«, sagte Molly giftig. Dr. Norden grinste zu ihr hinüber. Dann bat er die Fremde mit einer Handbewegung in sein Sprechzimmer.
Sie glaubte anscheinend, ihn mit ihrem verführerischen Augenaufschlag beglücken zu können, aber dafür war Daniel unempfindlich.
»Wo fehlt es?«, fragte er leger. »Einen Auftrag konnte Dr. Clermont Ihnen doch kaum geben, da er noch keine Besuche empfangen darf.«
Er hatte nicht die Absicht, sich lange mit der Fremden, die noch immer nicht ihren Namen genannt hatte, aufzuhalten.
»Es war eine kleine Notlüge«, sagte sie mit einem verzeihungheischenden Lächeln. »Ich habe gehört, dass Sie Dr. Clermont in die Behnisch-Klinik gebracht haben. Dort wollte man mir keine Auskunft geben, was ihm fehlt. Ich möchte es gern von Ihnen erfahren.«
»Darf ich um Ihre Legitimation bitten?«, fragte Daniel kühl.
»Um meine Legitimation?«, fragte sie pikiert.
»Sie haben sich noch nicht einmal vorgestellt und erwarten von mir, dass ich Auskünfte gebe, die mir meine Schweigepflicht verbieten.«
»Mein Name ist Clifford, und ich bin eine nahe Verwandte von Dr. Clermont. Genügt Ihnen das?«
»Wenn Sie das Dr. Behnisch sagen, wird er Ihnen die Auskünfte geben, die Ihnen wichtig sind. Er ist der zuständige Arzt.«
»Herr Dr. Norden, ich bitte Sie um Verständnis. Ich fürchte, dass man mich mit Halbwahrheiten abspeisen wird, wie das mit nahen Verwandten gehandhabt wird, wenn der Patient in Lebensgefahr schwebt. Ich will André in den allerbesten Händen wissen. Dabei will ich Ihren Kollegen Behnisch nicht kränken. Sicher tut er, was in seiner Macht steht, aber es gibt Kapazitäten. Ich bitte um Ihre Unterstützung.«
Daniels Augen verengten sich. Für wie dumm hält sie mich eigentlich, dachte er.
»Wer hat Ihnen denn gesagt, dass Dr. Clermont in Lebensgefahr schwebt?«, fragte er. »So viel kann ich Ihnen jedenfalls sagen, dass er sich bereits auf dem Wege der Besserung befindet. Und besser versorgt werden kann er gar nicht. Er kann auch sehr gut selbst entscheiden, ob er in eine andere Klinik verlegt werden will.«
»Ist er denn ansprechbar?«, fragte sie erregt.
»Lassen Sie sich bitte von Dr. Behnisch informieren, Frau Clifford«, sagte Daniel ruhig. »Ich bin nicht zuständig.«
Ihre schlanken wohlgepflegten Finger zupften an ihren Haaren herum.
»Man kann als besorgte Frau anscheinend auch von einem Arzt kein Verständnis mehr erwarten«, sagte sie in beleidigtem Ton.
»Verständnis wofür?«, fragte Daniel spöttisch. Und das konnte Molly glücklicherweise hören, da er die Tür schon geöffnet hatte. Sie sah sehr zufrieden aus, als Frau Clifford an ihr vorbeigehuscht war und die Tür recht heftig hinter sich zuwarf.
»Ich bin nur froh, dass sie Ihnen auch nicht sympathisch war«, sagte sie mit einem erleichterten Lachen.
»Wir sind noch immer der gleichen Meinung, Molly«, bemerkte Daniel schmunzelnd.
»Fast immer, wollen wir mal sagen«, brummte sie. Aber worüber er nachdachte, konnte sie doch nicht ergründen. Er fühlte sich jedenfalls veranlasst, sofort Dr. Behnisch anzurufen.
*
»Das war ein turbulenter Tag«, sagte Fee erschöpft, als sie abgehetzt in die Praxis zurückkam. »Unterwegs musste ich noch Erste Hilfe bei einem Unfall leisten.«
»Schlimm?«, fragte Daniel besorgt.
»Es ging. Chirurg möchte ich nicht sein. Es ist spät geworden, Dan, wir haben heute Abend Gäste.«
»Bedauernswerte Leute, die von einem Ärzteehepaar eingeladen werden. Aber Isabel hat Verständnis dafür, und Jürgen wird bestimmt mit Verspätung kommen.«
»Ich habe auch Bettina Herzog eingeladen«, sagte Fee kleinlaut. »An Jürgen habe ich gar nicht mehr gedacht.«
»Warum hast du sie eingeladen?«, fragte er.
»Damit sie mal mit Isabel sprechen kann. Es hat sich allerhand getan.«
»Bei mir auch. Ich hatte den Besuch einer recht seltsamen Dame mit Namen Clifford.«
»Clifford?«, rief Fee aus. »Bob Clermonts Frau?«
»Das ist mir neu, aber du weißt ja anscheinend immer mehr als ich.«
»Laila Clifford«, sagte Fee gedankenvoll. »Ich habe heute noch mal mit Isabel telefoniert, als Bettina Herzog bei mir war.«
»Was ich alles so nebenbei erfahre«, sagte er anzüglich.
»Jetzt bin ich selbst schon durcheinander, Dan. Können wir uns auf unsere Gäste vorbereiten?«
»Wie?«
»Wir können uns doch beim Umkleiden unterhalten«, meinte sie.
»Na schön. Aber eins möchte
ich doch bemerken, ich habe mit Isabel in einem Monat nicht so oft telefoniert wie du innerhalb von zwei Tagen.«
»Das möchte ich dir auch geraten haben, mein Herzallerliebster«, lachte Fee.
*
Bettina und Karl Herzog hatten den Nachmittag mit Cécile verbracht, und der war so unterhaltsam geworden, dass Bettina wenigstens für eine Zeit auf andere Gedanken gebracht wurde.
Das hatte ihr Vater auch beabsichtigt, aber ihm bereitete es sichtliches Vergnügen, mit der jungen, unbefangenen Cécile zu lachen und zu plaudern.
Schließlich tauchten auch noch Thomas und Alexander auf, dreizehn und zehn Jahre jung und richtige Lausbuben, die bloß mal sehen wollten, was hier los war.
Karl Herzog konnte sich gut vorstellen, dass es ihre Mutter allerhand Kraft kostete, mit den beiden fertigzuwerden. Auch hier zeigten sie sich nicht gerade von ihrer freundlichsten Seite. Sie stritten sich auf Teufel komm raus.
»Ich habe nichts dagegen, wenn ihr hier seid, aber gestritten wird nicht«, sagte Karl Herzog energisch, nachdem Cécile ihre beiden Brüder vergeblich ermahnt hatte.
Das verschlug ihnen die Stimme. »Hast du hier was zu sagen?«, fragte Thomas.
»Allerdings. Ich bezahle dafür, dass ich meine Ruhe habe«, erwiderte Karl Herzog, »und eure Mutter rackert sich ab, damit es euch gut geht.«
»Stimmt das, Cécile?«, fragte Alexander.
»Ja, das stimmt. So deutlich hat es bisher leider noch keiner gesagt.«
»Das war aber sehr deutlich«, meinte Thomas und betrachtete Karl Herzog ehrfürchtig. »Mei, das ist ein Mann!«
»Habt ihr euch wieder recht aufgeführt?«, fragte Annettes Stimme von der Treppe her. Eine müde Stimme, die Mitgefühl erregen konnte.
»Trauen wir uns nicht, Mami«, erklärte Alexander.
»Jetzt nicht mehr«, fügte Thomas schüchtern hinzu. »Hier kommandiert einer.«
»Nicht gern, wenn es nicht nötig wäre«, sagte Karl Herzog. »Ihr Burschen solltet mehr Rücksicht auf eure Mutter nehmen.«
»Mami«, berichtete Alexander, »wenn wir doch keinen Vater mehr haben, können wir doch nichts dafür.«
»Seid froh, dass ihr eine so liebe Mami habt«, warf Bettina ein. »Ich hatte keine.«
»Sind wir doch auch. Aber Mami schimpft nie.«
»Sie hat ja keine Zeit für uns«, beklagte sich Thomas.
»Und warum nicht?«, fragte Karl Herzog.
»Weil kein Mann im Hause ist, der diesen Rabauken Respekt beibringt«, warf Cécile ein.
»Vor dem da haben wir aber Respekt«, sagte Alexander. »Wir streiten ja nicht mehr. Wer bist du denn?«
»Ein Gast, und nun entschuldigt euch bitte«, sagte Annette. »Herr Herzog reist sonst gleich wieder
ab.«
»Ein Herzog bist du?«, staunte Thomas. »Jemine, das ist ein Ding. Unser Vater war bloß Baron.«
»Und ich heiße nur so. Ich bin kein Herzog«, sagte der Mann lächelnd.
»Ist auch besser so«, meinte Thomas nach kurzem Überlegen. »Mit den Adligen fallen wir bloß rein. Die machen immer Schulden.«
»Tom, benimm dich«, sagte Annette von Rosen aufgebracht. »Was soll Herr Herzog denken?«
»Was gewiss ist«, erklärte Thomas. »Das sind nämlich immer Freunde von Papa und die denken, die können umsonst bei uns wohnen, und Mami zahlt drauf.«
»Es tut mir leid«, sagte Annette erschüttert. »Meine Söhne sind schrecklich vorlaut.«
»Aber ehrlich«, sagte Karl Herzog. »Regen Sie sich nicht auf, gnädige Frau. Ich komme schon mit ihnen zurecht.«
»Und wenn Mami ganz ungnädig wird?«, erkundigte sich Alexander.
»Dann bringe ich euch zu Bett«, erwiderte Karl Herzog.
Mit weiten Augen und offenen Mündern starrten die beiden ihn an.
»Ganz wirklich?«, fragte Thomas.
»Und wehe euch, wenn ihr widersprecht.« Er blinzelte Bettina zu, und jetzt musste sie sich doch ein Lachen verkneifen.
Er wäre ein richtiger Bubenvater gewesen, dachte sie, und als sie nun Annette einen Blick zuwarf, kam ihr ein ganz merkwürdiger Gedanke.
Er mag sie, ging es ihr durch den Sinn, und ich mag sie auch, allesamt. Wäre es nicht schön für Daddy, so viel Leben um sich zu haben? Anscheinend gefällt ihm das doch sehr.
»Musst du nicht aufbrechen, Bettina?«, fragte da der Vater.
Erschrocken stieß Thomas an. »Daddy sagt sie zu ihm«, erklärte er lautstark. »Dabei ist sie schon erwachsen.«
»Jetzt kriegt ihr aber eine von mir geschmiert«, sagte Cécile wütend.
»Versuch’s doch mal. Mal sehen, wer stärker ist«, gab Thomas aufgebracht zurück. »Du Zimperliese!«
»Das machen wir ganz anders«, unterbrach Karl Herzog die Aufgebrachten. »Ich werde diese beiden Burschen mal ins Gebet nehmen. Karl Herzog heiße ich, habt ihr verstanden?«
»Herzog Karl«, murmelte Thomas, »Xander, jetzt setzt es was.«
»Versuchen wir es erst mal mit Vernunft«, lenkte Karl Herzog ein.
»Da beißen Sie aber auf Granit«, seufzte Cécile.
»Wetten wir?«, fragte Karl Herzog verschmitzt. »Wohin gehören die beiden?«
»Ich zeig’s dir schon, Herzog Karl«, flüsterte Alexander. »Brauchst nicht zu hauen. Entschuldige vielmals, Mami.«
»Hab’ es nicht so gemeint, Mami«, schloss Thomas sich an.
»Na, wer sagt’s denn«, meinte Karl Herzog hintergründig. »Marsch, marsch, Kameraden.«
»Mir ist es schrecklich peinlich«, flüsterte Annette.
»Warum? Mir macht es Spaß, gnädige Frau.«
Alexander drehte sich um. »Du kennst Mami noch nicht, wenn sie ungnädig wird. Dann funkt es auch.«
»Aber anscheinend hält es nicht vor«, sagte Karl Herzog.
Annette brach wieder in Tränen aus, als das Dreigespann ihren Blicken entschwunden war.
»Ich schaffe es doch nicht, Cécile«, flüsterte sie.
»Das habe ich mir gedacht, Mami. Reg dich jetzt nicht so auf. Herr Herzog wird die beiden schon auf Vordermann bringen. Ein toller Mann. Wenn er ein bisschen jünger wäre, würde ich mich in ihn verlieben.«
»Cécile!«, stöhnte Annette auf.
»Ich bleibe ja auf dem Boden, Mami, aber könntest du dich nicht in ihn verlieben?«
»Allmächtiger, was habe ich für Kinder!«, sagte Annette gottergeben.
»Sehr nette Kinder«, tönte Bettinas Stimme durch die Halle. »Beruhigen Sie sich doch, Frau von Rosen. Mein Vater liebt Kinder. Er ist ganz in seinem Element. Er fühlt sich, auf gut Deutsch gesagt, sauwohl. Wenn Sie ihm noch ein gutes Abendessen vorsetzen könnten, werden Sie ihn so schnell nicht wieder los.«
Und während Bettina sich auf den Weg zu den Nordens machte, erlebte es Annette von Rosen, dass ihre Lausbuben die reinsten Engel waren. Dabei brauchte Karl Herzog gar nicht mit Strafandrohungen zu agieren. Er imponierte ihnen gewaltig in seiner durchaus freundlichen Bestimmheit. Cécile war restlos von ihm begeistert. Zum ersten Mal schwärmte sie für einen Mann.
Als Bettina das Haus betrat, stand vor dem Lift ein Mann, der ihr höflich den Vortritt ließ und dann kurz zögerte.
»Ich denke, dass wir beide Platz haben«, sagte Bettina mit leicht heiserer Stimme, was aber von ihrer inneren Erregung herrührte.
Sie fing dann einen überraschten Blick auf, als sie auf den obersten Knopf drückte.
»Auch zu Dr. Norden?«, fragte er verlegen. Bettina nickte.
»Schoeller«, stellte er sich vor.
»Bettina Herzog.«
Sie sahen sich wieder an und lächelten flüchtig. Dann waren sie schon oben angelangt, bevor Bettina noch darüber nachdenken konnte, ob es eine größere Gesellschaft werden würde.
Isabel öffnete die Tür. Das Staunen war dreifach. »Jürgen!«, rief Isabel aus, aber dann musterte sie erst ganz schnell Bettina.
»Ihr Heimlichtuer, ihr habt mir nicht verraten, dass Jürgen kommt«, sagte Isabel lebhaft und überbrückte damit die ersten Hemmungen von Bettina.
So gerne sie nun auch allein mit Jürgen geplaudert hätte, denn sie hatten sich sehr viel zu sagen, fand sie Bettina Herzog doch interessiert genug, um ihr Aufmerksamkeit zu widmen.
Lenchen hatte mal wieder Köstlichkeiten aufgetischt, Daniel seinen besten Wein bereitgestellt. In gelockerter Stimmung kam man sich schnell näher, und ehe Bettina es sich versah, waren ihre Probleme gar nicht mehr so erdrückend.
Sie sprach mit Daniel, dann mit Isabel. Sie erfuhr Dinge, von denen sie bisher keine Ahnung hatte, und die wieder Hoffnung in ihr keimen ließen. Sie erfuhr auch von Laila Cliffords Besuch bei Daniel, wurde dann aber stutzig, als er sie als schwarzhaarig bezeichnete. Da schüttelte sie den Kopf.
»Sie hat rotes Haar«, sagte sie leise.
»Molly meinte, dass sie eine Perücke trüge«, erklärte Daniel. »Sie will sich anscheinend tarnen, und meiner Meinung nach sollte man vor ihr auf der Hut sein.«
»Was mag sie jetzt nur bezwecken?«, überlegte Bettina. »Warum wollte sie Andrés Sachen aus der Pension holen?«
»Vielleicht sucht sie etwas«, sagte Daniel.
»So viel ich auch überlege, ich finde keine Erklärung, welche Rolle sie spielt«, meinte Bettina.
»Jedenfalls wissen wir, dass sie mit Bob Clermont verheiratet war. Sie wurden vor vier Jahren in Paris getraut«, warf Isabel ein.
»Sie wissen das bestimmt?«, fragte Bettina.
»Ich habe gute Verbindungen. Es war ein zehnter März.«
»Und am ersten April trat er seine Stellung bei uns an«, sagte Bettina leise. »Seine Frau trat nie in Erscheinung. Er gab sich ganz als Junggeselle. Sonst hätte ich mich ja kaum mit ihm verlobt«, fügte sie sarkastisch hinzu.
»Das alles muss ein fest umrissener Plan gewesen sein«, sagte Isabel nachdenklich.
»Ein abscheulicher Plan«, flüsterte Bettina. »Mein Vater wird es sich nicht verzeihen, dass er Bob traute. Er ist übrigens heute gekommen«, fügte sie gepresst hinzu.
»Warum haben Sie ihn nicht mitgebracht?«, fragte Fee.
»Das ginge wohl doch ein wenig zu weit«, meinte Bettina errötend. »Er ist außerdem mit Frau von Rosens Söhnen sehr beschäftigt. Frau von Rosen war ganz außer sich wegen dieser Begebenheiten. Wieso Poldi Andrés Sachen abgeholt hat, weiß ich noch immer nicht. Ich konnte ihn nicht erreichen.«
Fee runzelte die Stirn. »Misstrauen Sie ihm auch?«, fragte sie.
»Es wäre schrecklich, wenn ich das müsste«, seufzte Bettina. »Aber vielleicht weiß er viel mehr, als ich annehme.«
Isabel wandte sich Jürgen zu. »Fein, dass du gekommen bist. Kannst du ein paar Tage bleiben?«
»Ein verlängertes Wochenende«, nickte er. »Ich muss einiges in München erledigen.«
»Wirst hoffentlich aber auch Zeit für mich haben?«
»Es liegt bei dir, ob du Zeit hast.«
»Ich nehme sie mir.«
Sie waren beide Menschen, die ihre Gefühle nicht auf die Lippen trugen, und so verschieden sie auch waren, ergänzten sie sich doch großartig. Für sie galt das Sprichwort, dass Gegensätze sich anziehen, hundertprozentig.
Wehmut überkam Bettina, wenn sie in die glücklichen Gesichter dieser vier Menschen blickte. Wie sehr sehnte sie sich danach, auch einmal wieder glücklich zu sein, aber würde das je der Fall sein? Ihre Gedanken waren jetzt wieder bei André.
*
André erwachte aus seinem unruhigen, von wilden Träumen bewegten Schlummer. Im Zimmer war es dunkel. Seine Hand tastete nach dem Lichtschalter, fand ihn aber nicht. Versehentlich berührte er die Glocke, und gleich darauf erschien Dr. Jenny Lenz.
»Haben Sie einen Wunsch, Herr Clermont?«, fragte sie.
»Ich wollte Licht machen. Wie spät ist es?«
»Neun Uhr.«
»Es ist so dunkel«, murmelte er.
»Wir dachten, dass Sie durchschlafen würden«, erklärte sie.
Sie fasste nach seinem Puls und war überrascht, dass seine Hand sich kühl anfasste.
»Wir machen ja Fortschritte«, sagte sie erleichtert.
»Es wird auch Zeit«, brummte er. »Ich will nicht ewig in der Klinik bleiben.«
»Das höre ich gern. Wir brauchen unsere Betten.«
Er warf ihr einen langen forschenden Blick zu.
»Hat sich jemand nach mir erkundigt?«, fragte er.
»Dr. Norden und Herr Steiger.«
»Poldi, guter Gott, den hatte ich ganz vergessen. Wir waren verabredet.«
»Er weiß, dass Sie die Verabredung nicht einhalten konnten.« Jenny war zufrieden, dass seine Stimme wieder Kraft hatte, dass seine Augen nicht mehr so trübe waren und er auch sonst bedeutend reger wirkte.
»Herr Steiger hat heute Morgen Ihren Koffer gebracht«, fuhr sie fort.
»Wieso?«, fragte André befremdet.
»Nun, wahrscheinlich meinte er, dass Sie etwas brauchen.«
André wurde sehr unruhig. Das konnte ihr nicht entgehen.
»Aber mein Zimmer in der Pension, ich wollte es doch behalten«, sagte er abgehackt. »Bitte, rufen Sie sofort an, dass es nicht weitervermietet wird. Das wird doch hoffentlich nicht geschehen sein.«
Jenny wusste sich nicht zu erklären, warum er sich darüber so erregte. Aber er war nicht bereit, ihr eine Erklärung zu geben. »Sie müssen unbedingt sofort anrufen, dass das Zimmer für mich reserviert bleibt«, stieß er hervor. »Auf jeden Fall.«
Wenn ihm so viel daran lag, warum sollte sie es nicht tun? Es musste jedenfalls alles vermieden werden, was einen Rückfall herbeiführen könnte, und sie konnte bemerken, dass jetzt wieder feine Schweißtropfen auf seiner Stirn erschienen.
»Wir können gleich von hier aus anrufen«, sagte sie, um ihn zu beruhigen. »Ich lasse mich mit der Pension verbinden.«
Das war innerhalb einer Minute geschehen, und Jenny ahnte nicht, in welche Bedrängnis nun Annette von Rosen durch diesen Anruf geriet, die es aber nicht fertigbrachte, zu sagen, dass das Zimmer bereits vermietet sei, denn André sagte selbst in den Apparat, dass es so bleiben solle, bis er wieder aus der Klinik käme.
*
»Jetzt sitze ich in einer schönen Klemme«, sagte Annette zu Karl Herzog. »Anruf aus der Klinik. Dr. Clermont wünscht das Zimmer zu behalten. Auf jeden Fall.«
Karl Herzogs Augenbrauen schoben sich zusammen. Er dachte angestrengt nach, aber er verriet nichts von seinen Gedanken.
»Er braucht nicht zu erfahren, dass Sie es mir für ein paar Tage überlassen haben«, sagte er.
»Es ist mir schrecklich peinlich. Was müssen Sie nur von mir denken, Herr Herzog?«
»Was denn schon? Nur, dass Sie annahmen, er würde keinen Gebrauch mehr davon machen. Wahrscheinlich muss er doch noch einige Zeit in der Klinik bleiben.«
»Es scheint ihm besserzugehen. Vielleicht hätte ich Herrn Steiger die Sachen nicht herausgeben sollen. Vielleicht will auch seine Frau das Zimmer haben.«
»Das glaube ich nicht. Außerdem ist es nicht seine Frau.«
»Aber sie hat mir ihren Pass gezeigt«, sagte Annette gequält.
»Das ist eine lange und geheimnisvolle Geschichte, die Sie vielleicht einmal erfahren werden«, sagte er nun rätselhaft. »Ich werde es jedenfalls verantworten, dass ich ein paar Tage in diesem Zimmer wohne. Sie brauchen sich da keine Sorgen zu machen. Es sind doch keine persönlichen Sachen mehr von ihm drinnen?«
»Nein, die hat Herr Steiger alle geholt.«
Aber vielleicht hat er etwas darin versteckt. Irgendwo, überlegte Karl Herzog, und er hatte keinerlei Bedenken, sich einmal gründlich umzuschauen, was er dann auch tat, nachdem er Annette herzlich gute Nacht gewünscht hatte. Er ging systematisch vor, hob den Teppich auf, nahm die Bilder von den Wänden, untersuchte den Schrank und Schreibtisch gründlichst, aber er konnte nichts entdecken. Ja, was wollte er denn eigentlich, was hätte André denn zu verstecken gehabt? Aber warum war er so erpicht, das Zimmer zu behalten? Da er in der Klinik lag, konnte er doch froh sein, wenn er den Pensionspreis sparen konnte. Er musste wirklich einen triftigen Grund für dieses Anliegen haben.
Karl Herzog starrte auf das Bett. Was hatte er denn als Junge immer gemacht im Internat, wenn er etwas vor den Augen anderer verbergen wollte? Er hatte es unter der Matratze versteckt!
So ging Karl Herzog daran, das Bett auseinanderzunehmen, und endlich war seine Suche von Erfolg gekrönt. An der Unterseite der Sprungfedermatratze war ein Umschlag angeklebt. Ein ziemlich großer Umschlag, der versiegelt war.
Er betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen. Raffiniert, dachte er. Bei einer flüchtigen Durchsuchung wäre man nicht darauf gestoßen, und mit einer solchen hatte André Clermont anscheinend gerechnet. Und wegen dieses Umschlags war er jetzt wohl in Panik geraten. Was mochte er enthalten?
Karl Herzog löste den Umschlag vorsichtig ab, legte ihn auf den Tisch und ging erst einmal wieder daran, das Bett wieder zusammenzuhauen. Und da ging die Verbindungstür zu Bettinas Zimmer auf. Er hatte vergessen, dass Annette von Rosen sie vorhin aufgeschlossen hatte mit der Bemerkung, dass sie so von einem zum anderen Zimmer gehen könnten.
Bettina stand totenbleich im Rahmen. »Was machst du da, Daddy?«, fragte sie bestürzt.
»Ich habe das Bett umgebaut, wie du siehst«, erwiderte er trocken.
»Erzähl mir doch keine Märchen. Frau von Rosen hat mir gesagt, dass André das Zimmer weiter behalten will, und sie hat sich überlegt, dass es doch besser wäre, wenn sie dir ein anderes geben würde. Sie würde dir ihr privates Gästezimmer zur Verfügung stellen, wenn du einverstanden bist. Das sollte ich dir ausrichten.«
»Wie angenehm«, erwiderte Karl Herzog lächelnd. »Jetzt mache ich gern davon Gebrauch. Das Bett gefällt mir nämlich nicht.«
»Mein Gott, mach sie doch nicht noch ganz unglücklich! Das brauchst du wahrhaftig nicht laut zu sagen.«
»Tue ich doch nicht, Kleinchen. Reg dich nicht gleich auf. Wie war’s denn bei dir?«
Er wollte jetzt den Tisch verdecken mit seinem Körper, aber gerade dieses Manöver machte Bettina aufmerksam, sie entdeckte den Umschlag auf dem Tisch und erkannte Andrés Handschrift.
Ihre Augen weiteten sich. »Du hast also etwas gesucht«, sagte sie heiser.
»Na schön, ich habe etwas gesucht und auch gefunden«, gab er zu. »Es musste doch einen Grund haben, dass dein André das Zimmer behalten wollte.«
»Es ist nicht mein André«, stieß sie hervor.
Er sah sie forschend an. »Bist du bekehrt?«, fragte er nachdenklich.
»Inwiefern? Er ist noch nicht mein André, könnte ich auch sagen. Aber ich will meine Gedanken nicht dauernd in die Zukunft schweifen lassen, Daddy. Vielleicht will er nichts von mir wissen. Ich lebe jetzt nach dem Wahlspruch: Was uns nicht umbringt, macht uns stärker.«
»Gut gesagt. Aber von mir, deinem Vater, hast du solche Lehren ja nicht angenommen.«
»Weil ich immer das Gefühl hatte, dass du gegen André bist. Die Menschen, mit denen ich heute gesprochen habe, sind ganz objektiv.«
Sie näherte sich dem Tisch und streckte ihre Hand nach dem Umschlag aus, doch dann zog sie sie schnell wieder zurück.
»Was mag er wohl enthalten?«, fragte sie mehr zu sich selbst.
Ihr Vater hob den Umschlag auf und wog ihn in der Hand. Dann drehte er ihn um, und seine Augen weiteten sich.
»Im Falle meines Todes an Herrn Karl Herzog zu übergeben«, las er laut. »Donner und Doria!«
»André ist nicht tot, Daddy. Glücklicherweise nicht«, sagte Bettina.
»Aber wenn ich den Umschlag sowieso bekommen sollte, könnte ich doch einen Blick hineinwerfen!«
»Schäm dich«, sagte sie. »Ich wusste nicht, dass du so neugierig bist. Du wirst den Umschlag nicht öffnen.«
»Du bist anscheinend gar nicht neugierig, oder hast du Angst, dass etwas darin steht, was alle Illusionen zerstört?«
»Ich habe keine Illusionen mehr«, erwiderte Bettina. »Ich will nur noch Klarheit, restlose Klarheit.«
»Na, dann kann ich dir den Umschlag ja zu treuen Händen übergeben, damit ich nicht in Versuchung gebracht werde, und ich werde Frau von Rosens freundliches Angebot annehmen und in ihr Gästezimmer umziehen.«
»Das scheint dir zu gefallen«, sagte Bettina.
»Und wie! Ich bin gespannt, was die beiden Lausbuben dazu sagen werden.«
»Du nimmst alles so leicht. Beschwert es dich denn gar nicht mehr, dass du von Bob so hintergangen wurdest?«
»Jetzt noch? Mein liebes Kind, es hat mir einen schweren Schlag versetzt, aber ich hätte ihm ja nicht zu trauen brauchen. Ich habe teuer dafür bezahlt, bin aber nicht daran zugrunde gegangen. Am schlimmsten war
der Gedanke für mich, dass du daran zerbrechen könntest, mein Kleinchen. Aber wir können morgen weiterreden, ich will nicht so unhöflich sein und Frau von Rosen noch länger warten lassen. Sie ist eine reizende Frau. Es könnte durchaus möglich sein, dass ich in Betracht ziehe, sie näher kennenzulernen, dein Einverständnis vorausgesetzt.«
»Mein Gedanke«, sagte Bettina mit einem weichen Lächeln.
»Dein Gedanke? Na, hör mal, Kleines. Ich kann meine Entscheidungen sehr gut selbst treffen. Nicht über Nacht, aber die Kinder gefallen mir mächtig.«
»Und ihre Mutter auch, wie ich deinem verklärten Blick entnehme, Daddy«, sagte Bettina.
Er nahm sie mit einem leisen Lachen in den Arm und drückte sie an sich. »Du hast ja wieder Humor, Bébé«, sagte er anerkennend.
»Das macht die nette Gesellschaft.« Dann gab sie ihrem Vater einen Kuss, und er begab sich zu Frau von Rosen. Bettina erfuhr nichts davon, dass sie bis weit nach Mitternacht beieinander saßen und miteinander sprachen, und was sie alles zu reden hatten!
*
Weit nach Mitternacht war es auch, als Jürgen Isabel zu ihrer Wohnung begleitete. Er wollte sich verabschieden.
»Sei doch nicht so empfindlich, Jürgen«, sagte Isabel. »Wozu willst du ein teures Hotelzimmer bezahlen? Mein Gästezimmer ist frei. Und solltest du auf meinen guten Ruf bedacht sein, so kannst du ihn vergessen.«
»Deinen guten Ruf?«
»Bah, was interessieren mich die Nachbarn. Die trauen mir sowieso viel mehr zu, als dahinter ist. Wir hatten noch kaum Zeit füreinander. Ich bin glücklich, dass du bei mir bist«, fügte sie dann zärtlich hinzu. »Oder wolltest du mir sagen, dass du dich anderweitig entschieden hast?«
»Red nicht solchen Unsinn. Ganz im Gegenteil. Ich wollte dir sagen, dass ich es blödsinnig finde, wenn wir noch mit der Hochzeit warten.«
»Und das vor der Wohnungstür?«, fragte sie. »Herein mit dir! Das ist ein Wort.«
Und kaum hatte sie die Tür geschlossen, fiel sie ihm um den Hals.
So hatte er sie noch nie erlebt, und er war fast ein wenig erschrocken. Auch darüber, dass er so leidenschaftlicher Empfindungen fähig war.
»Ich möchte doch Kinder haben«, flüsterte Isabel. »Oder soll ich wirklich fremde Kinder adoptieren müssen?«
»Wenn schon, dann wir gemeinsam«, sagte Jürgen leise. »Aber nur, wenn wir keine eigenen Kinder bekommen.«
»Traust du mir das nicht zu?«, fragte Isabel lächelnd, aber doch schwang ein wenig Angst in ihrer Stimme.
»Man kann es nie voraussagen, Isabel«, sagte Jürgen, »aber ich will dich nicht heiraten, damit du Mutter unserer Kinder wirst, sondern weil ich dich als meine Frau haben möchte. Nur als meine Frau.«
*
In André Clermonts Zustand schien tatsächlich wieder eine Verschlechterung eingetreten zu sein. Aus einem gemütlichen Beisammensein zwischen Dr. Behnisch und Jenny wurde nichts, aber gemeinsam verbrachten sie die Nacht in der Klinik. Ein ergiebiges Gespräch wollte sich nicht anbahnen. Jenny grübelte unentwegt über André nach, und Dieter Behnisch ließ sich von ihren sorgenvollen Betrachtungen anstecken.
»Die Nadel«, sagte sie wieder sinnend. »Immerzu spricht er von der Nadel. Was mag das für eine Nadel gewesen sein?«
»Und diese Laila? Ist das etwa eine moderne Lucrezia Borgia?«
»Sie brauchen nicht zu spotten. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Diese Laila muss ein Trauma für ihn sein. Wenn er nur nicht so verworren reden würde. Und warum hat er sich wegen des Hotelzimmers so aufgeregt?«
»Also nicht nur ein schwieriger, sondern auch ein geheimnisumwitterter Patient, Jenny. Tragen wir es mit Fassung, und vergessen wir darüber nicht, dass wir auch noch andere Patienten haben.«
Sie geriet sofort in Verlegenheit. »Ich vernachlässige meine Pflichten nicht«, sagte sie rasch.
»Das weiß ich«, erwiderte er voller Wärme. »Sie machen auch Dienst rund um die Uhr, aber ich habe die Verantwortung. Nicht nur für die Patienten, sondern auch für meine Mitarbeiter. Sie werden jetzt wenigstens ein paar Stunden schlafen.«
»Und Sie?«
»Ich auch, Schwester Petra weckt mich dann schon, wenn ich gebraucht werde.«
Aber so schnell schlief er noch nicht ein. Er ging noch einmal in das Ärztezimmer, ganz leise, um sie nicht zu wecken.
Sie war schnell eingeschlafen. Ihr Gesicht war entspannt, und sie atmete ruhig. Es war kein schönes Gesicht im landläufigem Sinne, aber ein ausgesprochen liebes Gesicht, wie er feststellte.
Sie war ein scheuer, vom Glück wenig begünstigter Mensch, aber ungemein tüchtig und zuverlässig, dass er einfach nicht begriff, warum sie bisher nicht anerkannt worden war von den männlichen Kollegen. Vielleicht, weil sie zu tüchtig war?
Ihm nötigte das nur Achtung ab. Seit sie an seiner Klinik war, gab es kaum noch Schwierigkeiten. Alles lief wie am Schnürchen, und dabei drängte sie sich gewiss nicht in den Vordergrund. Sie war immer gegenwärtig, und man spürte sie doch kaum.
Aber sie war doch eine Frau, und ihr Interesse an André Clermont war ungewöhnlich groß. War es mehr, als ein berufliches Interesse?
Einen solchen Gedanken schob Dr. Behnisch unwillig von sich, aber er beschäftigte ihn dann doch und ließ ihn nicht zur Ruhe kommen.
Er muss schleunigst gesund werden und wieder verschwinden, dachte er dann zornig. Und dann ging es ihm durch den Sinn, ob nicht ein anderer ihn aus dem Weg räumen wollte, nicht nur wegen einer lächerlichen Eifersucht, sondern aus Hass.
*
Poldi Steiger sollte an diesem Abend auch auf seine Kosten kommen. Er hatte in manchen Dingen den sechsten Sinn. Im Allgemeinen ein geduldiger und zielstrebiger Mensch, wurde er öfter einmal von einer inneren Stimme getrieben.
Was Frauen anbetraf, war er nie ein Kostverächter gewesen, wenn auch gewisse Vorstellungen nicht wegzudenken waren. Die einzige Frau, der er jedoch tiefe Gefühle entgegenbrachte, war unerreichbar für ihn. Es war Bettina Herzog. Sie wusste es nicht und sollte es nie erfahren, aber Poldi hätte sich für sie in Stücke reißen lassen.
Es war reine Intuition bei ihm gewesen, Andrés Sachen aus der Pension zu holen. Er hatte sie auch sofort und ohne sie näher zu untersuchen, in die Klinik gebracht. André war sein Freund. Das war auch so geblieben, obwohl dieser sich ganz zurückgezogen hatte. Freundschaft hing nicht davon ab, dass man in ständiger Verbindung war. Für Poldi war sie etwas Unantastbares, und wenn jetzt jemand Zweifel an ihm hegte, tat er ihm bitter Unrecht.
Die zweite Intuition kam, als er an seinem Schreibtisch saß und an einem Artikel herumdokterte. Er erinnerte sich, dass der Ober seines Stammlokals ihm beim Mittagessen gesagt hatte, dass eine Dame nach ihm gefragt hätte. Eine sehr elegante, schicke Dame.
Was war eigentlich mit seinem Telefon los? Warum rief Bettina ihn nicht einmal an? Dieser Gedanke war ihm auch wie ein Blitz gekommen, nachdem er stundenlang auf ihren Anruf gewartet hatte.
Er selber wollte sie nicht anrufen. Sie wollte nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden, und er hielt sich an diese Abmachung.
Er nahm den Hörer ab. Die Leitung war tot. Konsterniert starrte er das Telefon an, zog an der Schnur und hielt sie in der Hand.
Das war nicht nur merkwürdig, sondern ein Alarmsignal. So deutete er es jedenfalls, aber so viel er auch suchte, konnte er doch nicht feststellen, dass etwas in seiner Wohnung verändert war oder darauf hindeuten würde, dass ein Fremder hier gewesen wäre. Er konnte es also nur so deuten, dass seine Putzfrau versehentlich den Stecker herausgerissen hatte. Er war auf diesen Gedanken gar nicht gekommen, weil er selbst nicht telefoniert hatte. Aber vielleicht hatte Bettina versucht, ihn zu erreichen, und sie war es dann gewesen, die in seinem Stammlokal nach ihm gefragt hatte.
Poldi war manchmal sehr schnell entschlossen, und so zog er seine Lederjacke an und begab sich außer Haus, auf direktem Wege zu dem Lokal, das gleich an der Ecke lag. Er kannte die Bedienung gut, ein sehr nettes Mädchen, das sich mit diesem gewiss nicht leichten Job sein Studium verdiente. Er konnte sie veranlassen, Bettina anzurufen, ohne selbst dabei in Verdacht zu geraten.
Es sollte alles einen anderen Verlauf nehmen, als er es sich gedacht hatte, denn an der Bar saß ein schickes, sehr elegantes weibliches Wesen, das ihm wohlbekannt war seit zwei Tagen. Sein Vorteil lag allerdings darin, dass sie nicht wusste, dass er sie kannte. Es war Laila Clifford oder Clermont, oder wie sie sich sonst noch nennen mochte. Heute trug sie eine blonde Perücke, die ihr zugegebenermaßen sehr gut zu Gesicht stand. Sie wirkte irgendwie ätherisch, und das war auch ganz ihre Absicht.
Poldi erkannte sie sofort, obgleich er sie vor zwei Tagen noch rothaarig vor der Behnisch-Klinik gesehen hatte, und er ahnte auch sogleich, dass sie diejenige gewesen war, die sich nach ihm erkundigte, wenngleich er nicht wusste, woher ihr seine Freundschaft mit André bekannt sein könnte.
Er ging an ihr vorbei und setzte sich an den Stammtisch, der erst zu späterer Stunde besetzt wurde. Es dauerte nicht lange, bis der Ober an seinen Tisch trat. Ricky, die Bedienung, zeigte sich noch nicht.
»Die Dame, die schon heute Mittag nach Ihnen fragte, ist wieder da, Herr Steiger«, raunte ihm der Ober zu.
»So?«, fragte Poldi gleichmütig, ohne den Blick von der Getränkekarte zu heben.
»Sie hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass sie gern mit Ihnen sprechen würde. Sie ist wohl von der Zeitung.«
So eine Kanaille, dachte Poldi. Na, dann mischen wir uns mal die Karten und beginnen das Spiel.
»Ich habe nichts dagegen«, sagte er. »Ist es etwa die Blonde?«
Der Ober nickte. »Flottes Weib«, sagte Poldi. »Her damit!« Man kannte hier seine burschikose Art, und der Ober dachte sich nichts dabei.
Gemächlich erhob sich Poldi, als Laila mit wiegenden Hüften nahte.
»Herr Steiger? Nett von Ihnen, dass Sie zu einem Gespräch bereit sind. Mein Name ist Jill Travers.«
Sie sagte es so überzeugend, dass er unsicher geworden wäre, hätte er nicht ein so ausgezeichnetes Personengedächtnis. Durch Perücken konnte Laila zwar ihre Haarfarbe total verändern, aber für Lippenstift und Nagellack schien sie eine ganz besonders auffallende Farbe zu bevorzugen, die ihm dann auch sofort aufgefallen war.
»Und wodurch habe ich Ihre Aufmerksamkeit erregt?«, fragte Poldi leichthin. »So schön bin ich doch auch wieder nicht.«
Sie schien leicht irritiert. »Ich bin Korrespondentin einer Fachzeitschrift, und mir ist bekannt, dass Sie ein namhafter Dozent der Naturwissenschaften sind«, erklärte sie.
Na, die geht aber ran, dachte Poldi. Er war jetzt maßlos neugierig geworden. »So namhaft auch wieder nicht«, erklärte er bescheiden, obgleich er wahrhaftig nie sein Licht unter den Scheffel stellte. Ohne überheblich zu sein, wusste er seinen Wert richtig einzuschätzen.
»Wir sind durch Ihre wirklich ausgezeichneten Artikel auf Sie aufmerksam geworden, aber ich möchte Sie um einige differenzierte Auskünfte über Dr. André Clermont bitten, über dessen Forschungsarbeiten Sie ja früher mehrmals berichtet haben.«
»Leider gibt es da nichts mehr zu berichten«, sagte Poldi geistesgegenwärtig. »Der gute Clermont ist von der Bildfläche verschwunden.«
Er sah sie scharf an, und es entging ihm nicht, dass sie ihm nicht glaubte. So belauerten sie sich von dieser Sekunde an wie Hund und Katze, sich fragend, was sie und was wiederum er wüsste.
»Und wenn ich Ihnen sage, dass Dr. Clermont derzeit in München weilt?«, machte Laila dann doch einen Vorstoß.
»Ist das die Möglichkeit? Ja, was sagt man denn dazu? Und er hat sich nicht mal bei mir gemeldet?«
»Hat er das wirklich nicht?«, fragte Laila lauernd.
»Mein Ehrenwort!« Wenn es ihm zweckmäßig erschien, ging Poldi selbst mit einem Ehrenwort recht achtlos um, und er verspürte dabei nicht die geringsten Gewissensbisse. Er hätte Laila Clifford am liebsten den Hals umgedreht, da er einige Dinge in Erfahrung gebracht hatte, die ihm gar nicht gefielen, aber das konnte man von seiner Miene nicht ablesen. Laila wurde merklich unsicher.
»Dann bin ich falsch informiert«, sagte sie. »Sie müssen wissen, dass wir großes Interesse an Dr. Clermont haben, und es würde für ihn und auch für Sie eine beträchtliche Summe dabei herausspringen, wenn ein lukratives Gespräch zustande käme.«
»Bezüglich?«, fragte Poldi lakonisch.
»Darüber möchte ich jetzt noch keine Auskunft geben. Wir werden uns sicher arrangieren, Herr Steiger.«
Er blinzelte. »Mit einer schönen Frau arrangiere ich mich gern«, sagte er und erreichte damit, dass Laila sich bereits siegessicher fühlte. Sie war ohnehin überzeugt, dass kein Mann ihrem Charme widerstehen könne, wenn es ihr auch noch gewaltig zu schaffen machte, dass sie bei Dr. Norden nichts erreicht hatte.
Aber in ihren Augen war Poldi Steiger ein naiver Trottel, den sie um den Finger wickeln könnte. Nein, Laila ahnte nicht, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben einem Mann begegnet war, der ihr nicht nur haushoch überlegen, nicht nur völlig unempfindlich für ihre Reize, sondern auch noch ihr gefährlichster Feind war, der nichts anderes im Sinn hatte, als sie zu vernichten.
Sie will André das Genick brechen, dachte Poldi, während er eine lächelnde Miene zeigte. Ich werde es ihr brechen. Und wenn er wollte, konnte er einen erstaunlichen Charme entfalten.
Doch in dieser Nacht, die recht lang war, musste er sich mehrmals mahnen, nicht wirklich zu einem tätlichen Angriff überzugehen, und er musste auch eine Rolle spielen, die ihm gar nicht behagte, seit er Rickys traurigen Blick zur Kenntnis nehmen musste, als er mit Laila das Lokal verließ.
Ganz komisch war ihm da geworden, aber dann dachte er an André und Bettina und tanzte mit Laila, oder Jill, wie sie sich jetzt nannte, Wange an Wange in einem exklusiven Nachtclub und raffte sich mit einiger Überwindung dazu auf, mit ihr in ihr Hotel zu gehen.
Alles für dich und Bettina, André, dachte er, als sich Lailas Arme um seinen Hals legten. Der Erfolg rechtfertigt die Mittel.
*
»Du wirst also André aufsuchen, Leo?«, fragte Laila am reichgedeckten Frühstückstisch, den man in das Appartement gerollt hatte.
»Ich brenne darauf«, erwiderte er. »Ich bin dir unendlich dankbar, Bellisima, dass ich erfahren habe, wo sich André befindet.«
Er würgte ein halbes Brötchen hinunter, obgleich er sonst morgens Mengen verdrücken konnte. Er war sich selbst widerlich, weil er das Spiel so weit getrieben hatte, aber nun wusste er wenigstens, woran er war. Auch das nahm ihm den Appetit.
Es war ein fürstliches Appartement. Zu sparen brauchte Laila anscheinend nicht. In ihrem Schlafzimmer läutete das Telefon. Von Spitzen umschwebt, rauschte sie hinüber.
Und als sie dann zurückkam, wusste Poldi, dass etwas doch schiefgelaufen war. In ihren Augen glühte blanker Haß.
»Du widerliches Subjekt, du hast mich belogen und betrogen!«, stieß sie hervor. »Aber das wirst du büßen.«
Poldi war im Grunde froh, dass das Katz-und-Maus-Spiel nun zu Ende war.
»Gut, ich bin in Ihren Augen ein widerliches Subjekt, Frau Clermont, aber was sind Sie?«, fragte er eisig.
Es verschlug ihr die Sprache.
Jetzt endlich erkannte sie, dass sie die Unterlegene war. Sie stürzte mit geballten Fäusten auf ihn zu, aber seine sehnigen Hände umklammerten ihre Arme und hielten sie fest.
»Mich legt man nicht so schnell aufs Kreuz wie André«, sagte er. »Ich habe auch keinen Bruder, der ein haltloser Lump war und die richtige Partnerin fand. Ich habe auch keine Frau, die ich liebe und auf die ich Rücksicht nehmen müsste, und keine Mutter, von der ich nicht weiß, auf wessen Seite sie steht. Und auch keinen Vater, für den ich zum Verbrecher werden würde! Meinen Sie, Laila Clifford, dass Sie Ihren Vater mit Verbrechen vor dem Ruin retten können?«
»Sie Narr!«, schrie Laila. »Sie hätten ein reicher Mann werden können und André auch. Wir alle wären reich und was würde es Karl Herzog schon schaden, wenn er ein paar Millionen weniger hätte?«
»Ich möchte lieber ein ehrlicher Mann bleiben«, sagte Poldi kalt. »So begehrenswert sind Sie nun auch wieder nicht, dass ich mich für Sie ruiniere, wie Bob es getan hat. Dieser Dummkopf. Warum bringt er sich um, anstatt Farbe zu bekennen?«
Er schleuderte sie von sich, griff nach seiner Jacke, die über einem Stuhl hing, und ging zur Tür.
»Einen Trost kann ich Ihnen noch geben, Laila«, sagte er ruhig. »André würde mir die Formel nicht geben, wenn er sie wirklich hat. Und auch keinem anderen als dem, dem er sie vorenthalten hat. Er würde eher sterben.«
»Wenn er doch sterben würde!«, schrie sie gellend. »Wenn er mir wenigstens diesen Gefallen täte.«
Der Sinn dieser Worte sollte Poldi allerdings erst viel später aufgehen. Er wollte nur weg, an die frische Luft und dann in sein Lokal, um sich von Ricky einen starken Kaffee servieren zu lassen.
Laila Clifford wollte er nach Möglichkeit nie mehr in seinem Leben begegnen.
Es kam ihm merkwürdig vor, dass er das Hotel verlassen konnte, ohne dass sich ihm jemand in den Weg stellte.
Auf so etwas war er gefasst, und er war entsprechend vorsichtig. Aber nichts geschah, was er befürchtete, obwohl er doch gemeint hatte, dass Laila Helfershelfer herbeigerufen hätte.
Poldi warf sich in ein Taxi und ertappte sich dabei, dass er den Fahrer misstrauisch musterte. Aber das war ein ganz biederer Mann, der ihn auf schnellstem Wege zu dem Lokal brachte, wo er seinen Kaffee in Ruhe trinken wollte.
Als Poldi auf der Straße stand, konnte er wieder klar denken, und er kam zu der Überlegung, dass Laila verzweifelt auf einem verlorenen Posten kämpfte. Sie bekam wohl Informationen, aber sie hatte gar keine Hintermänner. Und worum kämpfte sie? Poldi wusste es. Ihr ging es nur um Geld.
Er hatte einen schlechten Geschmack im Mund, den er hinunterspülen musste.
Ricky war da und fragte: »Was wünschen Sie, Herr Steiger?«
Ihre Stimme klang ziemlich frostig, und das ging Poldi nahe.
»Einen Mokka und eine große Flasche Wasser«, erwiderte er.
Wortlos stellte sie ihm beides wenig später auf den Tisch.
»Schlecht geschlafen?«, fragte er.
»Überhaupt nicht.«
»Warum nicht?«, fragte er.
»Weil ich von zehn Uhr abends bis zehn Uhr morgens Dienst habe«, erwiderte sie schnippisch.
»Sind immer Leute da?«, fragte er verblüfft.
»Ein paar Stunden nicht, aber da muss ich den Dreck wegräumen, den sie gemacht haben.«
»Ich?«, fragte Poldi bestürzt.
»Die Leute, die Gäste, besser gesagt.«
»Zwölf Stunden Dienst«, fragte er heiser. »Das ist doch Wahnsinn.«
»Man muss leben, Herr Steiger«, sagte Ricky und entfernte sich.
Poldi blickte auf seine Armbanduhr. Jetzt war es ein Viertel vor zehn Uhr. Er dachte jetzt nicht mehr an Laila, sondern an Ricky. An ihren
traurigen Blick, als er gestern Abend mit Laila das Lokal verlassen hatte, an ihre müden Augen jetzt und ihre doch so stolze, abweisende Haltung.
Er trank schnell den Mokka und zwei Gläser Wasser. Dann legte er einen Geldschein auf den Tisch und ging rasch hinaus. Aber er blieb auf der anderen Straßenseite stehen und wartete.
Lange brauchte er nicht zu warten. Bald kam Ricky in einem grünen Lodenmantel, ein buntes Kopftuch umgebunden. Sie schrak zusammen, als er vor sie hin trat.
»Ach ja, Sie haben wohl Ihr Wechselgeld vergessen«, sagte sie eisig.
»Nein, Ricky«, sagte er leise. »Ich möchte Sie heimbringen. Ich möchte mich jetzt mit einem vernünftigen Menschen unterhalten und Sie auch um etwas bitten. Haben Sie Telefon in Ihrer Wohnung?«
Sie lachte blechern auf. »Ich habe keine Wohnung, nur ein billiges möbliertes Zimmer. Und wozu brauche ich ein Telefon?«
»Dann gehen wir in eine Zelle. Ich bitte Sie um einen Gefallen, und ich werde Ihnen später erklären, warum.«
»Warum nicht vorher?«, fragte Ricky. »Hatte die Dame kein Telefon?«
»Es war keine Dame. Das erkläre ich Ihnen auch noch. Mädchen, wir kennen uns doch schon eine ganze Zeit. Wofür halten Sie mich denn?«
»Ich halte von Männern überhaupt nichts«, erwiderte Ricky.
»Schlechte Erfahrungen gemacht?«
»Bin ich Ihnen Rechenschaft schuld?«, konterte sie trotzig. »Sie habe ich für anständig gehalten, bis gestern. Und dann sind Sie mit solcher Person losgezogen.«
»Wie stufen Sie sie ein?«, fragte Poldi.
»Billig.«
»Irrtum, kleines Mädchen. Sie hat ihre Preise, und manchmal bezahlen Männer mit ihrem Leben dafür. Ich allerdings nicht. Schauen Sie mich doch nicht so vernichtend an. Ich mag Sie, Ricky, ich habe Vertrauen zu Ihnen, und deswegen bitte ich Sie, einen Anruf für mich zu erledigen. Er ist sehr wichtig.«
»Wen soll ich anrufen?«, fragte Ricky leise.
»Pension Rosengarten. Verlangen Sie Frau Herzog. Gott im Himmel, Mädchen, es ist eine gute Bekannte. Sie brauchen mich nicht gleich wieder in Grund und Boden zu verdammen. Sie brauchen ihr bloß zu sagen, dass sie mich um zwölf Uhr in der Behnisch-Klinik treffen soll.«
»Und warum rufen Sie nicht selber an?«
»Das erkläre ich Ihnen auch später.«
Ricky warf ihm noch einen langen Blick zu, dann sagte sie nichts mehr.
*
Bettina wusste nicht, was sie denken sollte, als die fremde ängstliche Mädchenstimme ihr ausrichtete, dass Poldi sie um zwölf Uhr in der Behnisch-Klinik treffen wolle.
»Wer spricht da bitte?«, fragte sie.
»Ricky, Ricky Brühl«, tönte es zaghaft durch den Draht. »Es stimmt schon, Frau Herzog.«
»Ja, es stimmt«, vernahm Bettina aus dem Hintergrund Poldis Stimme. Und da erinnerte sie sich, dass sie ja ausgemacht hatten, dass er sie nicht anrufen solle.
Nun hatte sich allerdings in der Pension Rosengarten so viel getan, dass man keine Heimlichkeiten mehr voreinander haben musste.
Annette wusste zwar nicht alles, aber doch so viel, dass es enge Verbindungen zwischen Dr. Clermont, Bettina und Karl Herzog gab. Und er fühlte sich allem Anschein nach ganz heimisch in dem schönen Haus.
»Ich fahre in die Stadt. Muss noch was erledigen«, sagte er zu Bettina. Sie war so mit ihren Überlegungen beschäftigt, dass sie nur nickte.
»Würdest du mir bitte den Umschlag geben, Bébé«, sagte ihr Vater.
»Was willst du damit?«
»Ihn an einem sicheren Ort deponieren.«
»Aber du wirst ihn nicht öffnen!«
»Ich habe mir ohnehin überlegt, dass dies eine Straftat wäre«, erklärte er mit einem hintergründigen Lächeln. »Nein, ich werde ihn selbstverständlich nicht öffnen.«
»Ich möchte wirklich wissen, was André sagt, wenn er erfährt, dass du in seinem Zimmer herumgeschnüffelt hast.«
»Das werden wir schon noch erfahren. Ich muss ja Farbe bekennen, wenn es so weit ist.«
Gegen den Vater konnte sie nicht ankommen. Er war ein Mann der Tat, und er verantwortete, was er tat.
Es wäre ihr aber doch nicht einerlei gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass er jetzt zur Behnisch-Klinik fuhr.
Gegen Morgen war André wieder ruhiger geworden. Das Fieber war wieder abgeklungen. Dr. Behnisch und Jenny waren ganz zufrieden mit ihm. Jenny hatte schlafen können, während Dr. Behnisch von Schwester Petra zweimal geweckt worden war. Allerdings wäre das nicht nötig gewesen, aber Schwester Petra machte ab und zu doch einen Versuch, die Aufmerksamkeit des Chefs auf sich zu lenken. Dieter Behnisch übersah dies geflissentlich.
Nach der Visite wollte er sich allerdings ein bisschen ausruhen, doch dazu kam es nicht, denn Karl Herzog erschien.
Nach einer langen Unterhaltung befand sich der Chefarzt in einer Zwickmühle. Sollte er Herrn Herzog einen Besuch bei Dr. Clermont gestatten?
Es konnte neue Aufregungen geben, es konnte aber auch positiv sein.
»Ich werde mir Dr. Clermont erst mal ansehen«, sagte er.
Karl Herzog wartete geduldig. Er wollte nichts forcieren, aber auch er traf manchmal intuitive Entscheidungen.
Dann kam Dr. Behnisch wieder aus dem Krankenzimmer.
»Dr. Clermont war sehr überrascht«, sagte er nachdenklich, »aber anscheinend ist er sehr an einem Gespräch mit Ihnen interessiert. Bitte, nicht zu lange.«
Atemlose Spannung beherrschte den Augenblick dieses Wiedersehens nach drei Jahren. Zögernd ging Karl Herzog auf das Bett zu, und als er Andrés Hand ergriff, senkten sich dessen Lider.
»Wie haben Sie mich gefunden?«, fragte André leise.
»Das wäre eine lange Geschichte, und Dr. Behnisch hat mir ans Herz gelegt, dass ich das Gespräch nicht zu lange ausdehnen darf.«
»Ich habe viel Zeit«, sagte André. »Und es ist gut, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Ich habe Ihnen manches zu sagen.«
»Ich Ihnen auch.«
Wer wollte nun beginnen? Sie tauschten einen langen Blick.
»Sie haben gewusst, dass Bob Sie hintergangen hat«, sagte André dann stockend.
»Ja, das habe ich gewusst.«
»Aber Sie haben nichts unternommen.«
»Weil Bébé mich darum bat.«
André presste die Lippen zusammen. »Bébé«, flüsterte er.
»Sie bat mich nicht um Bobs willen, sondern um Ihretwillen, André. Warum sind Sie einer Aussprache aus dem Wege gegangen?«
»Es hätte sich alles noch verschlimmert.«
»Gaben Sie sich auch Schuld an Bobs Ende?«
»Nein. Er sah keinen anderen Ausweg mehr. Er hatte sich zu tief in diese Affäre verstrickt, und dann wurde er noch erpresst. Ich habe lange gebraucht, um alles in Erfahrung zu bringen. Ich wollte Ihnen vorher nicht unter die Augen treten, und für Bébé sollte der Weg frei sein. Der Name Clermont konnte doch nur böse Erinnerungen in ihr wecken.«
»Ja, was man sich alles so einreden kann«, sagte Karl Herzog. »Auf den Gedanken, dass meine Tochter ganz anderer Meinung sein könnte, sind Sie wohl nicht gekommen?«
Er wunderte sich, dass er so sprechen konnte.
War er nicht immer im Zweifel gewesen, dass André irgendwie doch in diese Geschichte verstrickt sein könnte?
»Weiß Bettina, dass Sie hier sind?«, fragte André.
»Nein.«
Das wusste sie ja nun wirklich nicht. Er brauchte nicht gleich mit der ganzen Wahrheit herauszurücken. Diese Entschuldigung hatte er schon für sich.
»Ich wohnte in der Pension Rosengarten«, sagte André nun zusammenhanglos. »Dort habe ich etwas hinterlassen, was für Sie bestimmt ist.«
»Diesen Umschlag?«, fragte Karl Herzog. Er hatte ihn seiner Aktentasche entnommen.
André starrte ihn wie hypnotisiert an. »Mein Gott, wie kommen Sie dazu?«
»Ich habe ihn gefunden. Jetzt werde ich Ihnen alles erklären. André. Ich wohne auch in der Pension.«
Dann dauerte das Gespräch viel länger, als Dr. Behnisch erlaubt hätte, und der war entsetzt, als er gegen zwölf Uhr das Zimmer betrat und Karl Herzog immer noch vorfand.
»Keine Vorwürfe«, sagte der. »Dem Patienten geht es jetzt schon sehr viel besser.«
*
Poldi hatte Ricky nach dem Telefongespräch auch so einiges erklären müssen. Allerdings sagte er nichts über André.
Es war eine rein private Aufklärung, die Ricky zwar mit gemischten Gefühlen aufgenommen hatte, aber sie wurde dafür mit einem sehr zärtlichen Kuss entschädigt, der ihr ganz überraschend kam.
»Du bist ein sehr liebes Mädchen, Ricky«, sagte Poldi, »und ich hoffe, dass du auch an mir sympathische Züge entdecken wirst. Diese Arbeit im Lokal ist nichts für dich. Wir werden uns heute Abend eingehend darüber unterhalten.«
»Heute habe ich aber frei«, erwiderte sie schüchtern.
»Na, umso besser. Dann können wir uns ja ganz privat unterhalten. Komm zu mir.«
»Zu Ihnen?«, fragte sie beklommen.
»Da sind wir unter uns. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin kein Casanova. Ich habe dir etwas sehr Wichtiges zu sagen, und dann werde ich dir ein paar Vorschläge unterbreiten. – Okay?«
Er konnte es jetzt nicht ändern, sie in ihrer Verwirrung zurückzulassen. So auf die Schnelle konnte er nicht sagen, was ihn bewegte. Er musste jetzt zu seiner Verabredung mit Bettina. Diese Angelegenheit musste er doch ins Reine bringen, bevor er sich Zeit für sein Privatleben nehmen konnte.
Bettina wartete in ihrem Wagen. Er sah sie schon von Weitem, er parkte neben ihr.
»Geh in die Halle. Es könnte sein, dass man uns beobachtet«, sagte er.
Er wartete ein paar Minuten, bevor er ihr folgte, blickte sich um, aber er konnte nichts Ungewöhnliches entdecken.
»Warum hier?«, fragte Bettina, als er sich zu ihr setzte.
»Du wirst André aufsuchen«, erklärte er unverblümt.
»Nein«, widersprach sie.
»Nimm dein Herz in beide Hände, Bettina. Es muss einmal Klarheit geschaffen werden. Ich war gestern Abend mit Laila zusammen. Ehrlich gesagt, die ganze Nacht. Ich habe eine Menge von meinem eigenen Ich geopfert, um dieser Frau auf die Schliche zu kommen, da wirst du doch ein bisschen von deinem Stolz opfern können, um André einen Schritt entgegenzukommen.«
»Es ist nicht der Stolz, Poldi, es ist Angst«, sagte Bettina leise, und dann sprang sie plötzlich auf.
»Daddy, du bist hier?«, rief sie aus und eilte auf ihren Vater zu, der eben die Treppe herunterkam.
»Wieso bist du hier?«, fragte Karl Herzog überrascht, aber durchaus nicht verlegen.
»Ich habe mich mit Poldi getroffen. Was hast du gemacht?«
»Mit André gesprochen, mein Kleines. Und vielleicht solltest du das nun auch tun.«
»Poldi hat es auch gesagt. Aber –«, sie geriet ins Stocken und sah ihren Vater fragend an.
»Ich glaube nicht, dass du deine Gefühle an den Falschen verschwendet hast«, sagte er. »Für ihn waren die drei Jahre sicher genauso schlimm wie für dich. Ich habe ihm den Umschlag gebracht und den Inhalt mit seiner Erlaubnis gelesen. Glaube mir, es ist weniger schlimm, von einem Angestellten hintergangen zu werden, als seinen Bruder als charakterlosen Ganoven betrachten zu müssen. Wenn ich solch einen Bruder gehabt hätte, würde ich mich wohl auch verkrochen haben. Aber das ist nicht alles, Bébé.« Er legte den Arm um sie. »Du wirst doch jetzt nicht kapitulieren wollen, nachdem du so lange auf ihn gewartet hast.«
»Poldi wollte mir noch einiges erzählen«, sagte Bettina leise.
»Ich denke, dass André dir alles besser erzählen kann. Ich werde mit Poldi zum Essen gehen. Es tut mir leid, Kleines, aber wenn ich hungrig bin, kann ich nicht denken, und ich brauche geregelte Mahlzeiten.«
*
Das lange Gespräch mit Karl Herzog hatte André aber doch sehr erschöpft. Er hatte eine Spritze bekommen und war gleich eingeschlafen.
Zuerst wollte Dr. Behnisch Bettina nicht in das Zimmer lassen, aber dann erlaubte er es doch. Ihr Herz raste, als sie sich an sein Bett setzte, und das Gesicht betrachtete, das sie so sehr liebte. Sie wagte nicht, seine Hand zu berühren. Sie wagte kaum zu atmen.
Sie dachte zurück an den Tag, als er kam, an den ersten Blick, den sie mit ihm tauschte, und der ihr klarmachte, dass ihre Verlobung mit Bob ein Irrtum gewesen war.
André konnte nicht so schöne, vielversprechende Worte sagen wie sein Bruder. Wie überzeugend hatte Bob lügen können! Es schien unfassbar.
Wenn diese Arbeit beendet ist, werden wir heiraten, hatte Bob gesagt, und dabei hatte er eine andere Frau gehabt, die wohl nur darauf wartete, dass diese Arbeit beendet würde, damit sie davon profitieren konnte. Ja, so musste es gewesen sein. Der Name Clifford ließ keine andere Kombination zu.
Es kostete viel Geld, solche Forschungsarbeiten zu finanzieren. Clifford hatte das Geld nicht, aber ihr Vater hatte es. Von Anfang an war alles Täuschung gewesen, auf die raffinierteste Art ausgeführt. Sie hatte in diesen Plan hineingepasst, die naive, aber reiche Tochter des Industriellen.
Bob hatte sie auf erbärmliche Weise zu seiner Sicherheit zu einem Werkzeug degradiert. Wie musste André zumute gewesen sein, als er das erfuhr.
Trocken war Bettinas Kehle und wie zugeschnürt. Sie hatte schon am Morgen kaum einen Bissen über die Lippen gebracht und nur eine Tasse starken Kaffee getrunken.
Sie ging hinaus, um sich etwas zu trinken zu holen. Auf den Gedanken, zu läuten, kaum sie nicht. Sie war ja nicht Patient, sondern Besucherin.
Es herrschte noch Mittagsstille in der Klinik. Auch die Halle war leer, und die Milchbar war verwaist.
Bitte läuten, stand auf einem Schild, doch als sie den Finger auf die Glocke legte, tat sich die Eingangstür auf, und starr vor Entsetzen ließ Bettina ihre Hand sinken.
Durch die Tür trat Laila ein, ohne Perücke, mit ihrem leuchtend roten Haar, das über dem Weißfuchskragen, der ihren Mantel zierte, noch mehr leuchtete.
Aber auch Laila erstarrte, als sie zu Bettina herüberblickte. Ihr Mund öffnete sich, und ihr Gesicht verzerrte sich.
»Bettina Herzog«, sagte sie mit schriller Stimme. Maßlose Überraschung hatte ihr diesen Ausruf über die Lippen getrieben, während Bettina selbst stumm vor Schrecken war.
Sie kennt mich, dachte Bettina mechanisch. Sie weiß, wer ich bin. Wahrscheinlich hat Bob ihr Bilder von mir gezeigt oder mich sogar in Lebensgröße, und er hat ihr gesagt, dass ich es bin, die sich von ihm so hinters Licht hatte führen lassen.
Vielleicht haben sie gemeinsam hämisch über mich gelacht. Ein heißer Zorn loderte in ihr empor.
»Frau Clermont«, sagte sie kalt, »ich finde es sehr amüsant, Bobs Frau doch noch kennenzulernen.« Sie hatte bis heute nicht geahnt, dass sie so kalten Hohnes fähig sein würde, aber insgeheim spürte sie, dass diese Frau noch immer eine Gefahr für sie bedeutete, mehr noch für André, denn warum sonst käme sie hierher?
Laila hatte indessen die Schreckminute überwunden. In ihren Augen glitzerte es gefährlich.
»Dann können wir uns ja unterhalten«, sagte sie. »Sie haben versucht, meine Ehe zu zerstören, sie haben Bob in den Tod getrieben und –«
»Tatsächlich?«, fiel Bettina ihr ins Wort. »Wissen Sie es nicht besser?«
Machte sie es nicht falsch?, fragte sie sich im nächsten Augenblick. Was hatte sie denn für Beweise, dass Laila in alles eingeweiht war? Ja, wenn sie sich länger mit Poldi hätte unterhalten können, dann hätte sie jetzt vielleicht diese Beweise.
»Was soll ich wissen?«, fragte Laila aggressiv. »Was wollen Sie mir unterstellen? Bob und ich waren jung verheiratet, als Sie ihn mit Ihrem Geld umgarnten.
Geld, das war das Stichwort! Plötzlich fühlte sich Bettina wieder sicher.
»Es ist nur gut, dass es mein Geld oder das meines Vaters war, das ihn verlockte«, sagte sie. »Ich weiß nicht, wie ich einen Mann einstufen soll, der jung verheiratet ist, davon nichts verlauten lässt und der Tochter seines Chefs intensiv den Hof macht. Wie lange wollen Sie noch Versteck spielen, Laila Clifford? Dieser Name weckt merkwürdige Erinnerungen in mir. Vielleicht möchten Sie meine Version über diese Geschichte und die Verlobung hören, oder die Version von Herrn Steiger. Oder wollen Sie sich auch hier als Andrés Frau ausgeben, wie Sie es in der Pension Rosengarten taten? Sie werden nicht bekommen, was Sie suchen. Diese Papiere sind in Sicherheit, und André wird bald in der Lage sein, in aller Öffentlichkeit auszusagen, was damals gespielt wurde.«
Schritt für Schritt kam Laila auf sie zu. In ihren Augen flammte tödlicher Hass, und Bettina begriff, dass diese Frau zu allem fähig war.
Da tat sich die Tür auf, und zwei Männer kamen herein, und sie kamen direkt auf sie zu. Unauffällig gekleidete Männer, die Bettina einen jähen Schrecken einjagten.
Doch dieser Schrecken löste sich wie ein Spuk, als der eine sagte: »Frau Clermont? Kriminalpolizei. Würden Sie uns bitte folgen?«
Laila fuhr herum, dann begann sie zu kichern. Es war ein irres Kichern, das gespenstisch klang, aber sie schien das als einen Ulk zu betrachten oder einen Schreckschuss.
Aber für sie war es bitterer Ernst geworden, dafür hatte Poldi gesorgt. Bettina wusste es noch nicht, und ganz so hatte sie sich den Verlauf dann auch nicht vorgestellt.
»Ich habe nichts getan, ich habe nichts getan!«, schrie Laila, als sie hinausgeführt wurde. Sie wehrte sich wie eine Wilde, aber gegen die beiden Männer konnte sie nichts ausrichten.
Doch von ihrem Geschrei wurden Dr. Behnisch und Jenny herbeigelockt. Bettina war nicht mehr allein, und das war gut so, denn die entsetzliche Spannung der letzten Minuten war zu groß gewesen.
»Ich wollte mir doch nur etwas zu trinken holen«, flüsterte sie verwirrt, »und da kam sie und …« Sie konnte nicht weitersprechen. Ein trockenes Schluchzen schüttelte sie.
Jenny Lenz bemühte sich um sie, sprach beruhigend auf sie ein, gab ihr zu trinken und führte sie dann wieder hinauf.
*
»Heute geht es zu, da werden wir vor ein Uhr bestimmt nicht fertig«, sagte Molly.
»Sie können doch gehen, Molly«, gab Fee zurück.
»Heute haben Sie auch genug zu tun gehabt. Ich finde es nur komisch, dass sich die Leute läppische Sachen für das Wochenende aufheben.«
Molly war heute gar nicht in Form. Fee war das schon am Morgen aufgefallen, aber auf ihre besorgte Frage hatte Molly erwidert, dass sie schlecht geschlafen hätte und dass daran das Wetter schuld wäre.
»Am Sonntag wird es dann wieder regnen«, brummte sie. »Meine Beine sind schwer wie Blei.«
Fee sprach ein Machtwort. »Sie fahren jetzt heim. Keinen Widerspruch. Heute nachmittag haben wir nur die angemeldeten Patienten, und die Rechnungen können auch warten.«
»Es tut mir leid«, sagte Molly bedrückt, »aber heute will es einfach nicht.«
»Das geht doch jedem mal so«, meinte Fee begütigend. »Sie sind urlaubsreif.«
Ganz verschreckt sah Molly die junge Frau Doktor an.
»Habe ich nachgelassen?«
»Aber Molly, jeder Mensch braucht mal Urlaub. Jetzt habe ich mich doch schon reingefunden.«
»Können das denn schon die Wechseljahre sein? So alt bin ich doch noch gar nicht.«
»Da haben Sie nun zwei Ärzte um sich herum, und keiner nimmt sich Zeit, Sie mal zu untersuchen. Schlimm ist das. Aber gleich am Montag wird das nachgeholt. Oder besser sofort?«, fragte sie.
»Gott bewahre, ich bin nur ein bisschen schlapp«, erwiderte sie. »Tut mir leid, dass ich Sie heute auch noch belästige.«
»Das will ich aber nicht hören«, sagte Fee.
Im Nachhinein machte sie sich dann noch mehr Gedanken. Molly hatte wirklich erschöpft ausgesehen. Gab es etwa wieder häusliche Sorgen?
Ich muss mich mal wieder um sie kümmern, nahm Fee sich vor und beschloss, am Nachmittag Molly anzurufen. Oder sollte sie besser vorbeifahren?
Daniel brauchte mit Frau Hansel fast eine halbe Stunde. Sie war die Letzte, aber anscheinend hatte sie das so eingerichtet. Als sie dann endlich ging, für Daniel ein neckisches Lachen und für Fee einen anmaßenden Blick, stöhnte er.
»Sie kann einem den letzten Nerv töten«, sagte er, und das bedeutete viel bei ihm, denn immer hegte er Patienten gegenüber Nachsicht. »Fee, ich danke dem Schöpfer, dass er mir nicht eingab, Gynäkologe zu werden.«
»Dann hätte ich dich nicht geheiratet«, erklärte sie sofort.
»Ich hätte aber keine andere gewollt.«
»Und ich hätte gezählt, wie oft du in Versuchung geführt wirst. So haben wir doch wenigstens auch ein paar Männer.«
»Ach ja, Herr Billing war heute wieder da«, sagte er anzüglich.
»Und hat mir sein tiefstes Bedauern ausgedrückt, dass ich schon verheiratet bin.«
»Das nächste Mal übernehme ich ihn«, sagte Daniel verärgert.
»Ach was, er schätzt dich genauso, und er gibt mir wenigstens das Gefühl, dass ich hier nicht überzählig bin.«
»Heute bist du aber auch ganz schön in Trab gehalten worden.«
»Ja, so sehr, dass ich nicht ausreichend beachtet habe, dass es Molly nicht gutgeht.«
»Was? Was tut ihr denn weh?«
»Sie sagt nichts. Ich glaube, sie hat Angst, dass sie nicht mehr gebraucht wird.«
»So was Dummes. Na, das werden wir ihr doch ausreden können!«
»Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen, Dan. Ich werde nachher mal zu ihr fahren, wenn du Besuche machst.«
»Meine Güte, sie kann doch den Mund auftun. Aber wenn du meinst, Fee, dann kümmere dich mal um sie.«
Und so kam es dann, dass sie nicht erfuhren, was in der Behnisch-Klinik geschehen war. Das sollte erst am späten Nachmittag geschehen, und diesmal unter dramatischen Umständen für Fee, denn sie fand eine fiebernde Molly vor, als sie zu ihr kam. Heinz Moll war ganz aus dem Häuschen.
»Sie wollte Ihnen das Wochenende nicht verderben, Frau Doktor«, sagte er beklommen. »Aber so geht es doch nicht.«
»Nein, so geht es nun wirklich nicht«, sagte Fee energisch.
»Das ist der Blinddarm, Molly, und der muss schleunigst raus«, sagte Fee. Und schon eilte sie auch zum Telefon.
»Mein Gott, mein Gott«, stöhnte Heinz Moll.
»Der kann uns jetzt nicht helfen. Nur ein tüchtiger Chirurg.« Und da hatte sie auch schon Dr. Behnisch an der Strippe.
»Habe schon versucht, dich zu erreichen, Fee«, sagte er. »Hat sich allerhand getan.«
Dafür hatt Fee jetzt kein Ohr. Sie war besorgt um Molly, und das sagte sie ihm auch hastig.
Zehn Minuten später war der Krankenwagen da, und Fee fuhr mit Molly, ihre Hand tröstend haltend und die Tränen trocknend, die ihr über die Wangen rannen.
»Da sehen Sie, was für eine Ärztin ich bin«, klagte sie sich selbst an.
»Es ist doch erst zu Hause schlimmer geworden«, flüsterte Molly.
Und wenn nun ihr Zähnezusammenbeißen schlimme Folgen gehabt hätte? Wenn es ausgerechnet für Molly keine Rettung mehr gäbe? Fee wusste, wie tückisch ein Blinddarm sein konnte. Mit jedem Wort des Trostes für Molly sprach sie sich auch selbst Mut zu.
*
Daniel kam verhältnismäßig früh von seinen Besuchen zurück.
»Ist Fee immer noch nicht zurück?«, fragte er Lenchen.
»Hat angerufen«, erwiderte sie so schleppend, dass Daniel aufhorchte. »Hat Molly in die Klinik gebracht. Blinddarm.«
»Liebe Güte«, seufzte Daniel. »Dann adieu, Lenchen.«
Molly war schon im Operationssaal, als Daniel kam. Fee lief blass und aufgeregt im Warteraum hin und her. Sie fiel ihm in die Arme.
»Ich kann es mir nicht verzeihen, Daniel«, schluchzte sie auf. »Ich hätte es doch sehen müssen.«
»Durchsichtig sind die Menschen halt leider nicht, Liebes«, sagte er tröstend.
Sie hielten sich bei den Händen und warteten und ahnten nicht, dass Bettina jetzt bei André Clermont war.
Sie war erst zu ihm gegangen, als sie ihre Selbstbeherrschung wiedergefunden hatte, aber er hatte noch lange geschlafen, wie einer, dem schon eine schwere Last von der Seele genommen worden war.
Sie wagte jetzt seine Hand zu streicheln, die schmal und blass auf der Bettdecke lag. Und als sie dann endlich noch wagte, ihre Hand an seine Wange zu legen, schlug er die Augen auf. Aber er schloss sie gleich wieder.
Ich träume, dachte er. Das kann nur ein Traum sein.
»Bébé«, flüsterte er.
»André«, flüsterte sie zurück.
Er nahm ihre Hand und legte sie auf seine Lippen. Und sie legte ihren Mund an seine Wange. Und so blieben sie minutenlang, stumm vor Erschütterung und Glück.
»Dass du auch hier bist, hat dein Vater mir nicht gesagt«, kam es dann stockend über Andrés Lippen. »Sonst hätte ich nicht schlafen können.«
»Der Schlaf hat dir gutgetan.« Und er hat nichts von der Aufregung mitbekommen, dachte sie weiter. Was wäre geschehen, wenn Laila bis zu seinem Zimmer vorgedrungen wäre?
»Ich habe dir sehr viel zu sagen, Bébé.«
»Wir werden sehr viel Zeit dafür haben, liebster André. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet, immer gewartet und gebangt.«
»Das wusste ich nicht. Ich dachte, du würdest mich gern vergessen wollen.«
»Nie«, sagte sie leise. »Vergessen hätte ich dich nie.«
Nun war alles so einfach, dass sie sich wohl fragen mussten, warum sie sich so gequält hatten. Sie hatten sich wieder, und alles andere Zeit.
Sie waren glücklich, so weit man in dieser Umgebung glücklich sein konnte. Mit der Kraft ihrer Liebe wollte Bettina zu seiner Genesung beitragen.
»Nun werde ich jeden Tag bei dir sein und immer auf dich aufpassen«, sagte sie, bevor sie ihren Mund auf seinen legte. Endlich, endlich konnten sie sich ganz nahe sein.
*
Endlich wurden auch Fee und Daniel von ihrem unruhevollen Warten erlöst. Dr. Jenny Lenz brachte ihnen die Nachricht, dass die Operation gut verlaufen sei, wenngleich es auch höchste Eisenbahn gewesen wäre. Ja, da rätselten selbst Ärze, wie mancher Mensch Schmerzen ertrug, andere wegen Lappalien ein Mordstheater veranstalteten.
Molly lag zwar noch in der Narkose, aber Fee und Daniel wollten doch warten, bis sie in ihr Zimmer gebracht wurde, und Daniel verließ schnell noch mal die Klinik, um Blumen für Molly zu besorgen, damit gleich welche am Bett standen, wenn sie erwachte.
Der Laden sollte gerade geschlossen werden, als er kam. Es war also schon halb sieben Uhr geworden. Dafür bekam er aber einen besonders schönen Strauß, denn auch hier war er wohlbekannt. Die Besitzerin gehörte auch zu seinen Patientinnen. Ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch musste er schon erübrigen.
Als er dann in die Klinik zurückkam, hatte sich bereits die ganze Familie Moll in der Halle versammelt. Heinz Moll und die Kinder Sabine, Peter und Katrin.
Sabine war eine hübsche junge Dame, aber jetzt hatte sie verweinte Augen. Peter, der langaufgeschossene Junge, war bleich, und die Jüngste, Katrin, klammerte sich an ihren Vater.
»Es wird ja alles gut werden«, sagte Daniel tröstend. »Die Operation ist gut verlaufen. Morgen könnt ihr eure Mutter besuchen.«
Ja, wenn der Mutti so etwas passierte, wollte man es nicht begreifen. Sie, die immer für ihre Familie da war, die sich kaum Ruhe gönnte, wurde schwer vermisst, und wenn der Anlass auch höchst unerfreulich war, meinte Daniel Norden doch, dass es der ganzen Gesellschaft mal guttäte.
Blumen mitzubringen, hatten sie in ihrer Aufregung vergessen, und als Heinz Moll das ganz niedergeschlagen bemerkte, sagte Daniel aufmunternd: »Dann teilen wir eben den Strauß. Heute Nacht wird Molly ohnehin schlafen.«
Aber einen Blick wollten sie doch in das Krankenzimmer werfen. Wenigstens sehen wollten sie ihre Mutti.
Fee schien verschwunden. Daniel fand sie bei Dieter Behnisch.
»Du wirst staunen, was sich hier getan hat, Dan«, sagte Fee hastig. »Es ist nicht zu fassen, was in ein paar Stunden alles geschehen kann.«
Das war wahrhaftig ein ereignisreicher Tag, ein buntes Gemisch von Schmerz und Freude, Aufregung und Erleichterung. Sie hatten sich viel zu erzählen, doch Bettina bekamen sie nicht zu Gesicht, denn André Clermonts Zimmer wollten sie doch nicht betreten, so gern Fee Bettina auch die Hand gedrückt hätte.
Dafür lernte sie dann aber Karl Herzog kennen, dem es doch unheimlich geworden war, weil Bettina gar nichts von sich hören ließ.
Als er erfuhr, dass sie noch immer bei André war, glitt ein Lächeln über sein Gesicht.
»Ihnen haben wir sehr viel zu verdanken, dass Sie so schnell gehandelt haben«, sagte er, »und auch, dass Sie meiner Tochter beistanden.«
Nun, jetzt würden sie sich öfter sehen, denn es war selbstverständlich, dass Daniel und Fee jeden Tag wenigstens einen kurzen Besuch bei Molly machen würden. Das musste schon herausspringen, wenn ihnen Mollys tatkräftige Unterstützung in der Praxis sehr fehlen würde.
Wie aber war es zu Lailas Verhaftung gekommen? Das wusste bisher niemand außer Karl Herzog. Und der schwieg sich darüber noch aus. Er hatte auch keine Ahnung, dass sie bereits etwas gestanden hatte, dessen sie von Karl Herzog gar nicht beschuldigt worden war.
Doch während Laila sich ausweglos in ihrem eigenen Lügengewebe verstrickt hatte und sich immer mehr verstrickte, um sich selbst reinzuwaschen, schlief André mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen einem neuen Tag entgegen, der schon der Anfang eines neuen Lebensabschnittes sein sollte, und Karl Herzog konnte seine glückliche Tochter in dieArme nehmen, die jetzt allerdings sehr müde war. Über Laila sprachen auch sie heute nicht mehr.
*
Über Laila sprachen aber Poldi und Ricky, wenn es ihm auch gar nicht so leicht fiel, als Ricky so schüchtern vor ihm saß, die Hände ineinander verschlungen, immer wieder die Augen niederschlagend, wenn er sie forschend anblickte.
Mit Ricky konnte man nicht reden wie mit Laila. Poldi fragte sich nur, wie sie ausgerechnet den Job in dem Lokal annehmen konnte. Und er fragte auch sie.
»Wo kann man sonst nachts arbeiten?«, fragte sie. »Tagsüber muss ich doch lernen.«
»Wie kann man lernen, wenn man nachts nicht schläft?«
»Man gewöhnt sich daran. Außerdem ist bei dem Job das meiste Geld zu verdienen.«
»Ist dir Geld sehr wichtig?«
»Meine Güte, Sie müssten doch auch wissen, was der Lebensunterhalt kostet, aber Sie brauchen ja nicht zu rechnen«, sagte sie trotzig.
»Findest du es eigentlich richtig, dass du immer noch Sie zu mir sagst?«, fragte Poldi mit einem weichen Lächeln. »Schließlich haben wir uns schon geküsst.«
»Sie haben mich geküsst«, konterte sie.
»Wie wäre es denn, wenn du mich auch mal küssen würdest, bevor ich dir einen Heiratsantrag mache?«
Jetzt schlug sie die Augen nicht mehr nieder, sondern sie weiteten sich staunend.
»So weit sollte der Spaß eigentlich nicht gehen«, sagte sie leise.
»Es ist doch kein Spaß, Ricky. Dass es so schnell kommen würde, habe
ich gestern Abend auch noch nicht
geahnt, aber als ich mit Laila das Lokal verließ und du mich so anschautest –«
Er unterbrach sich.
»Wie schaute ich?«, warf sie ein.
»Man kann es nicht so ausdrücken. Ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, obgleich ich nur meinem besten Freund und einer sehr guten Freundin helfen wollte. Und nun denk nicht gleich wieder was Falsches. Bettina Herzog ist wirklich nur eine gute Freundin, sie liebt einen anderen Mann.«
Vielleicht machte Ricky etwas in seinem Tonfall stutzig. »Sie liebt einen anderen Mann, aber du liebst sie«, sagte sie leise.
Poldi war überrascht, aber er hatte beschlossen, ganz ehrlich zu sein, denn schließlich war es ihm wirklich ernst mit dem Heiratsantrag, und er fand es gut, wenn vorher alles geklärt war.
»Ich habe sie geliebt. Das gebe ich zu. Aber es war von Anfang an aussichtslos. Sie hat es auch nie erfahren. Für Bettina gab es immer nur André. Man sagt, dass Liebe der Anfang oder das Ende einer Liebe sein kann. Für mich war es das Ende. Die Freundschaft aber wird immer bleiben, und es werden auch deine Freunde werden, kleine Ricky. Laila ist ein Biest, um nicht ein schlimmeres Wort zu gebrauchen. Ich durfte nicht zulassen, dass sie noch mehr Schaden anrichtet. Von einer solchen Frau kann man sehr viel erfahren, wenn sie meint, einen Mann in der Hand zu haben. Liebe – das ist für sie nur ein Wort. Sie ist eiskalt und berechnend. Sie hat Bob Clermont beherrscht. Sie hat ihn nur geheiratet, um ihn für ihre Zwecke zu benutzen, und er war ihr hörig. Er hat alles für sie getan, bis ihm klar wurde, dass er nur Mittel zum Zweck für sie war, und da hat er dann Schluss gemacht mit dem ohnehin verpfuschten Leben. Ich möchte aber doch einräumen, dass ihn auch das Gewissen plagte, die so viel wertvollere Bettina hintergangen zu haben.«
»Und du verspürtest gar keine Gewissensbisse wegen dieser Nacht?«, fragte Ricky, nachdem sie seinen Kuss nun doch erwiderte. »Ist das nicht abscheulich?«
»So schlimm ist es nicht gekommen. Weißt du, Laila liebt die Hinhaltemethode, und ich bin auch nicht von gestern. Man kann sich schon mit einigem Geschick aus ganz gefährlichen Situationen herauslavieren. Warst du noch nie in einer solchen Situation?«
»Doch. Ich habe mich auch herauslaviert«, erwiderte sie. »Ich bin auch nicht von gestern, und wenn man solch einen Job annimmt, muss man sich seiner Haut zu wehren wissen.
Allerdings habe ich nie gedacht, dass er mir dazu verhelfen würde, dass ein Professor mir einen Heiratsantrag macht.«
»Dozent, mein Mädchen«, berichtigte er sie, »aber in Anbetracht dessen, dass ich eine Familie zu gründen beabsichtige, werde ich wohl auch mehr Ehrgeiz entwickeln und es möglicherweise doch noch zum Professor bringen.«
»Dann muss ich aber wenigstens mein Staatsexamen vorher machen«, erwiderte sie.
»Wozu? Lerne lieber Maschinenschreiben, damit ich nicht mehr selbst tippen muss.«
»Das kann ich«, sagte Ricky. Und da bekam sie wieder einen sehr zärtlichen und langen Kuss.
»Was du alles kannst«, raunte er ihr ins Ohr. »Jetzt kann ich nur hoffen, dass du mich auch ein bisschen liebst.«
»Sonst wäre ich gestern Abend nicht so traurig gewesen und wäre jetzt nicht hier«, erwiderte sie leise.
*
»Ja, dann werden Sie uns wohl bald wieder verlassen«, sagte Annette von Rosen, als Karl Herzog ihr Bericht erstattet hatte.
»Nicht gar so bald. Es gibt noch eine Menge zu regeln. Außerdem habe ich den Kindern versprochen, mit ihnen in den Tierpark zu gehen. Mein Gott, wie lange ist es her, dass ich dort war. Ich freue mich richtig darauf. Schön wäre es ja, wenn Sie auch mitkommen würden.«
»Aber das geht leider nicht. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch«, erwiderte sie humorvoll.
»Noch dazu, wenn die Katze gar keine Krallen hat«, bemerkte er. »Wie lange wollen Sie das noch machen?«
»Bis die Kinder versorgt sind«, erwiderte Annette. »Es geht nicht anders. Wir leben von den Einnahmen.«
»Bei allem Respekt, haben Sie noch nicht daran gedacht, zu heiraten?«, fragte er.
»Nein, daran habe ich nie gedacht.«
»Haben Sie Ihren Mann so sehr geliebt?«
»Wir haben eine sehr glückliche Ehe geführt. Dann war er ziemlich lange krank.«
»Und da bekommt man einen Schock. Aber Sie sind doch noch zu jung, um immer allein zu bleiben.«
»So jung nun auch wieder nicht mehr«, erwiderte Annette gelassen.
»Die Buben brauchen noch lange, bis sie mal auf eigenen Füßen stehen. Ich hoffe, dass Sie mich nicht falsch verstehen, wenn ich sage, dass sie eine sehr energische Hand brauchen.«
»Das weiß ich sehr gut«, sagte sie seufzend.
»Na, darüber reden wir noch mal«, meinte er beiläufig. »Was mich betrifft, könnte ich mir jetzt seltsamerweise sehr gut vorstellen, doch noch einmal zu heiraten. Wenn Bettina mich dann auch im Stich lässt, würde es sehr einsam um mich. Sie können es sich ja mal überlegen. Es braucht nicht heute und morgen zu sein.«
Fassungslos sah ihn Annette an. »Was soll ich mir überlegen?«, fragte sie.
»Ob Sie sich vorstellen könnten, mich zu heiraten. Ich bin zwar ein Mann schneller Entschlüsse, aber keiner unüberlegten. Ich gestehe auch offen, dass ich selbst überrascht bin, auf meine alten Tage noch auf diesen Gedanken zu kommen, aber es sind sehr angenehme Gedanken«, bekannte er lächelnd.
»Sie und alt!«, sagte Annette verwirrt. »Ein Mann, für den eine Siebzehnjährige schwärmt. Cécile hat gesagt, dass sie sich in Sie verlieben könnte.« Sie errötete, weil ihr das herausgerutscht war.
»Das finde ich reizend, aber an sich wäre es mir lieber, Céciles Mama würde ähnliche Gedanken hegen. Bin ich zu direkt? Das ist leider eine meiner schlechten Eigenschaften.«
»Ich finde, dass es eine liebenswerte Eigenschaft ist«, sagte Annette. »Sie haben mich in Verlegenheit gebracht, Herr Herzog. Wirklich.« Sie wirkte hilflos wie ein junges Mädchen.
Er ergriff ihre Hand und zog sie an die Lippen. »Sie werden es sich durch den Kopf gehen lassen, darum bitte ich Sie. Sie würden mich glücklich machen.« Und dann sagte er ihr gute Nacht und zog sich in sein Zimmer zurück.
Wie eine Träumende ging Annette in ihres. Müde war sie von einem langen Arbeitstag, aber seit Karl Herzog im Hause war, verspürte sie nicht mehr die Resignation, der Verantwortung doch nicht gewachsen zu sein. Was es doch ausmachte, wenn ein Mensch da war, der Verständnis hatte, der ihr liebe Worte sagte. Die Kinder waren zu jung, um ganz zu begreifen, was der Alltag von ihr forderte, wieviel Kraft sie brauchte, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Sie liebte ihre Kinder. Sie war bereit, alles für sie zu tun, aber es war so gut, wenn man sich an eine starke Schulter anlehnen konnte. Es erging ihr genauso wie Isabel Guntram oder wie Ricky, und unter den Dächern dieser großen Stadt mochten auch viele andere die gleiche Sehnsucht haben.
Sie konnte es sich gut vorstellen, an der Seite dieses Mannes zu leben, der ihr so direkt und doch so liebevoll seine Gedanken verraten hatte. Nur der Gedanke schreckte sie, dass jemand meinen könnte, sie suche materielle Sicherheit.
Plötzlich huschte Cécile zur Tür herein. Sie hatte ihr Zimmer neben ihr. Manchmal, wenn Annette abends nicht zu müde war, plauderte sie noch mit ihrer vernünftigen Großen, die sich so sehr bemühte, ihr zu helfen, aber heute war es doch schon sehr spät.
»Mami, ich würde dich gern was fragen«, flüsterte Cécile.
»Was denn, Kind?«
»Magst du ihn? Ich habe es zufällig gehört. Das war doch ein Heiratsantrag.«
»Nicht so direkt, Cécile.«
»Er war sehr direkt. Und er war einfach himmlisch. Warum hast du nicht ja gesagt, Mami? Was meinst du, wie närrisch die Buben wären. Und ich würde mich auch schrecklich freuen. So was passiert einem doch nur einmal im Leben.«
Annette erschrak fast. Dachte Cécile denn gar nicht mehr an ihren Vater?
Nur einmal im Leben. Es kann einem auch zweimal passieren, ging es ihr durch den Sinn. Und es ist ein Geschenk des Himmels, wenn man zum zweiten Mal der Liebe begegnen darf.
»Zu bieten hast du doch auch schließlich was«, meinte Cécile realistisch, als könne sie ihre Gedanken erraten. »Weißt du, ein Mann wie Herzog Karl weiß, was er will. Ich würde sofort ja sagen, wenn er mir einen Heiratsantrag machen würde.«
»Cécile!«, rief Annette aus.
»Lieber Gott, wäre ich doch nur zwanzig Jahre älter«, seufzte Cécile. »Natürlich würde ich ihn viel lieber als Daddy haben, aber wenn er wieder ganz aus unserem Leben verschwinden würde, wäre ich sehr traurig und meine Brüder auch.«
Und ich auch, dachte Annette.
»Bettina hätte bestimmt nichts dagegen«, sagte Cécile. »Ich glaube sogar, dass es ihr sehr recht wäre, wenn ihr Daddy nicht allein ist. Sie wird ja nun bald heiraten.«
»Was du alles weißt«, meinte Annette kopfschüttelnd.
»Ich habe halt Augen und Ohren offen, Mami. Du hast doch gesagt, dass es so sein muss, wenn man im Leben weiterkommen will.«
Dazu gab es nichts zu sagen. Cécile war ein selbständiges Persönchen. Viel selbständiger und auch selbstsicherer, als sie es selbst in diesem Alter gewesen war. Und das war gut so. Aber auch Cécile hatte den Wunsch nach einem richtigen Familienleben, das war Annette heute deutlich geworden.
Ja, Karl Herzog hatte es ihr bewusst gemacht, dass sie ihre Familie so nicht zusammenhalten konnte. Die Buben wuchsen ihr über den Kopf, daran konnte auch Cécile nichts ändern. Sie wurde mit den beiden Burschen auch nicht fertig. Aber bei Karl Herzog genügten schon ein paar Worte. Wie gut er mit diesen Kindern umzugehen wusste!
Annette spürte noch den besonders zärtlichen Kuss von Cécile auf der Wange, als sie einschlief, und Karl Herzogs gütiger Blick begleitete sie in ihre Träume.
*
Dr. Behnisch war tief bestürzt, als am nächsten Morgen schon gegen neun Uhr zwei Herren von der Kriminalpolizei in der Klinik erschienen und Dr. Clermont zu sprechen wünschten.
»Das ist unmöglich«, sagte er. »Dr. Clermont ist schwer krank.«
»Wir brauchen dringendst eine Zeugenaussage von ihm«, erklärte der Größere von beiden. »Wahrscheinlich lässt sich dann seine schwere Krankheit erklären.«
»Sie glauben zu wissen, wodurch sie hervorgerufen wurde?«, fragte Dr. Behnisch.
»Es besteht die Wahrscheinlichkeit. Allerdings müssen wir dazu erst Dr. Clermont anhören.«
Dr. Behnisch atmete auf. Er hatte schon gefürchtet, dass eine Anzeige gegen seinen Patienten vorliegen würde, und das hätte das ganze Bild, das er sich über ihn gemacht hatte, zerstört.
»Darf ich fragen, was mit Frau Clermont geschehen ist?«, fragte er.
Die beiden Beamten tauschten einen langen Blick. »Sie befindet sich in Haft«, wurde ihm dann geantwortet. »Es ist jedoch an ihrer Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln.«
Mehr erfuhr Dr. Behnisch nicht. Es war nicht viel, aber irgendwie beruhigend in Bezug auf André Clermont. Er wollte sich aber doch erst überzeugen, wie das Befinden seines Patienten an diesem Morgen war. Überraschend gut, wie er dann feststellen konnte. André war fast fieberfrei.
»Es wäre Besuch für Sie da, Herr Clermont«, sagte Dr. Behnisch vorsichtig.
»Immer herein damit«, erwiderte André froh, »wenn ich so früh auch nicht damit gerechnet habe.«
»Es ist kein privater Besuch«, fuhr Dr. Behnisch fort.
»Wer dann?«, fragte André.
»Zwei Herren von der Kriminalpolizei, die eine Aussage von Ihnen haben möchte. Es betrifft wohl Ihre rätselhafte Erkrankung.« Hoffentlich hatte er sich diplomatisch genug ausgedrückt.
»Haben Sie die Polizei eingeschaltet?«, fragte André nachdenklich.
»Nein, ich nicht, obgleich wir auch noch nicht sicher sind, was die eigentliche Ursache ist.«
»Ich kann es mir auch nicht erklären«, sagte André. »Ich überlege fortgesetzt, aber …« Dann unterbrach er sich plötzlich und starrte vor sich hin.
»Nun, dann werde ich mir wohl anhören müssen, was die Herren von mir wollen, aber wenn privater Besuch kommen sollte, halten Sie ihn bitte zurück.«
»Selbstverständlich, Herr Clermont. Und wenn es Ihnen zu viel oder zu unbehaglich werden sollte, läuten Sie. Hier habe ich mehr zu sagen als die Polizei.«
»Sie sind nett«, sagte André lächelnd. »Ich habe ein reines Gewissen. Aber jetzt bin ich neugierig.« Seine Neugierde wurde voll befriedigt, wenn André anfangs auch mehr als überrascht war. »Laila hat es gewagt, hierherzukommen«, fragte er staunend, als man ihm gesagt hatte, dass sie sich in polizeilichem Gewahrsam befände. »Sie schreckt wahrhaftig vor nichts zurück. Sie ist mir um die halbe Welt gefolgt.«
»Und wie hat sie Sie gefunden und wo?«
»Als ich zur Beisetzung meiner Mutter kam, die vor einem halben Jahr verstarb. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwelche Rücksichten nehmen muss. Laila war es, die meine Mutter gegen Bettina Herzog und auch gegen mich aufhetzte. Meine Mutter blieb lange unversöhnlich. Dann muss sie etwas herausgefunden haben, was sie misstrauisch gegen Laila machte. Sie schrieb mir nach Mumbay, dass sie sich in einem schrecklichen Irrtum befunden hätte und bat mich zu kommen. Aber ich kam zu spät. Sie war bereits tot.«
»Ist sie eines natürlichen Todes gestorben?«, wurde er gefragt.
»Daran habe ich nicht gezweifelt. Sie kränkelte seit dem Tode meines Bruders. Aber sie gestattete mir ja nicht, etwas für sie zu tun. Der Grund war eine ganz interne Familienangelegenheit.«
»Wir wissen Bescheid, Herr Dr. Clermont. Frau Clermont hat mehr gesagt, als wir eigentlich erwartet hatten. Es steht zu fürchten, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Sie bekam einen Tobsuchtsanfall und wird aller Wahrscheinlichkeit nach in eine geschlossene Anstalt überführt werden müssen. – Strengt Sie das Gespräch nicht zu sehr an, Herr Dr. Clermont? Wir wollen uns nicht den Unwillen des Chefarztes zuziehen.«
»Nein, es strengt mich nicht an. Bitte, sprechen Sie weiter, oder fragen Sie.«
»Wie oft ist Ihnen Frau Clermont dann noch begegnet?«
»Zweimal, nein, dreimal«, erwiderte André. »Sie zeigte großes Interesse an der Hinterlassenschaft meines Bruders, aber ich wusste noch nicht, woran sie so besonders interessiert war. Das erfuhr ich dann erst, als mir der Anwalt meiner Mutter gewisse Papiere übergab, und ich hatte allen Grund, diese nicht in Lailas Hände kommen zu lassen.«
»Misstrauten Sie ihr schon damals?«
»In gewisser Beziehung ja, aber nicht hinsichtlich des Vergehens meines Bruders. Ich konnte einfach nicht glauben, dass eine Frau so rigoros vorgehen könnte. Sie hatte den Plan ausgeheckt, nicht Bob. Er war ein Werkzeug in ihren Händen. Verrückt, aber es ist eine Tatsache, um die ich nicht herumreden kann.«
»Und die wir bereits kennen. Wann trafen Sie Frau Clermont zuletzt?«
»Drei Tage, bevor ich nach München fuhr. Ich wollte meinen Freund hier treffen.«
»Herrn Steiger?«
»Das wissen Sie auch?«
»Herrn Steiger und Herrn Herzog ist es zu verdanken, dass wir Frau Clermont verhaften konnten. Übrigens wurde sie bereits gesucht. Ihre Mutter hatte vor ihrem Tode Anzeige gegen sie erstattet wegen Erpressung.«
»Mein Gott«, sagte André leise. »Das ist schrecklich. Sie hat es also gewagt, diese verwirrte Frau zu erpressen.«
»Hat sie das nicht auch bei Ihnen versucht?«
»Nein, mich wollte sie mit allen Mitteln betören. Aber ich ahnte ja, dass sie nur die Papiere wollte, die Bob hinterlassen hatte. Sie allerdings ahnte wohl nicht, dass auch er die ganze Wahrheit niedergeschrieben hatte. Das war auch meiner Mutter bekannt geworden. Es muss ein schrecklicher Schock für sie gewesen sein. Sie hätte Bob das nie zugetraut. Ich übrigens auch nicht. Ich wusste anfangs nur, dass er, obgleich er verheiratet war, sich mit Bettina Herzog verlobt hatte. Das heißt, ich erfuhr es erst, als Bettina die Verlobung gelöst hatte. Da lernte ich Laila kennen, die mir gegenüber behauptete, dass Bettina ihre Ehe zerstört hätte. Das wusste ich allerdings besser. Laila verschwand sehr schnell von der Bildfläche, und alles andere habe ich Ihnen ja schon gesagt.«
»Noch nicht, wie Sie zu dieser Verletzung gekommen sind.«
»Es war Lailas Brosche. Eine Brillantnadel in Form eines Salamanders.« Seine Stimme wurde leiser, sein Gesicht nachdenklicher. »Ich sagte Ihnen schon, dass sie mich mit allen Mitteln betören wollte. Sie rückte mir, auf deutsch gesagt, auf den Pelz, hautnahe. Ich war verblüfft, denn ich hatte ihr vorher gesagt, dass ich sehr vieles wüsste. Ich wollte sie abwehren, und da ritzte ich mich, denn die Nadel stand offen. Sie trug sie an der linken Schulter.«
»Nehmen wir an, der Stich wäre anstatt in die Hand in Ihre Brust gegangen, etwa in die Herzgegend?«, fragte der Beamte.
Andrés Augen weiteten sich. »Soll das heißen, dass die Nadel vergiftet war? Ich glaubte, dass ich mich nachträglich irgendwie infiziert hatte. Der Ritz war ziemlich tief. Er blutete auch. Was für ein Gift sollte es gewesen sein?«
»Eine tödliche Dosis Atropin.«
»Unmöglich. An einer Nadel? Ich verstehe allerhand von Giften.«
»Es war eine Hohlnadel. Sie haben sich nur daran geritzt. Wäre es Frau Clermont gelungen, die Nadel direkt in Ihren Körper zu praktizieren, würden Sie heute nicht mehr leben. Es war ein Mordversuch. Sie hat es selbst zugegeben, weil sie meinte, dass Sie Anzeige gegen sie erstattet hätten. Sie war sehr erregt und hat vorher viel gesagt, was uns stutzig machte. Manch einer schaufelt sich sein eigenes Grab, Herr Dr. Clermont.«
»Die Frau muss wahnsinnig sein«, sagte André erschöpft.
»Wahrscheinlich ist sie das. Sie hat lange in panischer Furcht gelebt und unter Verfolgungswahn gelitten. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sie Ihren Bruder in denTod getrieben und Ihre Mutter auch. Bei Ihnen wollte sie wohl ihre weiblichen Reize als Kampfwaffe anwenden, und als sie merkte, dass dies vergeblich war, blieb nur noch Hass und Vernichtungswillen und wohl Angst um ihr eigenes Leben. Nun wäre dieser Fall geklärt. Eine Sühne wird er wohl kaum finden, wenn man geistige Umnachtung nicht als schlimme Strafe betrachten will.«
»Es ist grauenvoll«, sagte André leise. »Wohin kann sich ein Mensch verirren?«
*
»Jenny ist enorm«, sagte Dr. Behnisch zu Dr. Norden. »Sie hat gleich auf Atropin getippt. Diese Laila Clermont ist ein teuflisches Weib.«
»Wir wollen froh sein, dass es auch genügend Engel gibt«, sagte Daniel.
»Mein Engel ist Jenny«, meinte Dr. Behnisch, »aber es wird wohl noch einige Zeit brauchen, um ihr das klarzumachen.«
»Sie läuft dir schon nicht davon«, sagte Daniel lächelnd. »Jetzt haben wir ja erst mal ein glückliches Paar.«
»Bettina Herzog wird tüchtig zu schlucken haben, bis sie richtig glücklich sein kann. Und sie wäre wohl todunglücklich geworden, wenn Clermont nicht überlebt hätte.«
Dies alles zu überlegen, jagte Daniel ein Schaudern über den Rücken, und es war ein Glück, dass sie sich wenigstens um Molly keine großen Sorgen zu machen brauchten. Sie war zwar noch sehr mitgenommen und wollte nicht begreifen, dass sie wenigstens zehn Tage in der Klinik bleiben musste und dann auch nicht gleich wieder arbeiten durfte, aber sie war doch heilfroh, dass es noch so abgegangen war.
Nun wurde sie von ihrer Familie tüchtig verwöhnt. Immer war einer bei ihr, immer schön abwechselnd, und selbst Lenchen raffte sich zu einem Besuch auf, obgleich sie Klinikluft doch gar nicht mochte.
Molly wurde von allen Seiten beruhigt, dass sie ganz bestimmt nicht auf ein Abstellgleis geschoben werden würde. Jetzt sollte sie sich richtig auskurieren und erholen, solange Fee noch in der Praxis mithelfen konnte.
»Und wenn dann nächstes Jahr das Baby erst da ist, kann der Doktor doch nicht auf Sie verzichten, Molly«, meinte Lenchen. »Sie wissen doch, dass er sich an neue Gesichter nicht gewöhnen kann.«
Am Nachmittag des nächsten Tages traf Fee Bettina in der Klinik. Sie begrüßten sich herzlich.
»Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen«, sagte Bettina. »Eigentlich hätte ich Ihnen längst Bericht erstatten müssen.«
Fee lachte leise. »Wir wissen schon eine ganze Menge«, erwiderte sie. »Und vielleicht können wir mal zu viert ganz gemütlich beisammensitzen, wenn Dr. Clermont erst wieder ganz hergestellt ist.«
Bettina errötete leicht. »Ich wollte Sie nämlich schon fragen, ob auf der Insel der Hoffnung ein Platz – nein, zwei – für uns frei wären. Dr. Behnisch meint, dass André in zehn Tagen entlassen werden kann. Dann wollen wir heiraten, und ich dachte mir, dass anstelle einer Hochzeitsreise ein Kuraufenthalt André besser bekommen würde.«
Fee lächelte in sich hinein. Flitterwochen auf der Insel der Hoffnung, das hatten sie noch nicht gehabt.
»Wenn Dr. Clermont damit einverstanden ist, wird es bestimmt möglich zu machen sein«, erwiderte sie. »Ich freue mich sehr für Sie, Bettina, dass nun doch alles gut wird.«
»Und ich danke Ihnen tausendmal für Ihre Hilfe und Ihren Beistand.«
»So viel haben wir doch gar nicht dazu getan. Wir sind sehr froh, dass sich alles so schnell geklärt hat.«
Aber im Nachhinein dachte sie dann doch daran, dass die drei bitteren Jahre Bettina endlos erschienen sein mochten. Ein langes banges Warten, viele Stunden der Angst und Hoffnungslosigkeit lagen hinter ihr, auch hinter André. Aber Bettinas Liebe war nicht zu erschüttern gewesen. Darüber war André unendlich froh, dafür war er dankbar.
Ganz schonend hatte Dr. Behnisch Bettina die ganze Wahrheit über Laila beigebracht, da André dazu doch nicht in der Lage gewesen wäre. Noch einmal erfüllte sie Angst und Entsetzen und dann auch tiefe Dankbarkeit, dass dieser schreckliche Plan missglückt war.
So skrupellos konnte eine Frau sein, eine schöne intelligente Frau, der man solches niemals zugetraut hätte. Sie war süchtig gewesen nach Geld und Macht, süchtig aber auch nach Rauschgift, wie sich dann herausstellte. Laila Clermont starb sieben Tage nach ihrer Verhaftung, geistig verwirrt, körperlich verfallen.
»Und keiner weint ihr nach«, sagte Karl Herzog zu Annette von Rosen.
»Was wird nun mit der großartigen Erfindung, um die du betrogen wurdest?«, fragte sie.
Das Du kam ihr jetzt schon leicht über die Lippen. Ein paar Tage hatte sie gebraucht, um mit sich ins Reine zu kommen, aber die Entscheidung hatte Karl Herzog ihr schließlich doch leicht gemacht. Wenn hier alles geregelt war, würde aus Annette von Rosen eine Annette Herzog werden, und ihre Kinder hatten mit Begeisterung zugestimmt.
Nun, diese Erfindung, die so viel Unheil heraufbeschworen hatte, konnte auch vollendet werden. Bob Clermont hatte die maßgebliche Formel seinem Bruder hinterlassen. Dass sie erst so spät in Andrés Besitz gelangt waren, war die Schuld einer unglücklichen Mutter, die nicht begreifen wollte, dass ihr geliebter Sohn vom geraden Wege abgewichen war, und die nicht bedacht hatte, dass ihr zweiter Sohn dadurch um Jahre seines Lebens betrogen wurde.
All dies gehörte der Vergangenheit an. Aus dem Gedächtnis zu streichen war diese nicht, aber die Bitterkeit musste dem Glück weichen, das so viel stärker war, der Liebe, die André und Bettina nun ein ganzes Leben verbinden sollte.
Karl Herzog mit seinem ungebrochenen Optimismus und seinem lebensbejahenden Humor meinte, dass für ihn das Beste dabei herausgekommen war, was er sich nur wünschen und wahrhaftig gar nicht erwarten konnte.
Niemals hätte er Annette kennengelernt, wenn Bettina nicht so beharrlich an André und ihre Liebe geglaubt hätte. Ihr dankte er sein neues Glück, wenn sie nun an Andrés Seite ein neues Leben beginnen würde. Er bekam nicht nur eine Frau, die zu ihm passte wie keine andere, er bekam drei Kinder dazu, die Freude in seinen Lebensabend bringen würden, den er genießen wollte, denn einige Überraschungen hatte er sich noch vorbehalten. Zuerst sollte André ganz gesund werden.
*
Dr. Norden und seine Frau hatten eine anstrengende Zeit hinter sich. Molly fehlte ihnen wirklich an allen Ecken und Enden, denn mit den Schreibarbeiten kannte sie sich halt weit besser aus als Fee.
Sie hatten keine Stunde abzweigen können für ihre Freunde, mit denen sie sonst doch wenigstens ab und zu beisammensaßen. Isabel beschwerte sich schon, denn Jürgen Schoeller war längst wieder auf der Insel der Hoffnung, und sie hatte ihren besten Freunden noch nicht einmal die Neuigkeiten berichten können, die sich bei ihr ergeben hatten.
Es kam so, dass Fee die wichtigste von Molly erfuhr, als sie ihr am Tage vor ihrer Entlassung noch einen Besuch in der Klinik machte.
»Was sagen Sie denn dazu, dass Frau Guntram gekündigt hat?«, fragte Molly.
»Gekündigt?«, rief Fee. »Das ist mir ganz neu.«
»Dann will ich nichts gesagt haben«, murmelte Molly verlegen. »Sabine hat es mir gestern erzählt.«
»Das gibt es doch nicht«, sagte auch Daniel, als Fee ihm die Nachricht weitergab. »Wir erfahren nichts davon. Das ist stark.«
»Isabel hat ein paarmal angerufen«, sagte Fee. »Sicher wollte sie es uns persönlich sagen, aber wir hatten ja nie Zeit. Ob sie sich mit Jürgen verkracht hat und nun von hier fortgehen will?«
»So sah Jürgen aber nicht aus, als er sich von uns verabschiedete«, meinte Daniel.
»Das ging ja auch ruckzuck, und er zeigt nie, was er fühlt. Es würde mir schrecklich leid tun für ihn, denn ich glaube, dass er Isabel sehr liebt.«
»Bei ihr ist ja kein Ding unmöglich«, brummte Daniel, »aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich, und wir sollten uns nicht die Köpfe zerbrechen, bevor wir die Gründe wissen. Schorsch wollte mich übrigens auch dringend sprechen. Er hat anscheinend auch wieder mal Weltuntergangsstimmung.«
Dr. Hans-Georg Leitner, Frauenarzt und Studienfreund von Daniel, gehörte zu ihrem engsten Freundeskreis. Ihn mussten sie ab und zu tüchtig aufmuntern. Er hatte seine glücklose Liebe zu einer verheirateten Frau, die sich dann doch für die Fortsetzung ihrer Ehe entschlossen hatte, noch immer nicht überwunden.
»Laden wir beide doch für morgen ein«, schlug Fee vor. »Dieses Wochenende werden wir doch wohl mal wieder ruhig verbringen können.«
»Du bist natürlich schrecklich neugierig, was Isabel zu erzählen hat«, neckte er sie.
»Du doch auch«, gab Fee lachend zurück, aber gleich wurde ihr Gesicht wieder nachdenklich. »Es würde mir wirklich leid tun, wenn diese schöne Freundschaft in die Brüche gehen würde.«
Zuerst war sie immer eifersüchtig auf diese Freundschaft zwischen Daniel und Isabel gewesen, aber dann war sie darin einbezogen worden,
Isabel war wirklich eine großartige Frau, die solcher Freundschaft fähig war.
»Sie geht nicht in die Brüche«, erklärte Daniel. »Darüber brauchst du dir wirklich keine Gedanken zu machen. Isabel würde nie im Streit mit Jürgen auseinandergehen. Wenn schon, dann nur in Übereinstimmung. Bei den beiden wusste man doch nie, wer wem nicht Hemmschuh sein will.«
In der Mittagspause nahm Fee sich die Zeit, Isabel und auch Dr. Leitner anzurufen, und beide sagten zu. Aber auch bei diesem Gespräch ließ Isabel kein Wort von ihrer Kündigung verlauten.
»Ich bin wirklich sehr gespannt, was Isabel uns erzählen wird«, sagte Fee nachdenklich.
»Jesses, es gibt ja noch eine Neuigkeit«, sagte Daniel. »Fast hätte ich es vergessen, Frau von Rosen wird ihre Pension aufgeben.«
»Warum? Sie ging doch recht gut«, sagte Fee überrascht. »Oder wirft sie doch nichts ab?«
»Es wird ihr wohl zu viel, und sie hat eine erfreulichere Aufgabe gefunden.«
»Was für eine?«, fragte die nichtsahnende Fee.
»Sie wird Herrn Herzog heiraten.«
»Und das erzählst du so nebenbei?«
»Männer sind halt nicht so sensationslüstern«, spöttelte Daniel.
»Ich finde es einfach schön, wenn aus Unglück so viel Glück erwächst«, sagte Fee gedankenvoll.
»Ist auch schön, Liebling. Ich gönne es ihr von Herzen. Eigentlich wäre das Haus sehr gut für eine Privatklinik geeignet, findest du nicht?«
»Liebe Güte, hast du solche Ambitionen? Dazu haben wir doch gar kein Geld, und außerdem wartet die Insel eines Tages doch auf uns.«
»Ich dachte dabei auch nicht an mich. Was soll ein Allgemeinmediziner mit einer Klinik? Mit unserer Praxis sind wir zur Genüge bedient.«
»Das meine ich auch. An wen dachtest du?«
»An Schorsch. Er fühlt sich nicht glücklich in dem Krankenhaus.«
»Aber er hat auch nicht so viel Geld, um sich selbständig zu machen.«
»Es war auch nur so eine Idee. Wahrscheinlich werden sie die Pension doch wohl verpachten.«
Immerhin war er nicht der Einzige, der eine solche Idee hatte.
Wie das manchmal bei Freunden üblich ist, gab es eine Gedankenübertragung.
Wäre Dr. Leitner selbst auch nie darauf gekommen, so doch ihr gemeinsamer Freund Dr. Behnisch, als er erfuhr, dass Frau von Rosen die Pension aufgeben wolle, um Karl Herzog zu heiraten. Bettina hatte es ihm erzählt.
Dr. Behnisch gehörte zu jenen, mit denen es Fortuna besonders gut gemeint hatte. Eine Erbschaft hatte ihn völlig unabhängig gemacht. Seine Klinik florierte von Anfang an überaus gut. Es war ihm nicht in den Kopf gestiegen. Er war mit den Füßen hübsch auf der Erde geblieben und von Natur aus ein anspruchsvoller Mensch. Ihm ging jetzt auch so manches durch den Kopf, und er richtete es so ein, dass er mit Bettina nochmals zusammentraf, als sie an diesem Abend die Klinik verließ. Es war ihr letzter Besuch bei André. Morgen sollte er entlassen werden, genau wie Molly. Ein paar Tage früher schon, als vorher abzusehen gewesen war.
»Morgen schlägt also nun die Abschiedsstunde«, sagte er. »Unser Patient kann es ja kaum noch erwarten.«
»Ein kleines Fest wird aber fällig«, sagte Bettina, »und wir hoffen doch sehr, dass Sie und Frau Dr. Lenz uns die Freude machen werden, unsere Gäste zu sein. Wir dachten an den Mittwoch.«
»Das wird sich doch mal einrichten lassen«, sagte er. »Der Rosengarten ist nicht weit entfernt. Wenn wirklich etwas Dringendes vorliegt, sind wir sofort zu erreichen. Haben Sie eigentlich schon Pläne, was dann mit der Pension geschehen soll?«
Bettina sah ihn verwundert an. »Da mische ich mich nicht ein. Das ist Annettes Angelegenheit. Allerdings wird mein Vater am Ende die Entscheidung wohl doch treffen.«
»Und vielleicht würden Sie in diesem Falle ein Gespräch mit ihm vermitteln? Ich wäre daran sehr interessiert.«
»An der Pension? Guter Gott, haben Sie mit der Klinik nicht genug am Hals?«
»Mir kam da so eine Idee. Sie müsste erst noch reifen, aber es wäre schade, wenn mir jemand zuvorkommen würde. Nein, keine Pension, aber zu einer Privatklinik, besser gesagt, zu einem Entbindungsheim würde sich das Haus doch vorzüglich eignen. Ist es sehr aufdringlich, wenn ich das so direkt sage?«
»Durchaus nicht. Ich finde, dass es eine ausgezeichnete Idee ist, und es kann nicht schaden, wenn sie überlegt wird. Wie die Dinge liegen, wird Annette mit ihrem künftigen Heim und ihrer Familie völlig ausgelastet sein. Ich kenne meinen Vater ja zur Genüge. Er ist ein Egoist, wenn auch ein liebenswerter, und er ist außerdem ein tüchtiger Geschäftsmann. Ich werde bei Annette mal vorfühlen.«
Sie verstanden sich so gut, dass Bettina das ohne Sorge tun konnte. Annette hatte sich zudem auch schon ihre Gedanken gemacht.
»Ja, mit dem Verpachten ist das so eine Sache«, sagte sie. »Ich weiß ja mittlerweile, was man hineinbuttern muss. Aber Karl meint, dass es nicht einfach sein wird, das Haus zu verkaufen. Es hat natürlich seinen Wert. Mir wäre das am liebsten, Bettina. Dann würde das Geld zu gleichen Teilen unter den Kindern verteilt werden, und ich müsste nicht das Gefühl haben, Karl zusätzliche Verpflichtungen aufzubürden.«
»Davon kann keine Rede sein, aber du wirst künftig doch kaum Zeit haben, dich um das Haus zu kümmern. Vielleicht gibt es einen ernsthaften Interessenten. Warten wir mal den Mittwoch ab.«
Nach dieser bedeutsamen Bemerkung hatten sie sich noch allerlei zu erzählen, bis Karl Herzog sich zu ihnen gesellte und fragte, was sie da aushecken würden.
»Das erfährst du noch, Daddy«, erwiderte Bettina.
»Wenn es etwa darum geht, wo eure Hochzeit gefeiert wird, muss ich sagen, dass dies bei dir liegt. Unsere«, und dabei legte er seinen Arm um Annettes Schultern, »wird bei uns zu Hause gefeiert.«
»Warum eigentlich nicht in einem Aufwasch?«, fragte Bettina.
»Nein«, protestierte Annette da. »Ihr habt so lange gewartet, und für mich gibt es noch viel zu regeln.«
»Dabei wird dir Daddy tatkräftig behilflich sein«, meinte Bettina lächelnd. »Ich warne dich, er kann ein sehr ungeduldiger Mensch sein.«
»Das weiß ich mittlerweile schon«, erwiderte Annette.
*
Man kann wohl sagen, dass sich eine Fülle von Ereignissen überstürzt hatte.
Am Samstagmorgen holten Bettina und ihr Vater André von der Klinik ab. Die Familie Moll war ebenfalls schon erschienen, um Molly heimzuholen.
Bettina fand nur einen Augenblick Zeit, um Dr. Behnisch zuzuflüstern, dass sie schon mit Annette gesprochen hätte. Am Mittwoch würde man weitersehen.
Zu diesem Fest sollten auch Daniel und Fee geladen werden. Dafür nahm sich Bettina dann gleich am Vormittag Zeit, und sie bekam auch von ihnen eine Zusage.
»Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus«, bemerkte Daniel lächelnd. »Die Herren reiferen Alters scheinen etwas für den Namen Anne übrig zu haben.« Er spielte damit auf seinen Schwiegervater Dr. Cornelius an, der eine glückliche Zweitehe mit seiner Frau Anne führte.
»Es ist doch nicht der Name«, sagte Fee. »Es ist wunderbar, wenn reife Menschen auch noch den passenden Partner finden.«
»Besser ist es allerdings, wenn man ihn in jungen Jahren findet, dann hat man mehr davon. Ich finde, dass wir schon zu viel versäumt haben, Feelein.«
»Das sag lieber Isabel, falls sie sich zu ewigwährendem Alleingang entschlossen hat.«
»Ich werde mich heute Abend mit ihr ins stille Kämmerlein zurückziehen und ihr die Leviten lesen.«
Doch dazu kam es nicht. Mit glückstrahlender Miene kam Isabel hereinspaziert.
»Dass ihr mal Zeit habt, ist ein Wunder. Ich platze fast, um euch Neuigkeiten zu verkünden, und ausgerechnet meine besten Freunde sind dauernd beschäftigt.«
»Hoffentlich sind es wenigstens angenehme Neuigkeiten«, sagte Daniel hintergründig.«
»Warum schaust du so skeptisch drein? Sehe ich aus, als hätte ich unangenehme Neuigkeiten zu verkünden?«
Nein, das konnte man wahrhaftig nicht sagen, aber wie Daniel schon festgestellt hatte, wusste man ja bei Isabel nie so recht, woran man war.
»Ich habe gekündigt«, platzte sie heraus. »In zwei Monaten wird geheiratet. Was sagst du nun? Was sagt ihr nun?«, wiederholte sie schnell, als Fee nun auch in die Diele kam.
»Jürgen hat kein Sterbenswörtchen verlauten lassen«, erklärte Fee atemlos.
»Das wollte er mir überlassen. Ihr kennt ihn doch, er ist viel zu schüchtern. Es wird Zeit, dass er eine energische Frau bekommt.«
»Die ihm eindeutig klarmacht, dass die Insel nicht der rechte Platz für einen so befähigten Arzt ist?«, fragte Daniel.
»Aber ganz im Gegenteil. Ich werde mich dort einnisten, und wenn es euch hier mal zu viel wird, sollt ihr zuschauen, wie ihr uns von dort wegbekommt. – Spaß beiseite. Mir tut es gut, wenn ich richtigen Tapetenwechsel bekomme. Hier würde ich doch immer wieder mit Kollegen zusammentreffen, und dann …« Da läutete es, und sie unterbrach sich.
Und dann würde sie vielleicht doch wieder Sehnsucht nach ihrer Redaktion bekommen, dachte Fee, während Daniel Dr. Leitner die Tür öffnete.
»Ach, der Schorsch!«, rief Isabel aus. »Nett, dass man sich wieder mal sieht!«
Schorsch machte immer einen etwas melancholischen Eindruck. Er sagte später, dass ihm wohl einfach das Talent zum Glücklichsein fehle.
»Talent braucht man nicht dazu«, meinte Isabel. »Nur die Bereitschaft. Lass den Kopf nicht hängen, Schorsch, dem einen begegnet das Glück früher, dem anderen später. Du musst nur die Augen offenhalten.«
»Mit den Augen allein ist es nicht getan«, erwiderte er. »Ihr seid beneidenswert.«
So fühlten sie sich auch, aber es tat ihnen doch leid, dass einer unter ihnen war, an dem das Glück vorübergegangen war. Und der gute Schorsch ahnte nicht, dass jetzt schon ein paar Menschen sich Gedanken darüber machten, dem Schicksal ein bisschen nachzuhelfen.
Daniel staunte nur, als Schorsch ganz beiläufig bemerkte, dass Dieter Behnisch ihn angerufen hatte, um ihn am Mittwoch zu einer Party einzuladen.
»In die Pension Rosengarten. Ich kenne die Leute gar nicht. Aber er sagte, dass ich unbedingt kommen müsse.«
»Bettina Herzog hat mich auch eingeladen!«, rief Isabel aus. »Was ist denn dort los?«
Daniel und Fee tauschten einen langen Blick. »Das werdet ihr schon sehen«, erwiderten sie wie aus einem Munde.
*
Der Mittwochabend war herangekommen. Im internen Familienkreis wusste man schon, dass Karl Herzog inzwischen eine lange Unterredung mit Dr. Behnisch geführt hatte. Das hatte er nicht aufschieben wollen, um das kleine Fest mit mehreren Überraschungen krönen zu können. So etwas liebte er.
Er hatte während der letzten Tage eine rege, fast hektische Betriebsamkeit entwickelt, über die Bettina nur immer wieder staunen konnte.
Für Karl Herzog war die Welt wieder in Ordnung. Seine Bettina war glücklich, er war glücklich, was wollte er mehr?
Annette hatte Zeit genug, sich um die Vorbereitungen für den Mittwochabend zu kümmern, alles andere nahm ihr der Herzog Karl, wie die Kinder ihn liebevoll nannten, ab. Der Name würde ihm wohl bleiben, und er hatte nichts dagegen, wenn er ab und zu mal damit geneckt wurde, denn für Cécile, Thomas und Alexander war er eigentlich doch schon der Daddy. Nur offiziell wollten sie ihn noch nicht so rufen. Alles musste schließlich seine Ordnung haben.
Einen offiziellen Verlauf nahm der Abend dann allerdings nicht. Schon die Begrüßung war freundschaftlich, als würden sich alle lange Zeit kennen. Nur Dr. Leitner wusste noch immer nicht so recht, was er in diesem Kreise zu suchen hatte, doch auch er sollte das bald erfahren.
Für Fee und Daniel war es schon keine Ahnung mehr. Sie waren von Dr. Behnisch vorbereitet worden, wenn sie sich auch nichts anmerken ließen.
Dr. Jenny Lenz sah in einem hübschen bunten Seidenkleid sehr weiblich aus, während Dieter Behnisch sich in seinem Abendanzug nicht so wohlzufühlen schien.
Isabel betrachtete Dr. Clermont erst einmal ganz genau. Du lieber Gott, was war das anfangs für eine Aufregung gewesen, dachte sie mit ihrem restlichen Berufsrealismus, und so schnell hatte sich alles in Wohlgefallen aufgelöst – und in welches Wohlgefallen.
Annette, um Jahre verjüngt, wie auch ihr Zukünftiger, war eine charmante Gastgeberin, Cécile in einem entzückenden Kleid eine vollendete junge Dame, und selbst ihre Brüder sahen recht würdevoll aus, wenngleich sie sich nur schweren Herzens einmal von ihren Jeans getrennt hatten. Aber da Herzog Karl gesagt hatte, dass dies auch künftig ab und zu mal sein würde, hatten sie keinen Protest erhoben. Für ihn hätten sie ohne zu murren alles getan.
Und wie er dann redete! Verklärt hingen ihre Augen an ihm.
»Zuerst wollen wir einen Toast auf unser Brautpaar ausbringen. In vierzehn Tagen findet die Hochzeit statt. Für die, die es noch nicht wissen sollten, die Flitterwochen werden auf der Insel der Hoffnung verlebt. Es ist doch alles in Ordnung, Herr Dr. Norden?«
»Selbstverständlich«, erwiderte Daniel leicht verblüfft, dass auch dies erörtert wurde.
André und Bettina blickten sich tief in die Augen. Für sie war mit dieser Sekunde die Welt versunken. Sie wusste in etwa allerdings auch schon, was noch folgen würde.
»Ich erlaube mir nun, meine ebenfalls bevorstehende Vermählung mit Frau Annette von Rosen bekanntzugeben. – Ei, wer kommt denn da mit so viel Verspätung?«, unterbrach er sich, denn ganz leise kamen Poldi und Ricky hereingeschlichen.
»Verzeihung, wir hatten eine Panne, das heißt, es war ein kleiner Unfall, aber wir waren nicht schuld daran«, erklärte Poldi.
»Wo kommt ihr denn her? Ich habe euch doch gar nicht erreichen können!«, rief Bettina aus.
»Aber ich«, warf ihr Vater ein.
»Wir waren bei meinen zukünftigen Schwiegereltern«, erwiderte Poldi mit einem verzeihungsheischenden Blick zu Bettina. »Ich meinte, es sei besser, erst ihr Einverständnis einzuholen, bevor ich mich mit Ricky verlobe.«
»Allmächtiger, das Heiratsfieber scheint ausgebrochen zu sein«, raunte Daniel seiner Fee zu.
»Deswegen braucht man wenigstens nicht in die Klinik«, gab sie schelmisch zurück.
»Setzt euch«, sagte Karl Herzog. »Wo war ich stehen geblieben?«
»Wir müssen erst ein paar Toasts ausbringen, Daddy«, erinnerte Cécile ihn leise.
»Danke, mein Herzchen«, raunte er zurück. Céciles Augen strahlten ihn an. Dann klangen die Gläser hell aneinander.
»Dem Glück ist nun genug Ehre getan, kommen wir zum Geschäft«, fuhr Karl Herzog dann fort. »Ich will mich ganz kurz fassen, weil ich Geschäfte augenblicklich gar nicht so wichtig finde. Also, ich bin mit Dr. Behnisch übereingekommen, ihm die Pension Rosengarten mit Einverständnis meiner Annette zu verkaufen. Er beabsichtigt, dort ein Entbindungsheim einzurichten.«
»Vorausgesetzt, dass mein Freund und Kollege Dr. Hans-Georg Leitner damit einverstanden ist, die Leitung selbstständig zu übernehmen«, warf Dieter Behnisch ein.
Schorsch, der bei so viel glücklichen Menschen um sich herum immer mehr zusammengeschrumpft war, richtete sich jäh auf.
»Was hast du gesagt?«, fragte er wie elektrisiert.
»Ich erkläre dir alles noch mal ganz genau, Schorsch«, erwiderte Dieter Behnisch schmunzelnd. »Hast du nicht immer gesagt, dass es dein Traum wäre, auch eine Privatklinik leiten zu können?«
»Ein Traum, nur ein Traum«, murmelte Schorsch.
Aber er würde sich erfüllen, wie alles andere, was die Menschen, die hier an diesem Abend versammelt waren, tief bewegte.
»Das ist eine Story«, sagte Isabel in freudiger Erregung. »Ein Jammer, dass ich darüber nichts schreiben darf.«
»Warum nicht?«, fragte Karl Herzog großmütig. »Nur der Herzog Karl muss aus dem Spiele bleiben.«
»Gibt es nicht, dann fehlt die Hauptperson«, sagte Cécile.
»Ach, richtig, das Wichtigste hätte ich noch vergessen«, sagte er da. »Die Leitung der Herzog-Werke wird künftig mein Schwiegersohn übernehmen, damit ich mich meiner Familie widmen kann.«
»Was hast du gesagt?«, fragte André.
»Daddy will sich seiner Familie widmen, und du sollst die Leitung der Werke übernehmen«, flüsterte ihm Bettina zu, die in diesem Punkt schon genau Bescheid wusste.
»Das geht doch nicht«, sagte André.
»Warum nicht? Gönnst du mir kein Familienleben?«, fragte Karl Herzog. »Aber die ganzen internen Angelegenheiten besprechen wir noch. Jetzt wird gefeiert.«
»War das ein Abend«, sagte Daniel seufzend, als er müde ins Bett sank.
»Ein wunderschöner Abend«, sagte Fee. »Unser Schorsch kann es immer noch nicht begreifen. Er war einfach rührend anzusehen.«
»Es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte er geheult. Dieser Herzog Karl ist wirklich ein feiner Kerl. Wer spendet heute schon einen Operationssaal?«
»Ein sehr dankbarer Mensch«, sagte Fee leise. »Aber Dieter ist auch ein feiner Kerl. Du, ich glaube, er mag Jenny sehr.«
»Weiß ich schon lange.«
»Hast du mir aber noch nie gesagt.«
»Wir haben ja so selten Zeit füreinander. Immerzu passiert was anderes.«
»Schlaf jetzt. Morgen früh müssen wir wieder an die Arbeit«, sagte Fee rücksichtsvoll.
»Das könnte dir so passen«, sagte er und zog sie in die Arme. »Ein bisschen Privatleben beanspruche ich auch.«
»Es ist gleich zwei Uhr«, flüsterte Fee.
»Na, wenn schon. Es wird ja morgen nicht gleich wieder einen dramatischen Fall geben.«
»Man kann nie wissen.«
»Im Augenblick soll uns das aber nicht stören. Jetzt bin ich ein glücklicher Mann.« Als er sie küsste, gab es nichts mehr zu sagen. Sie war auch eine glückliche Frau.
- E N D E -