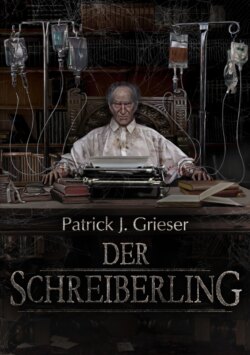Читать книгу Der Schreiberling - Patrick J. Grieser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеFast hundertfünfzig Jahre später …
In Klein-Gumpen gab es am Ortsrand, aus Richtung Laudenau, eine kleine Gaststätte, die den urigen Namen »Zur Schwarzen Erle« trug. Die Wirtschaft hatte ihren Namen von der majestätischen Erle, die sich wie ein schlafender Riese über die Wiese erhob und im Sommer den Gästen angenehmen Schatten spendete. Ein Baum, der im Volksglauben häufig mit dem Teufel und Hexerei in Verbindung gebracht wurde.
Die »Schwarze Erle« war auch außerhalb des Odenwaldes bekannt geworden durch ihr sogenanntes Vagabundenschnitzel. Ursprünglich hatte ein Zigeunerschnitzel auf der Speisekarte gestanden, doch das hatte dem ein oder anderen Gast nicht gefallen und er war auf der Reichelsheimer Gemeinde dagegen vorgegangen. Man hatte den Wirt, Herrn Hugo Dingeldein, gefragt, ob er das Schnitzel nicht einfach in ein Paprikaschnitzel umbenennen könne, um weitere juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Hugo Dingeldein war aber ein Mensch, der sich leicht in seiner Ehre gekränkt fühlte. Dazu reichte schon ein komischer Blick, den man ihm zuwarf oder wenn man vergaß, ihn auf der Straße zu grüßen. Solche Dinge machten den kleinen Mann rasend und er bekam dann regelrecht Wutausbrüche. Wenn seine Schimpftiraden verebbt waren, verschanzte er sich mit seinem Luftgewehr auf dem Balkon des Gasthauses und machte Jagd auf Vögel, die sich in der Schwarzerle eingenistet hatten (auch deswegen hatte er schon Anzeigen von besorgten Reichelsheimer Tierschützern bekommen). Ja, für einen Mann wie Hugo Dingeldein war es sehr schwer, wieder herunterzukommen. Er handelte gerne impulsiv und vor allen Dingen aggressiv. Und so war es für ihn gelinde gesagt eine absolute Unverschämtheit, dass sich ein paar Lokalpolitiker über sein Zigeunerschnitzel beschwert hatten. Die Quittung kam sofort. Seit einem halben Jahr zierte ein Zettel den Glaskasten außerhalb der Gaststätte, auf dem in roten Buchstaben geschrieben stand: »Grüne und Linke Politiker sind in diesem Gasthof unerwünscht!« Seinem Zigeunerschnitzel hatte er den unrühmlichen Namen Vagabundenschnitzel gegeben, weil er wusste, dass dies die Lokalpolitiker noch mehr auf die Palme bringen würde.
Am Stammtisch saß eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Einheimischen. Die meisten Männer hatten einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Kühles Bier und anregende Gespräche sollten den Feierabend versüßen. Der ovale Stammtisch befand sich neben der Theke in einer Nische und war mit Bierkrügen beladen. In der Mitte stand eine kleine Holztafel mit der Aufschrift: »In der Schwarzen Erle sitzen immer dieselben Kerle.« Und es waren auch immer die gleichen Leute, die sich hier trafen, um über ihre Alltagssorgen zu diskutieren und diese mit Bier wegzuspülen. Da war Bauer Fehndrich, der sich pausenlos darüber beklagte, dass die Milchpreise immer mehr in den Keller gingen, neben ihm saß Johann Schwan, ein Antiquitätenhändler, der immer wieder lamentierte, dass die Reichelsheimer einfach kein Gespür für antike Möbelstücke hätten. Oder Wilhelm Blessing, der Kioskbetreiber vom örtlichen Schwimmbad, der gerne mal einen Joint in der Umkleidekabine rauchte, weil er angeblich so starke Rückenschmerzen hatte und nichts anderes mehr half. Sie alle waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der sich zum Stammtisch der »Schwarzen Erle« zusammengefunden hatte.
Die Männer am Stammtisch waren gerade in ein Gespräch vertieft, als die Tür aufging und Don Tiki den Gastraum betrat. Einige Besucher, die auf der Durchreise waren, schauten verwundert von ihren Gläsern hoch, als sie den Mann im knallbunten Reyn-Spooner-Hawaiihemd und der riesigen Sonnenbrille sahen.
»Hubert ist da!«, meinte Wilhelm Blessing in Richtung des Neuankömmlings.
»Du meinst wohl Don Tiki!«, antwortete Bauer Fehndrich und nahm einen großen Schluck Schmucker-Bier.
»Ob er den weiten Weg von der Hutzwiese hierher gelaufen ist?«, wollte Johann Schwan wissen.
»Mit Sicherheit! Dem haben sie vor zwei Jahren den Führerschein wegen Alkohol weggenommen. Der muss zum Idiotentest.«
Don Tiki ging zum Stammtisch und blickte in die illustre Runde. »Meine Herren!«, nickte er jedem zu und ließ sich auf den einzigen noch leeren Stuhl fallen.
»Servus, Don Tiki! Schön, dass du dich mal wieder blicken lässt«, sagte Wilhelm, der Kioskbetreiber.
»Das letzte Mal haben wir dich an Ostern hier gesehen. Wir haben uns schon gefragt, ob du noch lebst.«
»Ihr wisst genauso gut wie ich, dass ich im Moment keinen Lappen habe«, entgegnete Don Tiki und gab Hugo Dingeldein ein Zeichen, dass er ein frisch gezapftes Bier wollte. »Der Weg nach Klein-Gumpen ist verdammt lang. Aber wie heißt es so schön? ›Der Kopf tut weh, die Füße stinken, wird Zeit das erste Bier zu trinken!‹«
»Genau mein Lebensmotto!«, lachte Bauer Fehndrich laut auf.
Don Tiki wandte sich an den Wirt: »He, Wirt, wo bleibt mein Bier? Sind wir hier in der Wüste?«
Das Gesicht von Hugo Dingeldein verfinsterte sich schlagartig. »Ja, sag mal, glaubst du wirklich, du Depp, wenn du ›Spring!‹ sagst, dass ich dann frag ›Wie hoch?«‹
»Treib ihn besser nicht auf die Palme! Er gibt uns sonst kein Bier mehr, wenn du ihn reizt.«
»Das war ein Witz!«, rechtfertigte sich Don Tiki und hob unschuldig die Hände.
»Der versteht aber deine Art von Humor nicht.«
»Das ist ja eine Unverschämtheit! Meinst du, ich bin dein Sklave! Also so was habe ich auch noch nicht erlebt in meinem Lokal. IN MEINEM LOKAL!«, sagte der Wirt und seine Stimme wurde dabei immer lauter. Hugo Dingeldein war dabei, sich in die Sache hineinzusteigern.
»Das war ein Witz! EIN WITZ!«, rief ihm Don Tiki zu.
»Ihr meint auch alle nur, ihr seid was Besseres als …« Der Rest von Dingeldeins Schimpftirade ging im allgemeinen Lärm der Gaststätte unter.
»Was verschafft uns denn die Ehre, dass der große Don Tiki uns hier in Gumpen besucht?«
»Das Bier und die Geselligkeit!«, meinte Don Tiki.
Hugo Dingeldein trat an den Tisch und knallte ihm wortlos das frisch gezapfte Bier vor die Nase. Er faselte etwas Unverständliches in seinen Bart und verschwand in einer angrenzenden Tür, die in die darüber liegende Wohnung führte.
»Wahrscheinlich holt er jetzt sein Luftgewehr und fängt an, auf Vögel zu schießen!«, lachte Bauer Fehndrich laut auf und rieb sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Der Typ ist doch geisteskrank«, sagte Don Tiki.
»Sag das bloß nicht zu laut. Der jagt dir eine Ladung Schrot in den Hintern, wenn er das hört.«
Don Tiki hob sein Glas und prostete seinen Freunden zu. Nachdem er einen ordentlichen Schluck genommen hatte, wischte er sich genüsslich den Schaum von den Lippen. Der erste Durst war gestillt.
»Was gibt es Neues bei euch in der Hutzwiese? Lebt ihr alle noch? Der Krieg ist schon seit sechzig Jahren vorbei!«
»O ja, es gibt etwas Neues«, sagte Don Tiki geheimnisvoll und sein Blick tastete über die anwesenden Gesichter. »Ich habe gestern etwas wirklich Krankes erlebt.«
»Etwas Krankes?«, wollte Bauer Fehndrich wissen.
»Hast du gehascht?«, fragte Wilhelm Blessing neugierig und spitzte die Ohren.
»Nein, nein, ich bin kein verdammter Junkie!«, wiegelte Don Tiki hab. »Ich weiß, ihr werdet mir nicht glauben, aber ich habe gestern etwas in den Wäldern gesehen … Junge, Junge.« Er zeigte den anwesenden Freunden seinen Arm. »Schaut mal, ich bekomme jetzt noch eine richtige Gänsehaut, nur wenn ich daran denke!«
»Wahrscheinlich bekommst du auch einen Harten von deinen Gedanken!« Johann Schwan lachte laut auf. »Höhöhö!«
»Nein, kein Scheiß, mir geht es echt nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich die heutige Nacht in meinem Haus verbringen kann.«
Und so begann Don Tiki zu erzählen: Wie er mit seinem Freund Mike gezecht habe und dann auf der Veranda eingeschlafen sei. Wie er durch einen lauten Knall wieder aufgewacht und das seltsame Leuchten gesehen habe. Wie er durch den Wald geirrt sei und das bizarre Wesen mit den großen Flügeln gesehen und die Roboterstimme in seinem Kopf gehört habe. Verschwinde von hier! Verschwinde von hier! Verschwinde von hier …
Die Männer starrten ihn zunächst amüsiert an, doch dann bemerkten sie, dass es dem Mann im Hawaiihemd ernst war. Während des Gesprächs nahm er sogar seine Sonnenbrille ab, was er normalerweise nie tat. Seine Augen waren stark gerötet und zeugten von zu wenig Schlaf. Als er von dem Wesen sprach, verkrampften sich seine Hände auf der Tischplatte. Don Tiki sprach wie im Traum, die Stimme ohne Schwingung oder Modulation. Er wirkte geistesabwesend, als würde er die gestrigen Ereignisse noch einmal erleben und wie ein Nachrichtensprecher erzählen.
Als er fertig war, herrschte am Stammtisch eine bedrückte Stimmung.
»Du hast das falsche Zeug geraucht«, sagte Wilhelm Blessing als Erster.
»Nein, eher zu viel gesoffen!«, meinte Bauer Fehndrich.
»Es ist die Wahrheit! Ich schwöre es!« Langsam setzte Don Tiki wieder seine Sonnenbrille auf.
»Was sagt denn dein Freund Mike dazu?«, wollte Johann Schwan wissen.
»Ich habe ihn noch nicht erreicht. Sein Handy ist ausgeschaltet und er geht nicht an die Tür.«
»Vielleicht ein paar Jugendliche aus dem örtlichen Fastnachtsverein!«
»Ich habe dir schon immer gesagt, sauf nicht zu viel!«, mahnte Bauer Fehndrich mit erhobenem Finger.
»Das hat mit dem Alkohol nichts zu tun. Ich weiß, was ich gesehen habe!«, antwortete Don Tiki stur und verschränkte zur Bekräftigung die Arme vor der Brust.
»Und was willst du jetzt machen?«
»Am liebsten heute Nacht woanders schlafen. Mich bekommen keine zehn Pferde in mein Haus!«
»Wenn du willst, kannst du bei mir pennen. Meine Frau soll dir das Gästebett beziehen!«, bot Bauer Fehndrich an.
»Da wäre ich dir sehr dankbar!«
»Aber nur für heute Nacht. Wir sind keine Pension! Die Milchpreise sind eh im Keller. Gott alleine weiß, wie lange wir noch ein Dach über dem Kopf haben.«
»Ich weiß das sehr zu schätzen«, sagte Don Tiki und küsste seinen Siegelring, auf dem das lachende Gesicht von Lana, der Göttin der Musik und Hulatänzer, eingraviert war.
Don Tiki fühlte sich erleichtert. Er musste die Nacht nicht in der Hutzwiese verbringen. Er blickte auf sein Handy. Mike hatte nicht auf seine SMS geantwortet. Er überlegte, ob er ihn noch einmal anrufen solle, aber insgeheim wusste er, dass sein Freund nicht ans Telefon gehen würde. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn und breitete sich wie die Nachwehen einer verdorbenen Mahlzeit in seiner Magengegend aus. Er hoffte inständig, dass es Mike gut ging. Hoffentlich hast du nicht das Leuchten gesehen und bist diesem gefolgt, mein Freund!, dachte er verzweifelt.
Sie hatten sich auf den Weg Richtung Prärie gemacht. Es waren insgesamt fünf Mann, darunter Jeremy Slater und der Pawnee Morgan Elroy. Auf der Blue-Lodge-Ranch hatte der Cowboy seinen Gaul gegen einen flinken Pinto getauscht, der ein feuriges Gemüt hatte und wie der Blitz über das Grasland fegte. Der Cowboy fühlte sich an diesem Morgen zum ersten Mal wieder richtig in seinem Element. Laut jaulte er auf, als der Pinto losgaloppierte. Heute würden sie Mavericks einfangen und zurück zur Blue-Lodge-Ranch bringen, wo ein wortkarger und äußerst mürrischer Kerl namens Wayne Gunter mit dem Brandzeichen auf sie wartete.
Das ist die Freiheit, von der ich immer geträumt habe!, dachte der Cowboy und musste ein Grinsen unterdrücken. Hier draußen in der endlosen Prärie unterwegs mit Männern, die irgendwann einmal vielleicht seine Freunde werden könnten. Freunde! In seinem früheren Leben war Rainer Mehnert ein Einzelgänger gewesen. Ein Freak, der von den Leuten gemieden wurde. Doch dann waren die tollwütigen Seemänner gekommen und hatten die Erde, wie er sie kannte, in Flammen gelegt. Er hatte Bekanntschaft mit einer Gruppe von Jungen gemacht: Jakob, Schnute, Mehlsack, Roland und Peter … nicht zu vergessen Simon Hauser und Pfarrer Wetzel. Der Weltuntergang hatte sie fest zusammengeschweißt. Sie waren Weggefährten und Freunde gewesen. Sie waren alle tot. Wobei er nicht wusste, was mit Jakob geschehen war und ob dieser die Schrecken der Stadt der Nacht überlebt hatte? Ihr gemeinsames Abenteuer hatte einen hohen Blutzoll gefordert. Doch der Cowboy war kein Mensch, der lange wehmütig zurückblickte. Das war früher einmal gewesen, als er gefangen war in einem Spinnennetz aus Schuldgefühlen. Hier im Wilden Westen war sein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. In diesem Land konnte er das sein, was er schon immer sein wollte: ein Westmann.
Was wohl aus Hekate geworden ist?, dachte er und vergaß für einen kurzen Augenblick die endlosen Weiten um sich herum. Er war mit der weißen Wolfsbestie, in die sich Hekate verwandelt hatte, durch das Energiefeld gestürzt und auf dieser Welt aufgewacht. Von Hekate fehlte jede Spur. In der Stadt der Nacht hatte er sie schwer verletzt. Sie brannte in ihrer Wolfsgestalt lichterloh, als sie sich auf ihn stürzte.
Hoffentlich schmorst du in der Hölle, du blöde Fotze!, dachte der Cowboy grimmig und spie auf den Boden. Dann schüttelte er die alten Erinnerungen ab. Es machte keinen Sinn, sich an diesem herrlichen Tag die Laune verderben zu lassen.
Nach etwa drei Stunden (es musste schon Nachmittag sein) zogen die ersten Regenwolken auf und verdichteten sich zu einem großen schmutzigen Knäuel am Himmel. Bald war der ganze Himmel grau gefärbt; die Sonne versteckte sich hinter den Wolken. Eine Stunde später brach das Unwetter auf die Prärie nieder. Der Himmel öffnete seine Schleusen. Binnen Minuten waren die Männer bis auf die Knochen durchnässt.
»Männer, hier entlang!« Morgan Elroy gab ein Zeichen, dass sie ihm folgen sollten. Etwa zwei Meilen entfernt befand sich eine Ansammlung mehrerer Hügel mit kleinen Wäldern, die wie Inseln aus dem Präriegras ragten. Zuerst dachte der Cowboy, dass der Pawnee sie in den Schutz der Bäume führen wollte. Doch er wurde eines Besseren belehrt. An einen der Hügel schmiegte sich eine verfallene Winterhütte. Hastig stiegen sie von ihren Pferden, banden sie in der angrenzenden Koppel an und betraten das kleine Gebäude.
Der Cowboy war klatschnass, Wasser rieselte von der Krempe seines Hutes. »Was ist das hier?«, erkundigte er sich und schleuderte seine Stiefel von sich.
»Eine Winterhütte«, antwortete Morgan Elroy. »Wir haben hier sehr heftige Schneestürme, und die Hütten dienen den Reisenden als Unterschlupf, sodass sie keine Angst haben müssen zu erfrieren!«
»Sweet home!«, murmelte der Cowboy und blickte sich um. Die Hütte bestand aus einem großen Raum mit einer kleinen offenen Feuerstelle. Alles war äußerst zweckmäßig erbaut worden. Es gab lediglich ein Fenster, gegen das der Regen in einem unbarmherzigen Stakkato prasselte. Vor dem Cowboy stand ein schmutziger Tisch mit ein paar schlecht gefertigten Stühlen. Mehrere leere Konservenbüchsen zeugten davon, dass sie nicht die einzigen Besucher waren, die diese Hütte benutzten. In der Ecke gegenüber der Feuerstelle gab es primitive Hochbetten, die wahrscheinlich ein Paradies für Läuse und Flöhe waren. Die Tür aus massivem Holz machte allerdings einen sehr stabilen Eindruck. An ihrer Front konnten sich die Gezeiten austoben.
»Sieht nicht gut aus«, meinte Jeremy Slater mit Blick aus dem Fenster. »Ich denke, wir werden die Nacht wohl oder übel hier verbringen müssen!«
»Für die Natur ist es ein Segen!«, sagte der Pawnee, während er ein Feuer zu entfachen begann, denn es war durch das Unwetter merklich kühl geworden. Die nassen Klamotten hingen wie Blei an den Männern. Der Cowboy fror bis ins Mark. Hastig entledigte er sich seiner Kleidung. Dann trat er in Unterwäsche vor die Feuerstelle und hielt die Hände vor die Flammen.
Jeremy Slater öffnete seinen schweren Lederrucksack und holte einige Vorräte heraus. Dann begann er Biskuits in einer Pfanne zu rösten. Erst jetzt wurde der Cowboy sich bewusst, wie hungrig er doch war. Seit dem Frühstück hatte er nichts mehr gegessen. Nachdem Slater die Biskuits in der Pfanne geröstet hatte, nahmen sie an dem länglichen Tisch Platz, schoben die Konservendosen zur Seite und begannen zu essen. Dazu aßen sie Dörrfleisch, das dem Cowboy leider überhaupt nicht mundete. Das Zeug war so zäh wie Sattelleder. Schon nach wenigen Bissen verfingen sich nervige Fleischreste in seinen Zahnlücken. Nichtsdestotrotz aßen die Männer mit gutem Appetit. Der Kaffee, den Slater im Anschluss kochte, war herrlich stark und mit einem Schuss Bourbon verfeinert, sodass die müden Glieder aufgewärmt wurden.
Nach dem Essen schaute der Pawnee nach den Pferden. Währenddessen machten es sich Jeremy Slater und seine Männer vor dem Feuer gemütlich.
»Stört es euch, wenn ich einen fahren lasse?«, fragte der Cowboy und streckte seine nackten Füße in Richtung Feuerstelle aus.
»Nicht in dieser Hütte!«, warnte ihn Jeremy und warf ihm einen Blick zu, dass er sich auf dünnes Eis begebe. Sehr dünnes Eis …
Der Boss der Blue-Lodge-Ranch nahm einen Riegel Kautabak aus der Hemdtasche, steckte sich diesen in den Mund und begann zu kauen. Zufrieden nahm er eine der leeren Konservendosen und spuckte eine bräunliche Brühe hinein.
»Well, ich hätte nie gedacht, dass Rinder so kostbar sind«, sagte der Cowboy – überflüssige Worte, die einzig dem Zweck dienten, das Thema zu wechseln.
»Na, was glaubst du, wovon sich all die Abenteurer, Minenarbeiter, Geschäftemacher und Prospektoren ernähren? Die lechzen allesamt nach unserem Fleisch«, antwortete Jeremy Slater.
»Werden Sie Ihre gesamte Herde verkaufen?«, wollte der Cowboy neugierig wissen.
Jeremy Slater schüttelte den Kopf. »Nein, aber den Großteil. Ich behalte nur einen kleinen Teil als Zuchttiere. Wenn wir die Herde nach Kansas gebracht haben, dann bin ich so reich, dass ich mir über das Morgen keine Sorgen mehr machen brauche.«
»Haben Sie Pläne für danach?«
Jeremy Slater hielt einen Moment inne. Die stahlgrauen Augen glichen dem Schmelzwasser eines Gebirgsflusses. »Wir wollen die Blue-Lodge-Ranch weiter ausbauen und außerdem in der Stadt ein Hotel eröffnen. Mit dem Verkauf der Rinder haben wir das notwendige Kapital.«
»Hört sich gut an!«, sagte der Cowboy und nippte an seinem Kaffee.
»Morgen wollen wir ein paar Mavericks einfangen. Aber es wird kein Kinderspiel. Durch den Regen wird der Boden recht schlammig sein, und die Pferde werden Mühe haben, die Rinder einzutreiben.«
In diesem Moment wurde die schwere Tür aufgestoßen. Die Gestalt von Morgan Elroy wurde von einem niederfahrenden Blitz scharf umrissen. Sein nackter Oberkörper glänzte feucht vom vielen Regen. Der einsetzende Donner war so laut, dass der Cowboy das Gefühl hatte, eine Bombe sei in unmittelbarer Nähe eingeschlagen.
Dankbar griff Morgan Elroy nach einer Decke, die ihm einer der Männer reichte.
»Was meinst du, Morgan? Sollen wir Wachen aufstellen?«, wollte Slater wissen, während er mit seiner Fingernagelspitze nach einem Stück Fleisch pickte, das sich zwischen seinen Zähnen verfangen hatte.
Der Pawnee nickte eifrig, während er sich den Oberkörper mit der Decke abwischte. »Ich würde kein Risiko eingehen. Ich möchte auf gar keinen Fall mitten in der Nacht von einem von Picketts Männern überrascht werden.«
»Dann soll jeder von uns eine Schicht übernehmen. Wir sind genügend Männer! Wer von euch will anfangen?«, fragte Jeremy Slater in die Runde.
Der Cowboy bekam die letzte Schicht im Morgengrauen zugeteilt. Dafür war er ausgesprochen dankbar. Noch immer fühlte er sich müde und ausgelaugt. Die letzten Tage hatten ihn viel Kraft und Energie gekostet. Die Männer redeten noch ein wenig vor dem Feuer, doch schon bald zogen sie sich in die übereinanderliegenden Schlafkojen der Hütte zurück.
Jeremy Slater saß mit seiner Winchester draußen vor der Tür und lauschte dem Toben des Sturms. Er hatte die erste Schicht übernommen.
Das Bett des Cowboys war äußerst unbequem. Es war viel zu klein und wenn er sich auf der Matratze bewegte, strömte ihm ein unangenehmer Geruch von dem Stroh entgegen. Doch das störte ihn nicht wirklich. In seinem früheren Leben hatte er in weitaus schlimmeren Lokalitäten übernachtet. Im Gegensatz dazu war diese muffige Matratze ein 5-Sterne-Luxus-Bett. Der Cowboy schloss die Augen und spürte, wie seine Glieder schwerer wurden. Eine angenehme Wärme breitete sich in seinem Körper aus. Wenige Sekunden später war er tief und fest eingeschlafen.
Das Unwetter fegte mit gnadenloser Härte über die Three-Pearls-Ranch hinweg. Es blitzte und donnerte in einem fort. Der Hof hatte sich in einen schlammigen Pfuhl verwandelt. Doch von alledem bekam Desmond Picketts nichts mit, denn er schlief tief und fest in seinen zerwühlten Bettlaken. Aus einer Laune heraus hatte er sich mittags zwei Flaschen Wein aus dem Keller geholt und diese binnen weniger Stunden ausgetrunken. Er hatte mit Willard auf der überdachten Veranda gesessen (wobei sein bester Mann nur dem Whiskey zugesprochen hatte – der Kerl hatte einfach keinen Geschmack für Wein), ehe sie von dem Sturm überrascht wurden. Der viele Wein hatte ihm die Sinne benebelt und er war früh schlafen gegangen. Der Alkoholrausch ließ ihn schnell einschlafen. Und mit dem Schlaf kam der Traum wieder. Es war einer jener Träume, die so klar und deutlich waren, dass sie fast real schienen. Viele Träume waren nur verschwommen, ihnen fehlte ein gewisses Maß an Detailgenauigkeit und Lebhaftigkeit. Doch dieser Traum war anders. Er fühlte sich immer so erschreckend real an. Benommen wachte Desmond auf und brauchte einige Augenblicke, um ins Hier und Jetzt, die Gegenwart, zurückzufinden. In letzter Zeit wurde er öfter von diesem Traum heimgesucht. Zunächst hatte er geglaubt, dass es mit seinem Alkoholkonsum zusammenhängen würde, doch der Traum war auch da, wenn er keinen Tropfen anrührte.
In der Traumwelt war Desmond wieder ein dreizehnjähriger Junge, der die Schule in Cheops besuchte. Nur am Wochenende durfte er zurück auf die Ranch seiner Eltern. Und da war dieses Mädchen: Anne Coleman. Er hatte sich in dieses zierliche Wesen verliebt. Doch damals wusste er noch nicht, dass es Liebe war, denn so etwas wie Liebe war eine komplett neue Erfahrung für ihn. Desmond fühlte sich zu ihr hingezogen. Sie war fast sechzehn Jahre alt; unter ihrer Bluse zeichneten sich die Brüste einer werdenden Frau ab. Und obwohl er jünger und viel unerfahrener als dieses Mädchen war, schien sich Anne für ihn zu interessieren. Zusammen liefen sie die Flaniermeile von Cheops ab. Er spürte, wie das Mädchen seine Nähe suchte und sein Herz begann, Luftsprünge zu machen. Immer wieder schien sie wie zufällig seine Hand zu berühren.
»… und du musst mich auf jeden Fall einmal auf unserer Ranch besuchen!«, erzählte Desmond, während sie bei dem örtlichen Barbier vorbeiliefen.
»Habt ihr eine große Ranch?«, erkundigte sich das Mädchen und schaute ihn aus ihren grünen Augen an.
»Ja, wir haben drei Häuser gebaut! Drei! Mein Vater sagt, dass wir die größte Ranch im ganzen County haben!«, bemerkte Desmond stolz.
»Ist das wirklich so?«, erklang es plötzlich hinter den beiden.
Als Desmond die Stimme hörte, rutschte sein Herz in die Hose. Ganz langsam drehte er sich um … und blickte in die grinsenden Visagen der Jungen. Es waren Ron Jenkins und seine Bande. Sie waren allesamt schon sechzehn und Desmond Pickett körperlich überlegen. Diese verfluchte Bande! Jenkins war mit den Siedlern aus Wake County gekommen. Sein Vater wollte hier in der Stadt ein neues Leben aufbauen. Verfluchte Siedler!
Jenkins machte einen Schritt auf Anne und Desmond zu. »Was willst du mit so einem Hosenscheißer?«, wollte er von Anne wissen. Noch bevor ihm Anne antworten konnte, trat der Siedlerjunge vor Desmond und begann, ihn unsanft zu stoßen. Beim ersten Mal stolperte Desmond nur. Beim zweiten Mal landete er im Staub.
»Lass ihn bitte in Ruhe!«, sagte Anne, doch Jenkins ignorierte sie.
»Was hast du hier überhaupt zu suchen, du Ratte?«, wollte er von Pickett wissen. »Ihr Scheißbullenficker habt in der Stadt nichts verloren!«
Desmond stieg die Schamesröte ins Gesicht. Dass er vor Anne so blamiert wurde, war das Schlimmste, was ihm je passiert war. Er versuchte etwas zu stammeln, doch Jenkins trat ihm hart mit dem Stiefel in die Seite, sodass Desmond keine Luft mehr bekam. Die ganze Welt drehte sich plötzlich um ihn herum.
»Hört auf!«, flehte Anne irgendwo hinter ihm.
»Du magst ihn?«, wandte Ron Jenkins das Wort an Anne. »Ist das dein Ernst? Skull-Boy?«
»Er ist okay. Und so etwas hat er nicht verdient!«
»Mmh, wir beide könnten doch einmal miteinander ausreiten? Mmh?«, fragte Jenkins.
»Ich mag keine Schläger!«, lehnte Anne das Angebot ab.
»Oh, eine Frau, die sich nicht so leicht erobern lässt! Das gefällt mir!«, lachte Jenkins laut auf.
Mühsam erhob sich Desmond vom Boden. Hemd und Hose waren durch den Staub vollkommen verdreckt. Er gab ein ziemlich armseliges Bild ab.
»Wenn ich dir zeige, dass ich ein echter Gentleman bin und ein Herz in meiner Brust schlägt, würdest du dann mit mir ausgehen?«, bohrte Jenkins nach und nahm seinen Hut ab. Er machte eine theatralische Verbeugung vor Anne. Voller Zorn sah Desmond, dass Anne für einen kurzen Augenblick lächelte. Ja, dieser Jenkins schien ihr zu gefallen. Er war muskulös und sportlich, hatte kräftiges rötliches Haar und scharfkantige Gesichtszüge. Im Gegensatz dazu war Desmond nur eine ausgemergelte, schlaksige Gestalt, die noch nicht einmal die Schwelle zum Mannsein überschritten hatte. Und er beneidete Ron Jenkins um dessen Haarpracht.
Als er zu Anne gehen wollte, stellten sich die anderen Siedlerjungen aus Wake County vor ihn. Ich hasse diese verdammten Bastarde!, dachte er voller Wut. Er hatte einen solchen Hass in sich, dass er mit den Zähnen knirschte. Währenddessen verwickelte Ron Jenkins das Mädchen geschickt in ein Gespräch und entfernte sich langsam mit ihr.
»Du rührst dich kein Inch, verstanden? Sonst spalten wir deinen hässlichen Schädel mit einem Beil«, drohte einer der Jungen aus Wake County mit erhobener Faust. Desmond Pickett blieb nichts anderes übrig als zu nicken, da er den Jungen körperlich unterlegen war.
Die Gruppe entfernte sich und ließ Desmond Pickett vor dem Laden des Barbiers allein zurück. Tief in ihm wüteten zwei so starke Gefühlswelten, dass er glaubte, sie würden ihm den Verstand rauben. Auf der einen Seite war da ein überwältigendes Schamgefühl. Er schämte sich, dass er den Siedlerjungen nicht die Stirn geboten hatte und dass er so schwächlich war. Diese Scham! Sie hatten ihn vor den Augen von Anne erniedrigt. Das war so peinlich gewesen. Er war kein richtiger Mann! Und jetzt folgte diese blöde Kuh Ron Jenkins wie eine läufige Katze! Und damit explodierte die zweite Emotion in seinem Inneren: blanker Hass und ohnmächtige Wut. Diese Wut ließ ihn die Zähne fest zusammenbeißen. Er ballte seine Hände zu Fäusten und schwor Rache. Er verharrte so lange in dieser Haltung, bis die Siedlerjungen mit Anne nur noch ein grauer Schemen am Ende der Straße waren.
Wütend und enttäuscht blickte er sich um, weil er Angst hatte, dass jemand gesehen haben könnte, wie er von den Jungen bedroht wurde. Als er den Mann auf der Bank erblickte, erschrak er zutiefst. Der Mann trug einen schwarzen Anzug, hatte lässig die Beine übereinandergeschlagen, sodass man seinen fein glänzenden Schnürschuh (auf dem sich merkwürdigerweise kein Straßenstaub befand) mit dem Budapestermuster sehen konnte. Was Desmond aber so beunruhigte, war die Gesichtsfarbe des Mannes, die feuerrot war. Nicht einmal die Rothäute hatten einen solchen intensiven Farbton wie dieser Fremde. Das blauschwarze Haar war mit zu viel Pomade bearbeitet worden. Der Mann grinste Desmond an und offenbarte dabei eine Reihe makellos weißer Zähne. Er zwinkerte ihm verschworen zu mit einem Gesichtsausdruck, der sagte: Junge, ich habe alles beobachten können von meiner Bank aus!
Irritiert wandte sich Desmond von dem Fremden ab und ging unsicheren Schrittes weiter. Schließlich wagte er noch einmal einen flüchtigen Blick über die Schulter zu werfen, denn dieser Mann war so unglaublich sonderbar und bizarr. So eine Gestalt hatte er noch nie zuvor in seinem Leben gesehen. Doch die Parkbank war leer. Verwundert drehte er sich um. Von dem rothäutigen Fremden fehlte jede Spur. Sein Blick glitt über die Arkaden und Geschäfte, doch nirgendwo war der Mann zu sehen. Desmond lief in Richtung Bank, doch auch da war niemand.
Er schüttelte den Kopf. Für einen Moment war seine Wut vergessen. Er fragte sich, ob er vielleicht auf ein Trugbild hereingefallen war. Eine Fata Morgana, über die Reisende oftmals berichten, die die Wüste und das Ödland durchqueren.
Sehr seltsam!, dachte Desmond und lief zurück zum Schulheim, in dem er mit den anderen Kindern untergebracht war. Plötzlich wurde die Szene undeutlich, löste sich vor seinen Augen auf. Auf einmal fühlte er sich federleicht. Eine unbekannte Kraft schien seinen Geist ähnlich einem starken Magnetfeld nach oben zu ziehen. Und dann erwachte Desmond Pickett. Es dauerte fast eine ganze Minute, bis er realisierte, dass es nur ein Traum gewesen war. Eine Szene aus seiner traurigen und beschämenden Kindheit. Der Schleier lüftete sich und das alte Ich von Desmond Pickett übernahm die Kontrolle. Jetzt war er wieder der gnadenlose Boss und Tyrann der Three-Pearls-Ranch. Er schüttelte sich, als wollte er die letzten Fetzen des Traums loswerden, und erhob sich von seinem Bett.
Rainer Mehnert, der Cowboy, schlug die Augen auf. Instinktiv wusste er, dass etwas nicht stimmte. Es war mehr als nur eine Ahnung. Da war wieder dieses vertraute Gefühl, das er aus der Stadt der Nacht kannte. Sein Überlebenssinn, geschärft durch die schrecklichen Erlebnisse aus der Vergangenheit, hatte ihn aus dem Schlaf geholt. Etwas stimmte nicht! Sie waren in Gefahr!
Ganz langsam drehte er sich auf die Seite. Das Feuer war zu einer schwachen Glut heruntergebrannt. Die Männer lagen in ihren Betten und schliefen. Es hatte aufgehört zu regnen. Selbst das Brüllen des Windes war vollends verstummt. Ein Blick zum Fenster zeigte ihm, dass es draußen noch dunkel war. Neben der Tür saß einer von Jeremy Slaters Männern, dessen Namen er vergessen hatte. Dessen Kopf ruhte auf der Brust, die sich gleichmäßig hob und wieder senkte. Der verfluchte Kerl war eingeschlafen! Nur mühsam unterdrückte der Cowboy einen Fluch. Ganz langsam und vorsichtig erhob er sich von seiner oberen Schlafstätte. Trotzdem knarrte das Bett bei der Bewegung.
Jetzt sah er, dass Morgan Elroy ebenfalls wach war. Der Indianer saß aufrecht auf seinem Bett. Als er den Cowboy sah, hob er langsam die Hand und hielt den Zeigefinger vor die Lippen. Sssshhhh! Kein Wort! Der Pawnee hatte es auch gespürt. Sie verharrten in ihren Betten und lauschten in die Stille. Und dann hörten sie es. Etwas war da draußen und bewegte sich langsam um die Hütte. Was auch immer es war, es versuchte, sich leise fortzubewegen, doch die nasse Erde ließ jeden Schritt zu einem gedämpften Schmatzen werden. Mit seinem Körper schabte es immer wieder gegen die Holzwände.
Vorsichtig verließ der Pawnee sein Bett und schlich zum Fenster. Seine Füße glitten lautlos über den Boden. Die anderen Männer schliefen immer noch. Auch der Cowboy verließ sein Bett und kletterte die Holzleiter des Etagenbettes hinunter. Schritt für Schritt, damit er kein verräterisches Geräusch erzeugte. Die beiden Männer positionierten sich links und rechts von dem Fenster.
»Vielleicht ein Bär?«, wisperte der Cowboy so leise, dass er glaubte, Morgan würde ihn nicht verstehen. Doch der Indianer schüttelte den Kopf.
»Zu groß!«, hauchte er.
Die Augen des Cowboys weiteten sich. Zu groß? Zu groß für einen Bär? Und plötzlich beschlich ihn eine ungute Vorahnung. Sein Mund wurde trocken.
Der Pawnee blickte kurz aus dem Fenster und wich dann blitzschnell wieder zurück. Sein Gesicht war blass geworden. Was auch immer Morgan Elroy gesehen hatte, es hatte ihn aus der Fassung gebracht. Und dann stand die Kreatur direkt vor dem Fenster. Der Cowboy spürte, wie sie durch das schmutzige Glas in die Hütte starrte. Er wagte es nicht sich zu rühren. Ein unheimliches Grollen drang von der anderen Seite des Fensters an sein Ohr, das sich wie das Vibrieren eines Erdbebens anfühlte, bevor der Schall das Gehör erreicht. Diesem Knurren wohnte eine so bösartige Intensität inne, dass der Rahmen der Fensterscheibe anfing zu zittern. Obwohl das Geräusch laut war, nahm der Cowboy es mehr mit dem Körper wahr als mit seinen anderen Sinnesorganen. Und plötzlich wusste er, was für eine Kreatur da draußen stand. Dieses Knurren hatte er schon einmal gehört. In der Stadt der Nacht, Dionaea muscipula! Offenbar war Hekate noch am Leben und hatte schlechte Laune …