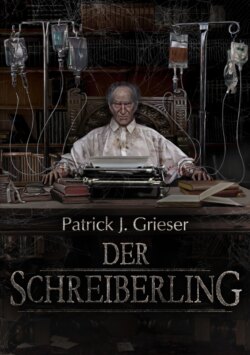Читать книгу Der Schreiberling - Patrick J. Grieser - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеIn einer fernen Parallelwelt …
»Fuck!«, war das erste Wort, das über Jakob Großmüllers Lippen kam. Er schloss die Augen, weil er dachte, dass er träumte. Doch als er sie wieder öffnete, waren die Nacktschnecken immer noch da. Sie waren verendet, hatten eine schwärzliche Farbe angenommen und lagen in einem weiten Kreis um ihn herum. Er spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte. Vorsichtig hob er den Fuß und versuchte, über die Schnecken hinwegzutreten. Sie lagen überall verstreut – es waren bestimmt Hunderte. Nur nicht auf eine drauftreten!, dachte er verzweifelt, während er sich einen Weg durch die Wiese bahnte. Er fühlte sich in diesem Moment in einer Endlosschleife gefangen, in einem schrecklichen Déjà-vu-Erlebnis, das ihn so lange heimsuchen würde, bis er ein gebrochener Mann sein und aufgeben würde.
Wenn die Schnecken anfangen zu sterben, dann ist es soweit. Die Welt wird aufhören zu existieren. Sie wird in Flammen untergehen! So ähnlich waren die Worte von Leonhard Hoyer, dem Primus, gewesen. Hinter dem Primus versteckte sich ein legendenumrankter Mann namens Epimetheus, der ein Nachkomme der Gaia und des Uranos war. Er hatte Jakob auf diese Welt gebracht und ihm versprochen, dass er hier ein ganz normales Leben würde führen können. Irgendetwas war falsch gelaufen. Oder der Primus hatte ihn schlichtweg verarscht. Diese Welt war instabil geworden – vermutlich ausgelöst durch seine bloße Existenz.
»Verlier jetzt nur nicht den Verstand!«, versuchte er sich selbst zu beruhigen, was ihm aber nicht gelang, denn seine Stimme hörte sich schrecklich an. In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Der Cowboy und er hatten Hekate ausgeschaltet (jedenfalls glaubte er das, denn er hatte sie in ihrer Wolfsgestalt lichterloh brennend in das Energiefeld stürzen sehen). Hekate. Die Göttin der Wegkreuzungen. Magna Mater, die Große Mutter. Sie hatte die Seelensprinter kontrolliert und sich der tollwütigen Seemänner bedient. Wenn sie nicht mehr existierte, dann konnte auch keine ihrer Kreaturen auf diese Welt kommen und sie vernichten. Dieser Gedankengang erschien Jakob ausgesprochen logisch. Leonhard war im Besitz der Steuerkarte. Er würde niemals Seelensprinter in diese Welt schicken. Schließlich war es der Primus selbst gewesen, der ihn hierher gebracht hatte. Doch Jakob war ein junger Mann mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis. Er musste im Wald nachschauen. Erst dann würde er sich in Sicherheit wiegen.
Hastig lief Jakob zwischen den toten Nacktschnecken vorbei in Richtung Stockwiese. Diese waren ein kleines Naturschutzgebiet, unweit von Klein-Gumpen, mit einer überschaubaren Anzahl von Wanderwegen, die ins Zentrum und in benachbarte Orte führten. Die Reichelsheimer nutzten die Stockwiese für ausgiebige Nachmittags- oder Sonntagsspaziergänge. Eine unberührte Landschaft, die die Last des Alltags für ein paar Stunden vergessen ließ. Ein kleiner Weg unscheinbar von dichten Büschen umgeben, zweigte von der Waldstraße ab und führte direkt ins Herz des Naturschutzgebietes.
Jakob sprintete den geteerten Weg entlang. Hätte ich doch nur mein altes Fahrrad, meinen grünen Felt-Cruiser!, dachte er sehnsuchtsvoll. Früher war er immer mit dem Fahrrad durch die Stockwiese gefahren. Es tat weh, an seine alte Clique zu denken: Schnute, Mehlsack, Roland und Peter. Sie waren alle tot, hatten ihr Leben auf der Flucht vor den tollwütigen Seemännern gelassen. Der Weg führte an Wiesen, Pferdekoppeln und Bachläufen vorbei. Obwohl es sich anfühlte, als wäre er eine halbe Ewigkeit nicht mehr in der Stockwiese gewesen, achtete er trotzdem nicht auf die nähere Umgebung. Die alte Kurklinik Göttmann ragte in der Ferne wie ein schlafender Riese über die Hecken und Bäume hinweg.
Der Weg gabelte sich nun wenige Hundert Meter vor der Kurklinik. Jakob nahm die linke Abzweigung, denn dieser Pfad führte in die Wälder. Er erinnerte sich daran, dass Dirk Wolpers – ein Schläger der Albert-Einstein-Schule – von seltsamen Schienen erzählt hatte. Wolpers, der immer zu den Fischteichen im Wald gegangen war, um dort zu kiffen, stieß damals auf diese seltsamen Bahnschienen. Sie waren auf einmal da gewesen. Was einige zunächst für einen bösen Streich hielten, entpuppte sich später als die Apokalypse schlechthin. Auf den Schienen und ihren Gleisbetten waren die Seelensprinter gekommen.
Es schauerte Jakob noch immer bei dem Gedanken an die riesige, fast organisch wirkende Lokomotive mit dem schiefen Schornstein und den aufgeblähten Waggons, an den Rohrkessel und die Kolbendampfmaschine, die in diesem seltsamen grünlichen Licht leuchtete. Und die Seelensprinter entluden ihre unheilige Fracht in den Wäldern: die tollwütigen Seemänner … Jakob verscheuchte den Gedanken, bevor er sich bildhaft vor seinem inneren Auge manifestieren konnte. Stattdessen lenkte er seinen Aufmerksamkeitsfokus wieder nach außen. Achtsamkeit. Der Schlüssel, um negative Gedanken und Gefühle loszuwerden. Das hatte Lehrer Tempels immer gesagt. Gleich hatte er den angrenzenden Wald erreicht! Nur noch wenige Schritte.
Als er durch die dichten dunklen Tannen trat, bemerkte er die Kälte, die ihm entgegenschlug. Es war, als hätte er eine Schwelle überschritten, den Übergang in eine andere Welt. Von den sommerlichen Temperaturen war hier zwischen den Baumriesen nichts mehr zu spüren. Obwohl er den weiten Weg gerannt war und sehr stark schwitzte, bildete sich eine Gänsehaut auf seinen Armen. Er fröstelte. Sein Schweiß fühlte sich plötzlich kalt und schmierig auf der Haut an.
Jakob verfiel wieder in ein Lauftempo und joggte den Waldweg entlang. Schließlich gabelte sich der Weg erneut auf. Irritiert blieb er stehen und kratzte sich am Hinterkopf. Er wusste nicht mehr genau, in welcher Richtung die alten Weiher lagen.
In seinem früheren Leben hatte er die Fischteiche stets gemieden. Sie waren das Revier von Dirk Wolpers und seinen Schlägern gewesen. Wer dort unerlaubt auftauchte, hatte eine gehörige Tracht Prügel bekommen. Instinktiv entschied er sich für den linken Pfad. Es war sein inneres Bauchgefühl, vielleicht eine Art Intuition, die ihn zu dieser Entscheidung veranlasste. Und sein Bauchgefühl sollte recht behalten.
Nach circa zehn Minuten erreichte er das Gewässer. Das Erste, was er wahrnahm, war der unangenehme Geruch von Moder und Verwesung, der wie eine unsichtbare Wolke über dem schlammigen Wasser herrschte. Überall ragten verwitterte Baumstümpfe aus der Erde. Eine gespenstische Stille lag über dem Teich. Jakob vermisste das Quaken der Frösche, das sanfte Plätschern der Fische, wenn sie die Oberfläche durchstießen, um ein unvorsichtiges Insekt zu verschlingen. Die Wasseroberfläche war jedoch so glatt wie geschliffenes Glas.
Langsam schritt Jakob um das faulige Gewässer herum. Auf der anderen Seite befand sich verwildertes Gebüsch. Von Weitem sah es so aus, als sei das Gestrüpp entfernt worden, um einen Weg zu bilden, der tiefer in das Herz des Waldes führte. Doch dem war nicht so bei näherem Hinsehen. Jakobs Bauch zog sich zusammen. Jetzt hast du deine Gewissheit!, flüsterte ihm seine innere Stimme zu. Auf dem Boden lagen die Bahnschienen! Deutlich größer und wuchtiger als gewöhnliche Bahnschienen auf einem aufgefüllten Schotterbett. Man konnte fast meinen die Hecken und Bäume wären zurückgewichen, um den Gleisen Platz zu machen.
Jakob trat vor die Schienen. Jetzt erkannte er auch die Gravur, die in den Stahl eingelassen worden war. Kýrie eléison, was so viel wie Herr, erbarme dich heißt! Eine archaische Huldigung an eine Vielzahl von Göttern – in diesem Fall an die mächtigen Olympioi, die das Multiversum beherrschten und ihre Wurzeln in der griechischen Mythologie hatten.
Die Angst schien Jakob förmlich mit dem Boden zu verwurzeln. Die Schienen waren noch da! Jakob blickte das Gleisbett entlang. Sie waren noch nicht weit ausgebaut, doch mit jeder Stunde, die verstrich, würden sie wie von Geisterhand länger werden. Vielleicht ein paar Tage noch, und sie wären lang genug, um die Seelensprinter in diese Dimension zu bringen. Fuck!
Er überlegte fieberhaft, was er tun sollte. Ein Gedanke jagte den anderen. Wenn die tollwütigen Seemänner eintrafen, dann wäre er geliefert. Normale Waffen konnten diesen Kreaturen mit ihren altertümlichen Taucheranzügen nichts anhaben. Es waren Dämonen, die nicht den irdischen Gesetzen unterworfen waren. Man konnte sie nur mithilfe von Bannzaubern und Ritualen zur Strecke bringen. Eines dieser Rituale war in einer von Dominikanermönchen geschriebenen Ausgabe des Hexenhammers verewigt worden. Es gäbe die Möglichkeit, nach Darmstadt zu fahren und in der Universitätsbibliothek den Hexenhammer an sich zu nehmen. Jakob schüttelte den Kopf. Damals waren sie als Gruppe aufgebrochen und hatten mehr Glück als Verstand gehabt, um dieses geheimnisvolle Buch in ihren Besitz zu bringen. Sie waren mehrere Personen gewesen. Außerdem hatte er den Cowboy und Simon Hauser an seiner Seite gehabt. Jetzt war er alleine. Es gab niemanden mehr, der ihn unterstützte. Und auf einmal fühlte er sich so schrecklich müde und ausgelaugt. Seine Kräfte schienen zu schwinden. Er hatte eine unglaubliche Reise hinter sich, hatte so viele Freunde verloren und war dem Tod mehr als einmal von der Schippe gesprungen. Jetzt war es genug! Er konnte nicht noch einmal das Ganze von vorne durchleben. Und es gab auch keinen Primus mehr, der ihm aus dieser sterbenden Welt bei der Flucht helfen würde. In diesem Moment fühlte er sich wie jemand, der des Lebens überdrüssig war und nur noch wollte, dass es aufhörte. Besonders groß war für ihn die Enttäuschung, dass der Primus ihn reingelegt hatte. Es war sein Todesurteil gewesen!
Tief in Gedanken versunken lief er den Waldweg zurück zur Stockwiese. Damals hatten sie sich in der alten Kurklinik vor den tollwütigen Seemännern versteckt. Es war der ideale Unterschlupf gewesen. Die Klinik hatte über viele Jahre als Lungenheilanstalt gedient, war aber im Laufe der Zeit geschlossen worden, weil die Kurgäste ausblieben. Seit der Schließung der Kurklinik hatte sich niemand mehr um das parkähnliche Gelände gekümmert, sodass es sich mit der Zeit in ein verwildertes Areal verwandelt hatte.
In der Kurklinik könnte er vielleicht eine Zeit lang untertauchen. So wie damals. Die tollwütigen Seemänner würden ihn in dem verfallenen Gemäuer mit seinen labyrinthartigen Gängen nicht finden. Aber wenn er sich dort versteckte, dann würde es seinen Tod nur hinauszögern. Jakob erinnerte sich plötzlich daran, dass auf ihrer Flucht mit dem Seelensprinter, eigenartige Flugzeuge am Himmel aufgetaucht waren, die mit ihren stählernen Stacheln wie fliegende Kastanien ausgesehen hatten. Aus den Luken dieser Flugobjekte war eine kristalline Flüssigkeit geströmt, die das Land in ein Flammenmeer verwandelte. Wenn ihn nicht die tollwütigen Seemänner erwischten, dann auf jeden Fall die Flugzeuge mit ihrer tödlichen Ladung.
Tief in Jakob war noch ein letzter Funke Hoffnung, das letzte Aufbäumen seines Überlebenswillens. Und so machte er sich auf den Weg in Richtung des Sanatoriums.
Kaum hatte er den Wald wieder verlassen, schlug ihm die Restwärme des Sommers entgegen. Und auch die Geräusche der Natur drangen an sein Ohr: Vogelgezwitscher, das freudige Lärmen der Kinder, die mit ihren Rädern durch die Stockwiese fuhren, das Rauschen der Autos in der Ferne.
Fünf Minuten später stand er vor der Heilanstalt. Er konnte nur schemenhaft das unansehnliche Betongebäude von seiner jetzigen Position aus sehen. Hoch gewachsene Bäume und Gebüsche versperrten die Sicht auf den Eingangsbereich. Das gesamte Klinikareal wurde von einer verwilderten Hecke samt Maschendrahtzaun eingesäumt. Jakobs Blick tastete über den Zaun, doch es gab keine Öffnung mehr. Er erinnerte sich wehmütig daran, dass Roland damals mit einer Drahtschere ein Loch in den Maschendrahtzaun geschnitten hatte, sodass sie Zugang zu dem dahinterliegenden urweltlichen Garten hatten. Sie hatten sich auf dieser Welt nie in der Kurklinik getroffen. Ihm fiel ein, dass ihm der Primus erzählt hatte, dass es auf dieser Welt keinen Jakob Großmüller gebe. Möglicherweise existierten dann auch kein dicker, gutmütiger Schnute, der gerne Videospiele spielte, kein schlaksiger Roland, auf den man sich immer verlassen konnte, und auch nicht der zurückgebliebene Mehlsack oder der introvertierte Peter. Ihre Rolle als Außenseiter an der Schule hatte sie damals fest zu einer Gruppe zusammengeschweißt. Wirklich schade … Es waren gute Freunde gewesen. Sie fehlten ihm so sehr!
»Na, dann mal an die Arbeit!«, sagte er und versuchte, über den Zaun zu klettern, denn eine Drahtschere hatte er nicht dabei. »Dann wollen wir mal das Ende der Welt vom obersten Stockwerk aus anschauen. Freie Sicht für alle!« Mit diesen Worten tauchte er in die Büsche des Sanatoriums ein.
»Was war das?«, fragte Jeremy Slater, die Winchester fest umschlungen. Seine Mannschaft hatte sich vor der Winterhütte eingefunden und starrte auf die Spuren im Erdreich, die um das Gebäude führten. Die Abdrücke der Klauen waren besonders gut zu sehen, denn der Boden war immer noch schlammig. Diese Kreatur musste riesig sein.
»Ich weiß es nicht. Ich habe so etwas noch nie gesehen«, antwortete der Pawnee und in seinem Gesicht zeigte sich wieder eine Mischung aus Ratlosigkeit und Verwirrung.
»Ist es weg?«
Nach kurzem Zögern erwiderte Morgan Elroy: »Ja, ich denke schon.«
»Du denkst?«
»Die Spuren führen eine halbe Meile in den Wald hinein. Ich bin ihnen nicht weiter gefolgt.«
»Vielleicht ein sehr großer Bär?«
Hilflos zuckte der Indianer mit den Achseln. »Die Spuren sehen eher nach einem großen Wolf aus. Was auch immer es ist, es ist kein gewöhnliches Tier.«
»Was meinst du damit?«
»Beim allmächtigen Tirawa«, sagte Morgan Elroy und benutzte zum ersten Mal den Namen seines Gottes, »das war ein Dämon!« In diesem Moment wirkte der Mann mehr wie ein Mitglied seiner Indianersippe als jemand, der den Großteil seines Lebens bei Weißen aufgewachsen war. Seine Augen waren hart wie Flintsteine.
Jeremy Slater winkte müde ab. »So etwas gibt es nicht. Du müsstest das am Besten wissen. Du bist einer von uns, keine abergläubische Rothaut!«
»Das hier spricht aber eine andere Sprache!«, erwiderte Morgan Elroy düster, umfasste sein Amulett mit dem Adler und dem Wolf, die für Mut standen, das er an einem Lederriemen um den Hals trug, und fuhr dann fort: »Die Algonkin glauben an einen Dämon namens Anamaqukiu. Er ist die Verkörperung von allem Bösen. Dieser dunkle Geist soll die Gestalt eines riesigen Wolfes annehmen können. Als Kind habe ich oft diesen Geschichten am Lagerfeuer gelauscht.«
»Also ist dieser Anamaqukiu heute Nacht um die Hütte geschlichen?«
»Erklär du mir diese Abdrücke im Schlamm!«
Jeremy Slater ging in die Hocke und hielt seinen Arm neben den Krallenabdruck. Der Umriss war genauso groß wie sein Unterarm. Einer von Slaters Männern pfiff.
»Verflucht!«, murmelte Slater und erhob sich wieder.
Der Cowboy stand etwas abseits von den beiden Männern und verfolgte wortlos die Diskussion. Er überlegte, ob er sich in das Gespräch einmischen und Jeremy Slater aufklären sollte. Das würde aber auch bedeuten, etwas von seiner Vergangenheit zu erzählen. Es würde viele Fragen aufwerfen. Und man durfte nicht vergessen, dass sich diese Männer erst am Anfang eines Zeitalters befanden, das sich der Aufklärung verschrieben hatte. Sie würden viele Dinge nicht verstehen und ihn für einen Verrücken halten.
»Was sagst du dazu?«, wollte Jeremy nun von dem Cowboy wissen.
»Ich kann nur sagen, dass ich mir beinahe in die Hose geschissen hätte. Was auch immer es ist, es hat mit seiner Visage durch das Fenster geschaut und uns beobachtet.«
»Du glaubst also auch, es war dieser Anamaqukiu?«
»Vielleicht etwas Ähnliches«, antwortete der Cowboy.
»Was machen wir jetzt, Boss?«, fragte einer der Männer unsicher.
Slater blickte in die Runde. Er nahm ein Stück Kautabak aus der Tasche, steckte sich den Riegel in den Mund und begann zu kauen. »Das, was wir immer machen. Wir gehen Mavericks einfangen!«
»Und dieses Monster?«
Jeremy Slater lächelte drohend, wobei er eine eisige Kälte ausstrahlte, die den Männern durch Mark und Bein ging. »Wenn es noch einmal unsere Wege kreuzt, dann töten wir es!«
Und so stiegen die Männer auf ihre Pferde und ritten los. Während ihres Rittes verschlangen sie trockene Biskuits, um ihr Hungergefühl ein wenig zu betäuben. Niemand wollte länger als nötig in der verfluchten Hütte bleiben. Im Laufe des Vormittags zog sich der Himmel wieder zu. Ein neuerliches Unwetter lag in der Luft. Der Wind trug den Geruch von Regen und Präriegras.
Der Cowboy hing während des gesamten Rittes seinen düsteren Gedanken nach. Hekate hatte überlebt, so viel war sicher. Und sie hatte ihn nicht vergessen. Er überlegte, warum sie ihn nicht getötet hatte. Die Gelegenheit wäre da gewesen. Gegen die mächtige Wolfskreatur mit den acht Augen hätten die Männer nicht den Hauch einer Chance gehabt.
»Ach, es hätte alles so perfekt sein können«, murmelte der Cowboy leise in seinen Bart hinein. »Und dann kommt diese blöde Schlampe und macht alles zunichte!« Er musste bei der nächsten Gelegenheit mit Slater über Hekate reden.
Einmal machten sie eine Pause von einer halben Stunde, um den Pferden eine kurze Rast zu gönnen. Jeremy Slater und der Pawnee betrachteten eine alte Karte von der Region und diskutierten darüber, in welchem Gebiet sich eine Rinderherde verstecken könnte. Danach stiegen sie wieder auf und ritten weiter.
Nach einer gefühlten Stunde kamen sie in ein Tal, das von Hügelketten gezeichnet war. Es gab zwei größere Seen, in die mehrere Wasserläufe aus den Bergen mündeten. Zahlreiche Vögel kreisten über dem Areal. Der Pawnee hob die Hand, das Zeichen zum Anhalten.
»Warum halten wir hier an?«, wollte der Cowboy wissen und gesellte seinen Rappen neben das Pferd des Indianers. Slater selbst beobachtete stumm die Vögel am Himmel.
Morgan Elroys geschultem Auge waren die Kadaver im Tal sofort aufgefallen. Der Cowboy kniff die Augen zusammen und blickte in die Richtung, in die der Pawnee stillschweigend deutete. Einer von Slaters Männern stieß einen Fluch aus. Der Mann neben dem Cowboy machte ein Kreuzeichen und küsste ein kleines Kruzifix, das an einer Schnur um seinen Hals hing.
Was zunächst aussah wie kleine braune Misthaufen, entpuppte sich beim Näherkommen als Rinderkadaver. Es waren bestimmt an die fünfzig. Überall wimmelte es von Vögeln mit schwarzem Federkleid und langen, breiten Flügeln, deren kleiner roter Kopf unbefiedert war. Es waren Truthahngeier, die mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn Aas schon kilometerweit riechen können. In Scharen waren sie über die toten Rinder hergefallen.
Slater gab seinem Pferd die Sporen und ritt ins Tal hinein. Ein gewaltiger Vogelschwarm erhob sich kreischend von der Wiese. Einige Geier ließen sich von den Neuankömmlingen jedoch nicht stören und rissen mit ihrem elfenbeinfarbenen Schnabel Fleischbrocken aus den verendeten Rindern.
Morgan Elroy stieg von seinem Pferd und näherte sich den toten Tieren. Es bedurfte keines Fährtenlesers, um zu sehen, dass die Tiere noch nicht lange tot waren. Vielleicht eine halbe Stunde – mehr aber nicht. Die Kadaver waren noch warm, es gab keine Anzeichen für eine einsetzende Leichenstarre.
Doch was die Männer am meisten beunruhigte, waren die tiefen Biss- und Klauenspuren auf den Körpern. Einer Kuh war der Bauch seitwärts mit einem mächtigen Hieb aufgerissen worden. Man sah ganz deutlich auf der Haut die Abdrücke der fünf Krallen, wie sie mit brachialer Gewalt über den Körper gefahren waren. Ein Teil der Gedärme hatte sich auf den Boden ergossen. Bei einem Longhorn war der halbe Hals aufgerissen.
»Anamaqukiu!«, flüsterte Morgan Elroy, während sie zwischen den toten Tieren hindurchliefen.
»Wie kann das sein?«, wollte Slater wissen. »Die Spuren gingen doch in den Wald!«
»Es muss einen weiten Halbbogen geschlagen und uns parallel gefolgt sein. Während wir rasteten, hat es uns vermutlich überholt«, sagte Morgan Elroy nachdenklich.
»Dann muss dieses Wesen schneller als unsere Pferde sein! Wie ist so etwas möglich?«
»So schnell ist kein Tier. Es sei denn, es ist geflogen!«
Der Pawnee umkreiste die toten Tiere, ging mehrere Male in die Hocke, um den Boden zu untersuchen. Dann ritt er mit dem Pferd zum gegenüberliegenden Ausgang des Tales, den Blick immer nach unten gerichtet. Nach zwanzig Minuten kehrte er zu Slater zurück. »Hier muss eine große Herde gewesen sein. Vielleicht tausend Rinder. Das Raubtier ist über die Herde hergefallen und hat diese in eine Stampede versetzt. Die Rinder sind aus dem Tal geflohen.«
»Mit was haben wir es hier zu tun? Ein einziges Tier kann eine Herde von tausend Rindern in eine Stampede versetzen?«
»Ich weiß es nicht.«
Der Cowboy blickte zu den beiden Männern. Er überlegte, ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, um Slater reinen Wein einzuschenken. Doch er entschied sich dagegen. Es wäre besser, wenn er mit Jeremy alleine unter vier Augen sprechen würde. Er wollte nicht, dass sich das Team gegen ihn verbündete. Dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er die Blue-Lodge-Ranch verlassen müsste.
»Was machen wir nun, Boss?«, fragte einer von Slaters Männern. Es war der älteste Bursche im Team, dessen narbiges Piratengesicht zum größten Teil von einer Augenklappe und einem gewaltigen Lederhut verdeckt wurde.
»Wir folgen der Herde!«, entschied Jeremy Slater. »Niemand wird mir diese Rinder streitig machen!« Er blickte in die Gesichter seiner Männer. »Wenn jemand Zweifel hat, dann kann er auf die Blue-Lodge-Ranch zurückkehren. Ihr seid freie Männer. Niemand wird gezwungen mitzureiten.« Unsicher schauten sich die Männer an. Sie hatten Angst. Doch keiner sagte etwas.
»Gut, dann reiten wir weiter. Lasst uns aus diesem Tal des Todes verschwinden!« Mit diesen Worten gab Jeremy Slater seinem Pferd die Sporen.
Sie erreichten die Rinder, die sich in ihrer unkontrollierbaren Flucht nach Norden bewegt hatten, mit dem Einsetzen der Dämmerung. Manchmal konnte eine Stampede – ein gefürchtetes Phänomen – mehrere Stunden andauern, bis sich die Tiere wieder beruhigten. Doch die Männer hatten Glück. Friedlich graste die Herde in einer weiten Ebene, die völlig baumlos war. Wie ein riesiger dunkelbrauner Teppich bedeckten sie das Land. Es gab einen kleinen See, der durch die Regenfälle der letzten Nacht an vielen Stellen übers Ufer getreten war.
Sie schlugen ihr Lager eine halbe Meile von der Herde entfernt auf. Die Männer waren unruhig bei dem Gedanken hier draußen schutzlos dem Untier ausgeliefert zu sein. Es gab keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Slater entschied, dass sie jeweils zwei Mann als Nachtwache aufstellten. Diese sollten in einem Kreisbogen die Lagerstätte ablaufen. Man würde sich alle zwei Stunden abwechseln. Der Rancher wollte kein Risiko eingehen. Morgan Elroy bestand darauf, in dieser Nacht auf ein Lagerfeuer zu verzichten.
Der Himmel verdunkelte sich zunehmend und die ersten Sterne erschienen am Firmament. Wortlos verzehrten sie ihren letzten Biskuit und spülten die Krümel mit Wasser und dem letzten Tropfen Whiskey hinunter. Jeder hing seinen eigenen düsteren Gedanken nach. Das Brummen und Schnaufen der Herde drang zu ihnen herüber.
In dieser Nacht machte der Cowboy das erste Mal Bekanntschaft mit den fiesen Büffelmücken, die eine solche Herde begleiten und sehr schmerzhafte Stiche zufügen. In dichten Wolken schwebten sie über der Herde. Binnen kürzester Zeit war er an jeder freien Körperstelle zerstochen und es zeigten sich bereits Schwellungen wie von einem Bienenstich. Sie peinigten ihn entsetzlich! Ärgerlich schwang er seinen Hut hin und her, um die Biester von sich fernzuhalten.
Irgendwann gesellte sich Jeremy Slater zu ihm, rollte seine Bettmatte neben ihm aus und legte sich hin. Sie lagen etwas abseits von den anderen und starrten zunächst eine Weile wortlos in den Sternenhimmel. »Ich habe dir ein Abenteuer versprochen, als wir losgeritten sind«, begann Slater das Gespräch. »Nun, ich habe nicht zu viel versprochen.«
Der Cowboy blickte sich um, um festzustellen, ob sie ungestört waren, denn er wollte nicht, dass die Männer im Lager etwas mitbekamen, denn es war an der Zeit, Slater aufzuklären. Das war er ihm schuldig! Der Rancher hatte ihn in sein Haus aufgenommen und ihm eine Perspektive als Maverickjäger geboten. Slater verdiente eine Antwort!
»Well, da gibt es etwas, was ich Ihnen sagen muss …« Er hielt kurz inne, um nach den richtigen Worten zu suchen. Slater drehte sich zu ihm. Seine rauchgrauen Augen musterten den Cowboy aufmerksam.
»Morgan hat recht. Wir haben es hier mit einem sehr, sehr großen Wolf zu tun. Eigentlich einer Wölfin, aber das tut im Moment nichts zur Sache.«
»Woher weißt du das?«, fragte der Rancher alarmiert.
»Weil dieses Monster noch eine Rechnung mit mir offen hat.«
»Warum hast du vorhin nichts gesagt?«
»Gute Frage. Weil ich ein Mann bin, der sich nicht gerne von seiner Vergangenheit einholen lässt.«
»Ich mag keine Männer mit Geheimnissen. Wenn du für mich reitest, dann darf es keine Geheimnisse zwischen uns beiden geben!«, stellte Jeremy klar und schüttelte den Kopf. »Du bist schon ein seltsamer Vogel! Erzähl mir von dieser Kreatur und warum sie es auf dich abgesehen hat!«
Und so begann der Cowboy zu erzählen. Er ließ einige Sachen weg, weil Jeremy Slater dies nicht verstanden hätte. Und trotzdem verwandelte sich das Gesicht des Ranchers immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes in ein Fragezeichen. Er hakte oft nach und musste sich manches zweimal erklären lassen. Als der Cowboy seine Erzählung beendet hatte, fühlte sich seine Kehle vom vielen Sprechen ganz rau an. Es dürstete ihn nach einem kühlen Schluck Wasser.
»Was geht Ihnen durch den Kopf, Boss?«, wollte der Cowboy wissen, nachdem Slater keine Anstalten machte, etwas zu sagen und nur vor sich hin schwieg.
»In Kansas City haben sie eine große Heilanstalt gebaut für diejenigen, die nicht mehr ganz klar im Kopf sind. Ich glaube, da gehörst du hin!«
»Sie wissen, dass ich die Wahrheit spreche!«
»Eine Frau, die sich in einen Wolf verwandeln kann? Zumal kein menschliches Wesen, sondern eine Göttin aus der griechischen Sage? Das klingt wirklich sehr schräg!« Jeremy Slater schüttelte ungläubig den Kopf.
Der Cowboy griff nach seiner Feldflasche und versuchte, sie in einem Zug zu leeren. Resigniert musste er feststellen, dass nur noch ein kleiner warmer Rest drin war, der zudem einen seltsamen Nachgeschmack in seinem Mund hinterließ.
Slater reichte ihm seine Flasche, die noch halb voll war. Dankbar nahm er sie entgegen.
»Diese Hekate … wird sie ein Problem für uns?«
»Ich kann es nicht sagen. Aber sie ist unberechenbar!«
»Ich werde mit Morgan reden müssen. Er ist mein bester Mann.«
»Kein Problem.«
»Es darf kein unschuldiges Blut vergossen werden. Wenn meine Männer in Gefahr sind, dann ist es besser, wenn sich unsere Wege trennen«, meinte Slater nach einiger Zeit mit Blick auf seine Leute.
»Ein Wort von Ihnen und ich reite bei Anbruch des Tages weiter«, sagte der Cowboy und er meinte es auch so.
Slater griff in seine offene Westentasche und holte eine alte Taschenuhr heraus. Sie war golden und mit einem mechanischen Glockengeläut ausgestattet. Ein weiteres Indiz, dass der Rancher sehr wohlhabend sein musste. »In zwei Stunden wird mich Millard wecken. Ich werde während meiner Nachtwache darüber nachdenken!«
»Well, danke!«, sagte der Cowboy und ließ sich zurück auf seine Bettrolle sinken. Er würde es Slater nicht übel nehmen, wenn er ihn wegschicken würde. Für ihn waren seine Männer so etwas wie Familie. Er trug Verantwortung. Möglich, dass sich im Morgengrauen ihre Wege trennen würden. Es wäre nachvollziehbar, wenn der Rancher sich keine weitere Baustelle aufmachen wollte. Er hatte genug mit Desmond Pickett zu tun.
Licht drang ins Gemäuer. Quietschend öffnete sich die Tür zum Verlies. Katerina Kurnikova schreckte aus ihrem Schlaf hoch. Die Dunkelheit wich wie eine lebende Substanz zurück. Es leuchtete matt vor ihr. Das Licht warf Schatten an die Wände, die den Dingen bizarre Umrisse gaben. Katerina hob die Hand, denn das Licht blendete sie.
»Hoi, Süße! Ich wollte dich einmal in deiner ganzen Pracht bewundern!«, begrüßte sie eine Stimme, die scheinbar zu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte.
Katerina erstarrte. Vor ihr stand einer von Desmonds Männern. Sie hatte den blonden Kerl, der in seiner Rechten eine Öllampe trug, schon einmal auf dem Platz vor der Three-Pearls-Ranch gesehen. Er lächelte die Gefangene an. Es war ein gewinnendes Lächeln, das jedoch von der Gier in seinen Augen übertönt wurde.
Katerinas Gesicht verzog sich. »Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wenn Desmond Pickett erfährt, dass du hier bist, wird er dich kastrieren lassen!«, schnaubte sie verächtlich.
Doch der Mann schüttelte den Kopf. »O nein! Du wirst ihm nichts davon erzählen. Wir beide werden unseren Spaß haben und dann gehen wir wieder getrennte Wege.« Unsicher machte er einen Schritt auf Katerina zu. Wahrscheinlich hatte er eine ganze Flasche Schnaps getrunken, denn seine Bewegungen wirkten fahrig und unkoordiniert. Der Alkohol hatte ihn fest im Griff. Das Feuerwasser hatte ihn geil gemacht.
Katerina überlegte, ob sie laut schreien sollte. Vermutlich hatte der Kerl die Kellertür geschlossen, und niemand würde sie dort unten schreien hören. Genüsslich fuhr er sich mit der Zunge über die Lippen, als er den nackten Frauenkörper im Schein der Öllampe betrachtete.
Vorsichtig nahm Katerina die schweren Eisenketten in die Hand, wobei ihre Augen den Eindringling keine Sekunde aus den Augen ließen. Jetzt wechselte er die Öllampe in die andere Hand und begann langsam mit der rechten seine Hose zu öffnen. »Mein Liebeskrieger braucht etwas Luft und Freiraum!«, lallte er.
Noch fünf Schritte, dachte Katerina gebannt.
Er kam auf sie zu; seine Hose war halb heruntergezogen. Der Bastard war bereit, ihren Körper zu schänden.
Drei Schritte …
»Weißt du, ich hab mir gedacht, dass du meinen …«, sagte er mit belegter Stimme und wankte dabei unsicher hin und her.
Zwei Schritte … Katerinas ganzer Körper war stark angespannt.
»Und dann könnte ich dich noch von hinten …«
Weiter kam der Fremde nicht, denn er hatte das weiße Kreuz, das Pickett auf den Boden gemalt hatte, überschritten. Raubkatzenartig stürzte sich Katerina auf den überraschten Mann und warf ihn zu Boden. Sie wickelte die schwere Eisenkette um seinen Hals und begann an dieser zu ziehen. Der Mann versuchte zu schreien, doch die Kette bohrte sich fest in seinen Hals. Seine Stiefel schabten über den Kellerboden. Katerina kanalisierte ihren ganzen Hass auf diesen Kerl. In diesem Moment war es Pickett, der vor ihr auf dem Boden lag. Mit unbarmherziger Härte schnürte sie ihm die Luft ab. Verzweifelt versuchte sich der Fremde zu wehren. Seine Hände griffen nach Katerina, rissen an ihren Haaren. Sie schrie auf und zerrte ihn weiter nach hinten. Mit jeder Sekunde, die verstrich, wurden seine Bewegungen langsamer. Und dann wich jedes Leben aus seinem Körper. Die Füße schabten ein letztes Mal über den dreckigen Boden. Dann wurde es still. Der Geruch von Urin breitete sich in dem Raum aus. Sie spürte, wie die warme Flüssigkeit ihre Waden benetzte. Angewidert stieß sie den Toten von sich weg.
Sie glaubte, jeden Moment eine Panikattacke zu bekommen. Das Adrenalin rauschte durch ihren Körper; Lichtpunkte tanzten in einem irren Durcheinander vor ihren Augen. Sie hatte das Gefühl, als würde sie selbst ersticken. Wie ein Fisch, der an Land gespült wird, japste sie nach Luft. Ihre linke Gesichtshälfte fühlte sich plötzlich taub an. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ihr Körper wieder herunterfuhr und sie sich wieder beruhigte. Das Taubheitsgefühl blieb dagegen bestehen.
Das Öl in der Lampe war aufgebraucht und die Finsternis kehrte zurück. Ihr Körper war komplett ausgelaugt. Jetzt wäre sie dankbar, wenn der Schlaf sie überkommen und ihr Bewusstsein wenigstens für ein paar Stunden auslöschen würde. Sie dachte noch einmal an jenen Tag, als sie auf den großen Steamer gestiegen war. Desmond Pickett hatte an Bord auf sie gewartet … Mit diesem Bild kam der Schlaf, doch er brachte ihr keine Erlösung.
Nachdem sie sich im Morgengrauen in dem kleinen See gewaschen hatten, teilte Jeremy Slater dem Cowboy seine Entscheidung mit. Hekate hatte sich in dieser Nacht nicht blicken lassen.
»Du wirst mich heute als Treiber nicht enttäuschen!«, sagte Slater, während er sich das Gesicht mit Wasser benetzte.
»Ich hatte einen guten Lehrer!«, grinste der Cowboy.
»Gut, denn wir werden diese Herde heute zur Blue-Lodge-Ranch treiben!«, erwiderte Slater und klopfte dem Cowboy auf die Schulter. »Keine Geheimnisse mehr zwischen uns beiden! Deal?«
»Darauf können Sie einen fahren lassen!«, sagte der Cowboy.
»Ich nehme mal an, das heißt Yeah!«
Die Männer verteilten sich um die Herde und versuchten, diese in die gewünschte Richtung zu treiben. Die am Ende der Rinderherde reitenden Cowboys zogen als Schutz gegen den aufwirbelnden Staub ihre Halstücher über die Nase. Das Treiben der Herde war im wahrsten Sinne des Wortes ein Höllenjob! Die Tiere waren mit dem Führen von Menschenhand nicht vertraut, viele versuchten immer wieder auszubrechen. Außerdem waren sie das ständige In-Bewegung-Sein nicht gewohnt. Aus diesem Grund schaffte das Team um Jeremy Slater keine vier Meilen am Tag.
Der Cowboy selbst fluchte pausenlos, denn die Tiere schienen zu wittern, dass er das unerfahrenste Mitglied in der Gruppe war. Wenn er auf die lose Rinderfront zuritt, dann wichen die zottigen Ungetüme einfach zur Seite und machten ihm Platz. »Ihr sollt mir keinen Platz machen, sondern eure Ärsche in Bewegung setzen!«, schnaubte der Cowboy. Und so bahnten sie sich Schritt für Schritt einen Weg zurück zur Blue-Lodge-Ranch.
Als es wieder dunkel wurde, entschied Slater, dass sie trotzdem weiterritten, denn die Nacht war diesmal besonders hell, mit meilenweiter Sicht. Erst lange nach Mitternacht schlugen sie in der Nähe eines Prärie-Creeks ihr Lager auf. Durch die anhaltenden Regenfälle hatte sich der Creek in einen reißenden Strom verwandelt. Das Wasser war dreckig, eine braune Brühe, die mit Schlamm und Treibholz durchsetzt war. Einer von Slaters Männern wollte in dem Gewässer schwimmen gehen, doch Morgan Elroy hielt ihn davon ab.
»Das lehmige Wasser ist zu schwer«, erklärte der Pawnee. »Wenn sich deine Kleidung damit vollsaugt, kannst du dich nicht mehr in der Strömung halten. Du wirst wie ein nasser Sack untergehen!«
Jeremy Slater zauberte eine weitere Flasche Whiskey aus seinen Satteltaschen. Die Kerle grölten fröhlich und gesellten sich um ihren Boss. Für einen kurzen Augenblick war die unheimliche Kreatur, die die Rinder gerissen hatte, vergessen. Morgen würden sie die Herde ins Valley der Blue-Lodge-Ranch bringen. In Gedanken versunken, nippte der Cowboy an seinem Trinkbecher. Solange sie nicht auf der Ranch waren, würde er keine Sekunde ruhig schlafen können. Hekate war ein Miststück und sie würde sich früher oder später wieder zeigen.
Die Männer standen in drei Reihen hintereinander auf dem Hof der Three-Pearls-Ranch. Brutal brannte die Mittagssonne auf sie herab. Der Schweiß floss in Strömen über die Gesichter. Die Hemden waren durchgeschwitzt. Doch das nahmen die Männer nur am Rande wahr. Alle Augen waren auf Desmond Pickett und seine rechte Hand, Mr. Willard, gerichtet, die aus dem Haupthaus kamen. Augenblicklich nahmen die Männer Stellung an.
Pickett hatte sein weißes Tuch mit dem hellblauen Karomuster in der Hand und tupfte damit über seinen glänzenden Schädel. Willard folgte ihm wie ein Schatten. Trotz der hohen Temperaturen war er wie immer komplett in Schwarz gekleidet.
Pickett trat vor die versammelte Mannschaft, die sich sichtlich unwohl fühlte, als der kahlköpfige Mann sie mit grimmiger Miene musterte. Der Boss der Three-Pearls-Ranch war in übler Laune. Es fiel ihm sichtlich schwer, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten.
Pickett gab ein Zeichen und ein breiter Chuckwagon kam aus dem Stall gefahren. Der rattengesichtige Gary (der vor einem Tag aus Cheops zurückgekommen war) saß auf dem Planwagen. Wortlos lenkte er den Planwagen in den Hof. Das Pferd tänzelte nervös, als es vor den versammelten Männern zum Stehen kam. Gary stieg vom Wagen, nickte seinem Boss zu und öffnete dann die Plane des Chuckwagons.
Ein Raunen ging durch die Männer, als sie sahen, was sich unter der Plane befand. Gary zog den Toten aus dem Wagen und ließ ihn unsanft auf den Boden fallen. Eine Staubwolke stieg beim Aufprall des Körpers empor. Schnell trat Pickett einen Schritt zurück, aus Angst, dass seine schwarzen soeben polierten Stiefel staubig werden könnten.
Der Tote war nackt. Dort, wo seine Genitalien hätten sein sollen, befand sich nur ein dunkelroter, fast schwärzlicher Fleck. Der Hals war mit blauen länglichen Flecken übersät, die einen starken Kontrast zu der bleichen Haut bildeten. Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt, denn die Finger waren seltsam verkrampft. Wie ein dicker, aufgeblähter Wurm hing die Zunge aus dem offenen Mund heraus.
»Tja, ich muss euch leider die traurige Nachricht überbringen, dass unser langjähriger Weggefährte Tony seine letzte große Reise angetreten hat.« Picketts Stimme war leise, trotzdem war sie bis in die hinterste Reihe zu hören. Der Boss der Three-Pearls-Ranch musste sich sehr beherrschen, dass er keinen Tobsuchtsanfall bekam.
»Und wisst ihr, wie er gestorben ist?«, fragte Pickett in die Runde. In diesem Moment wirkte sein Gesicht einmal mehr wie ein sprechender Totenkopf. Aufgrund seiner inneren Erregung spannte sich die Haut straff über den Schädel.
»Keine Idee? Niemand?« Desmond Pickett starrte in die ängstlichen Gesichter seiner Männer. Niemand wagte es, den Boss direkt anzuschauen.
»Gut, dann sage ich es euch! Dieser Scheißkerl wollte sich an meiner geliebten Katerina vergreifen.«
Unsicher schauten sich die Männer an. Sie konnten nicht begreifen, dass Tony so dumm gewesen war!
»O ja, ihr habt richtig gehört! Dieser Bastard hat sich zugesoffen und ist dann in MEINEN Weinkeller spaziert, um MEINE KATERINA zu ficken!«
Noch immer blieb es still. Die Anspannung war so präsent, dass sie fast greifbar war. Desmond Pickett schnaubte verächtlich und blickte auf seine polierten Stiefel. »Gott sei Dank hat sich MEINE Frau zu wehren gewusst und hat diesen Drecksack eigenhändig erwürgt.«
Pickett atmete tief ein und aus, um sich wieder zu beruhigen. »Wir werden seinen Körper den Ameisen zum Fraß vorwerfen und seine bleichen Gebeine in meinen Weinkeller hängen. Als Warnung für alle, die sich meinen Regeln und Gesetzen widersetzen!«
Die Männer nickten stumm. Einige atmeten erleichtert auf, doch sie hatten sich zu früh gefreut, denn der Zorn von Desmond Pickett war noch lange nicht erloschen.
»Wo ist Tonys Bruder?«, fragte er sanft und sein Blick wanderte durch die Reihen. »Na, wo ist er denn?«
Ein Mann mit kurzen blonden Haaren und einem Dreitagebart hob zögernd die Hand. Instinktiv wichen die anderen Männer einen Schritt von dem armen Kerl zurück.
»Du bist also der Bruder von dem lieben Tony?«, fragte Desmond und schien den jungen Mann mit seinen Augen aufzusaugen. Der Angesprochene nickte ängstlich.
»Wie ist dein Name? Martin, richtig?«
»Marten, Sir!«
»Ach ja, Marten! Ich erinnere mich.« Desmond Pickett winkte den angsterfüllten Burschen zu sich. »Komm mal her, ich möchte mich mit dir unterhalten!« Ganz langsam setzte sich Marten in Bewegung und trat furchtsam vor seinen Boss. In seinen Händen hielt er verkrampft seinen Stetson. Die versammelten Männer würdigten Marten keines Blickes. Der Boden und die Spitzen ihrer Cowboystiefel waren plötzlich viel interessanter als das Geschehen vor ihnen.
»Deine Familie kommt aus Cheops, richtig?«, fragte Desmond Pickett und legte dem jungen Mann wie ein guter Vater den Arm um die Schulter.
»J-Ja, Sir!«
»Deine Eltern führen den kleinen General-Store.«
»Das stimmt, Sir! B-Bitte, Sir … ich habe mit der Sache nichts zu tun. I-Ich wusste nicht, was Tony vorhat.«
»Das weiß ich, Marten. Das weiß ich doch!« Pickett grinste ihn an. »Heute ist dein Glückstag, mein Junge!«
»Wieso, Sir?«, fragte Marten unsicher, nachdem Pickett nicht weitersprach und stattdessen seinen Revolverhelden Willard zu sich winkte, der aus seiner Weste einen Strang Klaviersaiten zog. Martens Augen weiteten sich voller Entsetzen. »N-N-Nein, ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun! Bitte nicht! BITTE!«, flehte Marten und versuchte, einen Schritt zurückzuweichen. Doch Pickett griff nach seinem Arm und zerrte ihn unsanft zurück.
»Eigentlich wollte ich dich singen hören! Willard hat extra diese schönen Klaviersaiten besorgt. Aber ich habe es mir im letzten Moment anders überlegt!«
Erleichterung machte sich auf dem Gesicht des Mannes breit. Tränen rannen seine geröteten Wangen hinunter. »Danke, Sir! Oh Gott! Ich danke Ihnen!« Er ging demütig auf die Knie und küsste dankbar die Hand von Desmond Pickett.
»Wir haben uns etwas ganz Tolles für dich überlegt, mein Junge!«, sagte Pickett und trat einen Schritt zurück.
»Was?« Unverständnis spiegelte sich in dem Gesicht des Burschen wider.
Pickett gab Willard ein Zeichen und der Revolverheld trat vor den knienden Mann und zog seinen Revolver aus dem Holster.
»Ich möchte, dass du den Lauf von Willards Waffe in den Mund nimmst und daran lutschst!«
»N-N-Nein, Sir, das können Sie nicht machen! Bitte! Ich flehe Sie an!«
»NIMM DEN SCHEISSREVOLER IN DEIN MAUL, ODER ICH SCHWÖRE BEI GOTT, ICH WERDE DICH BEI LEBENDIGEM LEIB HÄUTEN, DU VERDAMMTE MISSGEBURT!«, schrie Desmond Pickett den jungen Mann an, während ihm der Speichel aus dem Mund lief. Sein Gesicht war vor Wut verzerrt.
»Tun Sie das nicht … bitte … ich habe …«, wimmerte der Mann am Boden. Er wollte noch etwas sagen, doch Willard hatte ihm schon den Lauf seines Revolvers mit brutaler Härte in den Mund gerammt. Wahrscheinlich waren die Vorderzähne dabei abgebrochen, denn ein dünnes Blutrinnsal ergoss sich über seine Lippen. Marten schloss verkrampft die Augen. Er wartete darauf, dass ihm der Revolverheld das Hirn wegblies. Doch nichts geschah! Ganz langsam öffnete Marten wieder die Augen und blinzelte zu dem Mann in Schwarz nach oben.
»Und jetzt saug an dem Ding!«, forderte ihn Pickett auf.
Als Marten anfing, den Lauf zu lutschen, nickte Pickett zufrieden. »Sehr gut! Schaut ihn euch an!« Er lachte laut auf und schlug sich auf die Knie.
»Tu mir einen Gefallen und puste sein Gehirn heraus!«, sagte er dann sanft in Willards Richtung. Martens Augen blickten entsetzt. Doch Willard drückte unbarmherzig ab. Der Knall war stark gedämpft. Für einen Moment war das überraschte Gesicht mit den weit aufgerissenen Augen noch da, im nächsten Moment schoss eine Feuerlanze aus dem Hinterkopf des armen Kerls, gefolgt von einer Blutfontäne und feinen Knochensplittern. Zuckend fiel der Körper zu Boden.
Fasziniert beobachtete Pickett das Todesspiel. Er spürte die Erregung in seiner Hose. Es fiel ihm schwer, nicht sein Glied herauszuholen und vor der versammelten Mannschaft zu masturbieren. Mühsam unterdrückte er die aufkommende Gier und wandte sich wieder an seine Männer: »Ich möchte, dass ihr meine Regeln und Gesetze respektiert. Wer auch immer sich an meiner Frau vergreift, wird dafür teuer bezahlen. Ist das klar?«
»JA, SIR!«, ertönte es lautstark.
»Sehr gut, sehr gut!« Pickett war zufrieden. Er wandte sich an Gary, der auf dem Planwagen Platz genommen hatte, um die Hinrichtung zu beobachten. »Gary, mein Lieber, ich fürchte, du musst zurück nach Cheops.«
»Geht klar, Boss!«, antwortete Gary und rutschte vom Wagen.
»Nimm den fetten Mexikaner … Ricardo … mit. Ihr beide seid ein eingespieltes Team.«
»Was sollen wir tun, Boss?«
»Such den General-Store auf und töte jeden einzelnen von Tonys Familie.«
»Okay … auch die Kinder?«
»Welches Wort von ›Töte jeden einzelnen von Tonys Familie‹ verstehst du nicht?«, fragte Desmond Pickett und eine Spur von neuerlichem Zorn schlich sich in seine Stimme.
»Wir brechen gleich auf, Boss!«
Pickett nickte zufrieden. »Lass uns zurück ins Haus gehen. Ich muss mich um meine geliebte russische Raubkatze kümmern. Katerina hat die ganze Sache sicherlich sehr zugesetzt!«
»Ich komme mit. Zu deiner eigenen Sicherheit!«, meinte Willard.
»Kümmert euch um die beiden Wichser hier!«, sagte Pickett zu niemand Bestimmten und deutete auf die Toten. »Meine Ameisen sind sehr, sehr hungrig.« Mit einer kurzen Handbewegung entließ er seine Leute und stiefelte mit Willard im Schlepptau zurück ins Haupthaus.