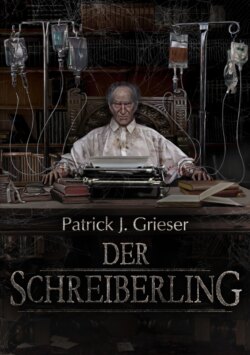Читать книгу Der Schreiberling - Patrick J. Grieser - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеFast hundertfünfzig Jahre später …
Die Sonne tauchte gemächlich hinter den Bergen auf und überflutete die Hutzwiese mit einem warmen goldenen Licht. Es sollte ein heißer Tag werden. In der Ferne erklang das Blöken einiger Schafe. Auf der verwilderten Gartenmauer war hier und da eine Zauneidechse zu sehen, die mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen aus ihrem Versteck gekrochen kam. Die Wiesen am Wegrand wirkten saftig und grün, ein leicht welliges Meer, das mit bunten Sommerblumen besprenkelt war. Einige Wanderer waren schon in den frühen Morgenstunden aufgebrochen, um sich an der schönen Odenwälder Natur zu ergötzen. Hier, inmitten der wunderbaren Wildnis, konnte man die Seele baumeln lassen.
Mit einem unguten Gefühl der Anspannung kehrte Don Tiki zur Hutzwiese zurück. Er achtete nicht auf die grüne Landschaft rings um ihn herum. Heute war der erste Tag, den er wieder zu Hause verbringen würde. Die erste Nacht alleine in seinem Haus! Drei Nächte durfte er auf dem Bauernhof verbringen. Die Frau von Bauer Fehndrich – ein resolutes Weib vor dem Herrn – hatte ihm gestern klar zu verstehen gegeben, dass die Zeit gekommen war, seine Zelte auf dem Hof abzubrechen. Man betreibe schließlich einen Bauernhof und keine Pension. Man müsse sich jetzt Gedanken machen, wie es weitergehe mit den heutigen Milchpreisen. Das alte Lied der Familie Fehndrich.
Und so war der Mann im bunten Hawaiihemd frühmorgens aufgebrochen, um nach Hause zu laufen. Einen Führerschein besaß er nicht mehr – den hatte er wegen Trunkenheit am Steuer verloren. Mit 2,1 Promille war er durch die Reichelsheimer Straßen gefahren, bevor er im Vollrausch an der Mauer der Kurklinik Göttmann hängen geblieben war. Da er über 1,6 Promille im Blut hatte, wurde von der Führerscheinstelle in Erbach eine medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet. War die Trunkenheitsfahrt nicht schon peinlich genug, so musste er jetzt auch noch zum Idiotentest. Die Prüfung hatte er bislang nicht angetreten. Er würde sie auch nie antreten. Sein Alkoholkonsum hatte mittlerweile eine Ebene erreicht, wo es ihm schwerfiel, aufs Trinken zu verzichten. Es waren die ersten Anzeichen einer Sucht, die sich in sein Trinkverhalten schlichen. Er selbst redete sich ein, dass zu einem waschechten Tiki-Fan auch ein richtiger Cocktail gehört. Mit einem Mocktail wollte und konnte er sich nicht anfreunden.
Im Sommer war es ganz angenehm, bei warmem Wetter längere Strecken zurückzulegen. Der Winter dagegen war die reinste Qual. Während Don Tiki schnaufend der Landstraße folgte, schaute er auf sein Handy, doch es hatte keine Anrufe in den letzten drei Tagen gegeben. Sein Freund Mike hatte sich nicht gemeldet! Das beunruhigte den Mann im Hawaiihemd ebenso sehr wie die Tatsache, dass er heute wieder zu Hause schlafen musste. Mike meldete sich sonst immer. Er überlegte, ob er die Polizei einschalten sollte, verwarf den Gedanken aber schnell wieder. Gegen ihn lief noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er war zwar auf das Polizeirevier in Erbach vorgeladen worden, aber zu dem Termin nie erschienen. Den beiden Polizisten, die ihm anschließend einen Besuch abstatteten, hatte er nicht die Tür geöffnet und toter Mann gespielt. Schon deshalb konnte er die Polizei nicht einschalten. Doch die Sache mit Mike bereitete ihm Sorgen. Auf dem Rückweg von Klein-Gumpen war er an Mikes Wohnhaus vorbeigekommen, hatte geklingelt, doch niemand hatte ihm aufgemacht. Er war ums Haus geschlichen, hatte durch die Verandatür ins Wohnzimmer geschaut, doch alles schien verlassen zu sein. Auch der Briefkasten war nicht geleert worden; die Werbung steckte noch immer im Briefkastenschlitz. Irgendetwas war vorgefallen und es stand in Verbindung mit den seltsamen Wesen im Wald. In seinem Kopf drehten sich die Gedanken im Kreis. Sein ganzes Denken war von seiner Entdeckung im Wald und dem Verschwinden von Mike bestimmt. Er malte sich die fürchterlichsten Horrorszenarien aus: wie ihn die Wesen des Nachts aufsuchten und aus seinem Bett zogen, um ihn später in dem alten verlassenen Bunker zu foltern. Es waren wahnsinnige Gedankengänge, die ihn nur schwer zur Ruhe kommen ließen.
Don Tiki atmete tief ein und aus, als er sein kleines Fachwerkhaus in der Ferne erblickte und beschloss, sich jetzt erst einmal einen ordentlichen Cocktail zu mixen. Bei der Hitze wirkte ein Long Island Ice Tea wahre Wunder.
Einige Autos fuhren an ihm vorbei; mit großen Augen schauten die Beifahrer ihn an. Er war halt durch und durch ein Freak. Ein Reichelsheimer Original! Dieser Gedanke zauberte für einen kurzen Augenblick ein Lächeln auf seine Lippen und er schloss fast beschwingt die Tür seines Wohnhauses auf. Drinnen war es kühler als draußen. Es roch muffig, denn die Fenster waren während seiner Abwesenheit allesamt geschlossen geblieben. Hastig eilte er zum Kühlschrank, kramte mehrere Flaschen Rum heraus und machte sich an die Arbeit, den gewünschten Cocktail zu kreieren. Er ging mit den Rumflaschen sehr großzügig um, denn er mochte seine Cocktails sehr stark. Es sollte eine großzügige Mischung werden. Nachdem er die ersten Schlucke genommen hatte, schienen sich seine aufgedrehten Gedanken wieder zu beruhigen. Der Alkohol wärmte seinen Magen; in seinen Gliedern breitete sich eine angenehme Schwere aus. Rum war die beste Medizin! Mit einem Seufzen schleuderte er seine Straßenschuhe von sich und schlüpfte in seine Sandalen. Von der Fensterbank nahm er seinen Hulakranz und legte ihn sich um den Hals. Jetzt bin ich wieder ein richtiger Mann! Er schlurfte zurück in den Hof und ließ sich schwerfällig in seinen Liegestuhl fallen. Von hier aus hatte er einen hervorragenden Blick auf die Wälder hinter der Wiese. Was auch immer passieren würde, seinen Augen würde nichts entgehen. In der rechten Hand hielt er sein kitschiges Cocktailglas, das einer Tiki-Gottheit nachempfunden war, und in der linken fest umschlossen sein Smartphone. Wenn dort oben in den Wäldern irgendetwas passierte, dann würde er es mit der Kamera festhalten. Dann hatte er einen Beweis!
Passt bloß auf. Einem Mann wie Hubert Arras alias Don Tiki entgeht nichts! Ich habe euch fest im Blick, ihr gottverdammten Aliens!, dachte er grimmig.
Doch es dauerte keine fünf Minuten, da hatte der Alkohol seine Sinne so sehr betäubt, dass er tief und fest einschlief.
Die Welt ging unter. Mal wieder. Und Jakob hatte vom Balkon der Kurklinik Göttmann den besten Sitzplatz, um die Apokalypse hautnah zu verfolgen. Die Szene war erschreckend, hätte den ein oder anderen in den Wahnsinn getrieben, doch auf Jakob wirkte alles so seltsam vertraut. So, als ob er jeden Augenblick schon einmal durchlebt hätte. Und doch war es anders! Er war allein, hatte keine Freunde mehr. Man konnte sich nicht mehr gegenseitig unterstützen, sich Kraft geben und Mut zusprechen. Merkwürdigerweise störte ihn diese Einsamkeit nicht. Im Gegenteil: Er wirkte gelassener, weil er wusste, was ihn erwartete.
Vor ihm erstreckte sich der gesamte Ort wie auf einem Präsentierteller. Es war schon weit nach Mitternacht, als die tollwütigen Seemänner mit dem Seelensprinter kamen. Die meisten Häuser lagen in vollkommener Dunkelheit; nur vereinzelt brannte noch ein heimeliges Licht in den Fenstern. Der Kirchturm der evangelischen Kirche war bis vor Kurzem noch beleuchtet, doch zu solch später Stunde hatte man den Strom abgeschaltet.
Aus den Wäldern drang zunächst ein unheimlicher Singsang. Der Wind trug die Stimmen klar und deutlich an Jakobs Ohr. Er musste an die kanonischen Gesänge in der orthodoxen Kirche denken. Jedoch waren die Laute stark verzerrt, als wären sie mit einem schlechten Synthesizer bearbeitet worden. In einigen Häusern nahe der Stockwiese gingen die Lichter an und Fenster wurden geöffnet. Die Anwohner hatten also auch den Gesang vernommen. Da sich Jakobs Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er, wie einige Leute auf die Terrasse gingen oder auf dem Balkon standen, um nach dem Rechten zu sehen.
Schlagartig verstummten die Laute aus den Wäldern. Ein anderes Geräusch setzte ein, das Jakob so unendlich vertraut war und trotzdem eine Gänsehaut auf seinen Armen auslöste. Die feinen Härchen richteten sich auf. Das monotone Zischen und Dampfen eines großen Zuges – einer altertümlichen Eisenbahnlok genauer gesagt –, der in einen Bahnhof einfährt. Das Geräusch war zunächst ganz leise, schwoll aber in den nächsten Augenblicken immer stärker an, sodass man das Gefühl hatte, man würde direkt daneben stehen. In immer mehr Häusern gingen die Lichter an.
Und dann sah Jakob die zyklopisch anmutende Silhouette des Seelensprinters, wie er sich einen Weg zwischen den Baumstämmen hindurchbahnte. In gerader Linie fuhr er durch den Wald auf einem Schienensystem, das vor ein paar Wochen noch nicht dagewesen war. Gewaltige Dampfwolken breiteten sich über den Wipfeln der Bäume aus. Unzählige Vögel stiegen laut krächzend in den Nachthimmel und versuchten, sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen.
Die Waggons waren riesig, stählerne Kolosse, die teilweise das Blätterdach des Waldes überragten. Die tollwütigen Seemänner waren gekommen, um auch diese Welt zu vernichten. In den nächsten Stunden würde es verdammt hässlich werden!
»Lasst die Spiele beginnen!«, sagte Jakob und wunderte sich über seine Kaltschnäuzigkeit. Diesen Satz hatte Lehrer Tempels immer gesagt, nachdem er die Matheklausuren verteilt hatte. Doch es war nicht Lehrer Tempels, den Jakob vor seinem inneren Auge sah, sondern das grinsende Gesicht des Primus. Leonhard Hoyer, der ihn zum Sterben auf diese Welt geschickt hatte.
Jakob machte sich auf seinem Stuhl klein, damit man ihn nicht vom Balkon aus sehen konnte. Den Stuhl hatte er aus dem versifften Hallenbad im Erdgeschoss die ganzen Stockwerke hochgeschleppt. Er griff zu der Chipstüte am Boden und genehmigte sich eine Flasche Bier aus der gestohlenen Kühltasche. Er war damals von seiner alten Welt ohne einen schlappen Euro in der Tasche aufgebrochen. In jenen Tagen war Geld unwichtig gewesen. Jetzt musste er sich Lebensmittel auf andere Art und Weise beschaffen. Am Vortag war er in die umliegenden Gartenlauben eingebrochen. Jakob war erstaunt, was die Leute dort so alles bunkerten: vergammelte Lebensmittel, Rasierschaum, Seifen, unbenutzte(!) Präservative und sogar Fernseher in Originalverpackung. Bei seinem Einbruch hatte er Chips und Bier sichergestellt. Jemand wollte wohl einen großartigen Fußballabend am Wochenende verbringen, denn in der Laube war der Tisch mit kleinen Deutschlandfähnchen geschmückt. Jetzt würde dieser Fußballabend nicht mehr stattfinden!
Jakob fühlte sich nicht schuldig, als er auf dem Balkon im obersten Stock der Heilanstalt saß, die Chips verschlang und sich gelegentlich einen Schluck Bier genehmigte. Das hatte Stil. Der Weltuntergang wäre perfekt, wenn die rothaarige Kirsten Beck, seine erste große Liebe, neben ihm säße. Die erste große Liebe, die meistens nicht bestehen bleibt und trotzdem nie vergessen wird. Dann wäre das Sterben zehnmal schöner. Und so beobachtete er ganz allein, wie sich Reichelsheim langsam aber sicher in ein Flammenmeer verwandelte. Die Luft sang in schrillen Tönen. Oder klang es vielmehr wie ein Klirren oder Pfeifen? Jakob schirmte die Augen mit der Hand ab. Dann gab es ein ohrenbetäubendes Fauchen und weiße Blitze. Er glaubte, dass die Erde bebte. Schwarze Rauchwolken stiegen über zerstörten Häusern auf. Als die Sonne aufging, waren die letzten Schreie verklungen. Es würde bestimmt jede Menge Tote auf den Straßen geben.
Jakob hatte sich ins Zimmer zurückgezogen und die Balkontür verschlossen, denn die Rauchwolken ließen seine Augen brennen und machten das Atmen zu einer wahren Tortur. Auf einem dreckigen Bett ließ er sich nieder und war dankbar, dass der Alkohol ihn sofort einschlafen ließ. Er fiel in einen gestaltlosen Traum: keine Bilder aus seiner dunklen Vergangenheit, sondern ein einziges großes Chaos, welches drohte, ihn weinend in einem Mahlschlund aufzusaugen. Wenn dieser Traum irgendeine Art von Botschaft enthielt, dann blieb sie Jakob verborgen.
Die Herdentreiber erreichten die Blue-Lodge-Ranch ohne größere Zwischenfälle.
Wayne Gunter, ein mürrischer Mann mit Halbglatze und einem ausgemergelten Gesicht, das allerdings von einem Paar erstaunlich intelligenter Augen dominiert wurde, erwartete sie bereits am großen Hoftor. Gelangweilt schob er seinen Kautabak im Mund hin und her, als die Männer angeritten kamen. Die beachtliche Herde von Jeremy Slater wurde noch einmal um mehr als tausend Tiere vergrößert. Die Rinder wurden in einen abgesonderten Bereich des Valleys gebracht, der von einem hohen Weidezaun umgeben war. Gunter stammte aus Texas und dort kannte man sich bestens mit Pferden und Rindern aus. Er würde den Tieren das Brandzeichen der Blue-Lodge-Ranch verpassen. Und der Pawnee würde ihm beim Branding unter die Arme greifen.
Der Cowboy ritt auf dem Rücken seines Pintos mit gemischten Gefühlen zurück auf die Ranch. Einerseits war er dankbar, dass das Treiben ein Ende gefunden hatte, denn die Arbeit war sehr hart gewesen – er hatte die Verantwortung für fast hundert Mavericks gehabt, und es war kein Job gewesen, bei dem man eine Minute hätte unachtsam sein können. Auf der anderen Seite hatte ihn das Treiben der Rinder abgelenkt – die Dämonen der Vergangenheit waren fern geblieben. Doch jetzt, wo er wieder auf der Blue-Lodge-Ranch war, kamen sie wieder: die Gedanken an Hekate und was ihn noch alles erwarten würde. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn beobachtete. In diesem Moment. In Gestalt des riesigen weißen Wolfes mit den acht Augen. Er konnte die Augen förmlich auf sich gerichtet fühlen, die sich voller Hass in seinen Rücken bohrten. Er blickte sich in seinem Sattel um, ließ den Blick über die Bergkuppen gleiten, doch da war nichts Verdächtiges.
Im Hof der Ranch stieg er von seinem Pinto und übergab das müde Tier einem Stallburschen. Das tagelange Treiben der Rinder über staubige Prärien, das Schlafen unter freiem Himmel und die fehlenden Waschgelegenheiten hatten Spuren hinterlassen. Seine Kleidung war staubig und fleckig vom Schaum des Pferdes. Er stank am ganzen Körper nach Pferd, Kuhdung und vor allem nach Schweiß. Was er jetzt brauchte, war ein ordentliches Bad. Stella Slater würde ihr zierliches Näschen rümpfen, wenn sie ihn so anträfe.
Eine halbe Stunde später befand er sich mit den anderen Treibern in einer Art Badehaus, wie es in der damaligen Zeit in sehr guten Saloons üblich war. Da Slater sehr sozial eingestellt war, ermöglichte er seinen Männern diese Art von Komfort, um sich nach einem anstrengenden Arbeitstag auf der Weide waschen zu können.
Zufrieden sang der Cowboy ein Lied und probierte das Stück Kautabak aus, das ihm der alte Mann mit dem narbigen Piratengesicht und dem großen Lederhut zugesteckt hatte. Das Zeug schmeckte bitter und selbst als er es ausspuckte, hinterließ es einen so starken Nachgeschmack auf der Zunge, dass er Mühe hatte, sich nicht zu übergeben.
»Teufel nochmal, ich habe Cracknutten auf dem Frankfurter Straßenstrich geleckt, die haben besser geschmeckt als diese verfickte Scheiße!«, fluchte er, während die anderen Männer sich köstlich über den Cowboy amüsierten. »Wie kann man so etwas im Maul behalten? Kein Wunder, dass ihr keine Weiber habt! Keine Frau würde euch je einen Zungenkuss geben! Bäääh!!!« Er tauchte sein Gesicht unter Wasser, öffnete den Mund und versuchte auf diese Art, den bitteren Geschmack aus seinem Mund zu vertreiben.
»Als ob eine Ratte in meinem Maul verfault wäre … ekelhaft!«
»He, Satteltramp, du weißt halt nicht, was gut ist!«, meinte einer der Männer grölend.
»Ich bin kein Satteltramp, ich bin ein Maverickjäger! Merk dir das endlich!«
»Jungs, er ist einmal mit dem Boss ausgeritten und hält sich jetzt für einen Maverickjäger!« Die Männer lachten laut auf.
»Ach fickt euch!«, sagte der Cowboy und schloss die Augen. Eine wohlige Wärme umgab ihn. Obwohl das Badewasser bereits zwei Männer vor ihm gesehen hatte, fühlte er sich sauwohl in dem Bottich und wäre am liebsten eingeschlafen.
Als er wieder die Augen öffnete, sah er, wie Slater am Eingang mit einem seiner Treiber sprach. Das Gesicht des Bosses der Blue-Lodge-Ranch verfinsterte sich zunehmend. Er dankte kurz dem Mann, blickte auf seine goldene Taschenuhr und machte dann auf der Stelle kehrt. Anscheinend musste ein heißes Bad noch auf Slater warten.
Oje! Keine guten Neuigkeiten, dachte der Cowboy und ihm kam Hekate wieder in den Sinn. Verfluchtes Weib!
Er stieg aus dem Bottich, trocknete sich mit einem rauen Handtuch ab und schlüpfte in die Arbeitskleidung der Blue-Lodge-Ranch, die er sich bei Slaters Frau besorgt hatte: ein rot kariertes Hemd mit schwarzer Weste, dazu ein rotes großes Halstuch, das man beim Reiten auch über Mund und Nase ziehen konnte, um nicht zu viel Staub einzuatmen.
Nachdem er sich die schweren Stiefel mit den Sporen wieder angezogen hatte, begab er sich in seine Unterkunft, die gegenüber dem Haupthaus lag. Diesmal würde er nicht am Tisch der Slaters dinieren, denn für die Treiber gab es einen eigenen Ess- und Wohnbereich. Dort roch es wunderbar nach Kaffee, Speck und Eiern, sodass dem Cowboy das Wasser im Mund zusammenlief. Vorerst hatte er genug trockene Biskuits gegessen.
Bei Tisch waren das Monster und die getöteten Rinder in aller Munde. Der Cowboy rollte mit den Augen. Man sprach auch über Anamaqukiu. Da hatte der Pawnee den Männern einen schönen Floh ins Hirn gesetzt. Einige lächelten, machten Scherze über das Erzählte, doch es war ein reines Schutzverhalten, um sich nicht einzugestehen, dass an der Sache vielleicht doch etwas dran sein könnte. Niemand war scharf darauf, mit einem solch übernatürlichen Wesen Bekanntschaft zu machen. Und beim nächsten Ausritt könnte es jeden der Männer am Tisch treffen. Nicht einmal hier würde er seine Ruhe vor Hekate haben. Diese Schlampe verfolgt mich überallhin!
Der Cowboy schlang seine Mahlzeit herunter, war dankbar für das kalte Bier (auch wenn es kein Odenwälder Schmucker war) und begab sich dann auf die Veranda, um mit seinen Gedanken alleine zu sein. Er hatte genug von Anamaqukiu gehört.
Draußen im Hof stand Jeremy Slater, seinen großen, hageren, gut proportionierten Oberkörper gegen die Haltestange der Pferde gelehnt. Geistesabwesend schob er den Kautabak im Mund hin und her und bemerkte den Cowboy erst, als dieser dicht neben ihm stand.
»Ärger? Ich habe vorhin im Badehaus gesehen, wie Sie mit einem der Treiber gesprochen haben, Boss!«
Als Slater nicht antwortete, fragte der Cowboy: »Hekate? Ist sie uns gefolgt?«
Slater schüttelte den Kopf. »Nein, es sind die üblichen Verdächtigen. Desmond Pickett hat zwei meiner Jungs aufgeknüpft. Dieser elende Bastard!« Um seiner Verachtung für Pickett mehr Gewicht zu verleihen, spie er den Kautabak in einem braunen Strahl auf den Boden.
»Ich verstehe!« Für einen Moment fühlte sich der Cowboy erleichtert. Doch das Gefühl war nur temporär. Hekate würde wiederkommen!
»Für Stella und mich sind meine Männer mehr als nur Mitarbeiter. Wir sind eine Familie. Und wir respektieren sie.« Slaters Stimme klang plötzlich brüchig. Der Cowboy blickte ihn nur stumm an. »Viele von ihnen haben in Cheops Frau und Kinder. Männer müssen sterben, weil sie für Jeremy Slater arbeiten. So kann das nicht weitergehen!« Jeremy Slater blickte hinaus ins Blue Valley, das sich mittlerweile in eine dunkle Silhouette verwandelt hatte.
»Weißt du, wie mich die Menschen in Cheops nennen?«
»Keine Ahnung.«
»Den Witwenmacher.«
»Okay, ich verstehe … Verdammte Scheiße …«
»Dieses sinnlose Morden muss aufhören!«, sagte Slater, und sein Gesicht war plötzlich wieder hart und kantig wie ein Fels in der Brandung, der auf alle Ewigkeiten den Gezeiten trotzt.
»Sie haben genügend Männer. Wir könnten alle zusammentrommeln und diesem Pickett einen Besuch abstatten«, schlug der Cowboy nachdenklich vor.
»Es würde in einem Blutbad enden! Und das ist das Letzte, was ich will. Ich bin froh, dass der Bürgerkrieg vorbei ist. Wir brauchen kein weiteres Blutvergießen.«
»Ich könnte den Kerl für Sie umlegen!« Der Cowboy hatte es eher als Spaß gemeint, doch Slater starrte ihn ernst an.
»Wenn das so einfach wäre! Er hat einen Revolverhelden namens Willard bei sich. Er ist der Beste seines Fachs. Er schießt dir sogar eine Fliege vom Himmel. Nein, an Pickett kommen wir vorerst nicht dran!«
»Aber, wie soll es weitergehen?«
»Wenn wir die große Herde zu den Verladebahnhöfen nach Kansas gebracht haben, werde ich mich an die Regierung wenden. Wir haben dann so viel Geld, dass selbst ein fetter Politiker in Washington uns zuhören wird.«
»Ich sehe, hier ist es nicht anders als bei mir zu Hause.«
»Wenn das alles vorbei ist, komme ich dich einmal besuchen!«, versprach Slater.
Doch der Cowboy hatte so seine Bedenken, ob dies jemals geschehen würde, denn sein Universum war nicht nur aus dem Gleichgewicht geraten, sondern es existierte gar nicht mehr. Zu gerne hätte er dem Westmann gezeigt, wie sich die Menschheit mithilfe von Erfindungen und Forschung eine Welt erschaffen hatte, die den Menschen viele Annehmlichkeiten bot und in der das Leben weitaus weniger hart war und Konflikte durch Gesetze und nicht mit Waffengewalt geregelt wurden. Und in seiner Vorstellung kamen plötzlich all die Bilder seiner alten Welt hervor, es kam Wehmut in ihm auf an etwas, das er verloren hatte, das es nicht mehr gab. Trotzdem sagte er: »Jederzeit gerne, aber vorher muss ich mich noch um diesen großen Wolf kümmern!«
»Ich werde dir dabei helfen, aber erst bringen wir meine Herde nach Kansas City!«
»Einverstanden!«
Die beiden Männer standen noch eine Weile stillschweigend nebeneinander, bevor sie zurück in ihre Unterkünfte gingen, jeder seines eigenen Weges. Das Ganze hatte für den Cowboy einen symbolhaften Charakter. Was für den Herdenboss Desmond Pickett war, war für den Cowboy Hekate. Beide Männer hatten ihre eigene Nemesis, die es zu bekämpfen galt. Aber sie würden sich dabei gegenseitig unterstützen!
Don Tiki erwachte in Schweiß gebadet mit hämmerndem Puls auf, und für einen Moment musste er all seine Willenskraft aufbieten, um nicht schreiend aus seinem Liegestuhl hochzufahren. Er hatte schlecht – sehr schlecht – geträumt. Die Nachwehen des Albtraums hingen wie ein Schatten über ihm, jederzeit bereit, ihn zu verschlingen. »Es ist … alles in Ordnung!«, sagte er sich. Jedenfalls hoffte er das, ganz sicher war er sich nicht. Ein übler Geschmack lag auf seiner Zunge. Sein Cocktailglas befand sich auf dem Boden; die Pflastersteine waren mit einer klebrigen Masse überzogen.
Da war dieser Traum gewesen. Er hatte sich aus der Vogelperspektive im Hof sitzen sehen, tief und fest schlafend. Selbst das umgeworfene Cocktailglas hatte er zu seiner Rechten gesehen. Und dann war diese Kreatur erschienen. Die stämmigen Beine, die den insektenhaften Hinterleib stützten, waren über die Pflastersteine gelaufen, wobei sie bei jedem Schritt ein dumpfes Klacken erzeugten. Der Kopf hatte sich zu ihm heruntergebeugt, eine dichte Fülle von Stielen, an denen kleine Augen baumelten und aufgeregt blinzelten. Augen auf und zu. Augen auf und zu. Don Tiki beobachtete alles von oben, gefangen in einem Schwebezustand. Er konnte weder schreien noch sich bewegen. Und dann sprach die Kreatur zu ihm. Gesprochen war das falsche Wort, sie hatte mit ihm über seine Gedanken kommuniziert. Telepathie!, kam es ihm in Form einer blitzlichtartigen Erinnerung. Das war das Wort gewesen, nach dem er die ganze Zeit über gesucht hatte! Es war Telepathie gewesen!
Don Tiki zog mit einem lauten Krächzen den Schleim in seinem Hals hoch und spie auf den Boden. Doch der üble Geschmack im Mund blieb. »Es ist alles in Ordnung!«, sagte er noch einmal, um sich Mut zuzusprechen.
Unsicher stand er auf. Sein Hawaiihemd war durchtränkt von Schweiß und Cocktailsaft. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Sein Schweiß fühlte sich seltsam klebrig an wie das Sekret eines Frosches. Er versuchte, sich daran zu erinnern, was die Kreatur ihm im Traum gesagt hatte. Der Klang der verzerrten Stimme, der jegliche Menschlichkeit fehlte, war noch immer in seinem Kopf. Das Wesen hatte ihm etwas gesagt. Ob es wichtig war? Eine Drohung vielleicht? Dass er sich von dem Luftschutzbunker im Wald fernhalten solle? Er konnte sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Don Tiki blickte vom Hoftor hinaus in Richtung Wald. Die Bäume lagen in absoluter Dunkelheit. Er konnte nicht einmal erkennen, wo der Wald aufhörte und der Himmel begann.
Mit einem Ächzen schloss er das schwere Tor und verriegelte es von innen. Er wusste nicht mehr, wann er das letzte Mal die Toreinfahrt verschlossen hatte. Es musste noch zu Lebzeiten seiner Eltern gewesen sein. Das Haus der Familie Arras hatte jedem Besucher offen gestanden. Man konnte kommen und gehen, wann man wollte.
Don Tiki hastete zurück ins Haus und verriegelte auch dort die Haustür. Nur zögerlich wich die Angst zurück. Wahrscheinlich würde er auch die Schlafzimmertür verschließen. Er musste nur überlegen, wo er den Schlüssel hingetan hatte. Verflucht!
Im Wohnhaus war es dunkel, und die Möbelstücke schienen alle möglichen Formen anzunehmen, wenn man sie nur lange genug anstarrte. Das einzige Geräusch im Haus war das monotone Ticken der Standuhr.
Der Mann im Hawaiihemd eilte ins Schlafzimmer und schloss hastig die Tür. Erleichtert atmete er auf, als er in der Schublade seiner Kommode den Schlüssel für die Tür fand. Einen Moment später war auch die Schlafzimmertür abgeschlossen. Aufatmend drehte er sich um und schlurfte zu seinem Bett. Beim Vorbeigehen am Bettpfosten starrte er unbewusst aus dem Fenster. Sein Herz wäre fast stehen geblieben. Von dem Schlafzimmerfenster konnte man direkt auf die angrenzenden Wälder blicken. Die Bäume waren in ein fluoreszierendes Licht getaucht. Dieses Leuchten tauchte den Wald in ein unwirkliches Licht, ließ die alten Bäume fast wie verkrüppelte Lebewesen erscheinen.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, krächzte Don Tiki. Schlagartig erlosch das Licht, um wenige Herzschläge später wieder aufzuflackern. Es war ein unheimliches Lichterspiel, das sich da in den Wäldern zeigte. Don Tikis Hand wanderte ganz langsam zum Rollladen. Seine Hände verkrampften sich um den Aufroller. Er atmete mehrere Male tief ein, dann zog er an dem Gurt und ließ den Rollladen krachend herunterfahren. Jetzt war es stockdunkel im Raum. Verängstigt sank Don Tiki auf den Boden. Der Mann im Hawaiihemd sollte in dieser Nacht keinen Schlaf mehr finden.
Jakob Großmüller wanderte ziellos durch die verlassenen Gänge der Heilanstalt. Die Räumlichkeiten waren total heruntergekommen. Jugendliche waren in die Kurklinik eingebrochen, hatten obszöne Graffitis an die Wände geschmiert und Möbel zerstört. Wie es früher einmal hier ausgesehen haben musste, konnte man nur noch mit großer Fantasie erahnen. Das Gebäude war ein verfallenes Überbleibsel aus einer anderen Zeit.
Ratten huschten vor ihm über den Gang – kleine pelzige Wesen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Kurklinik zu übernehmen und in ihr eigenes Reich zu verwandeln. Jakob stieg eine Treppe nach oben in den zweiten Stock. Ein buntes Mosaikfenster war in die Wand eingelassen. Es war kunstvoll gefertigt und zur damaligen Zeit sicher sehr teuer gewesen. Der Künstler (oder die Künstlerin?) hatte sich mit seinem (ihrem) Namen in der unteren Ecke mit schnörkeliger Schrift verewigt: Küfer, Klein-Gumpen. Der Name sagte Jakob etwas, aber er konnte ihn nicht wirklich jemand Bestimmtem im Ort zuordnen.
Über die Treppe kam er in einen breiten Gang, der vollgeschmiert war mit Fäkalien. Dunkle Flecken an den Raufasertapeten ließen keinen Zweifel daran, dass der ein oder andere Eindringling die Wände zum Urinieren benutzt hatte. Obwohl die Flecken alt waren, bildete sich Jakob ein, diese Hinterlassenschaften förmlich riechen zu können. Der Flur mündete in einem großen Raum, der früher einmal als Freizeitraum benutzt wurde. An der Stirnseite befand sich ein eingeschlagenes Aquarium. Ein Großteil des Aquarienkieses war ausgelaufen und hatte sich auf dem Boden ausgebreitet. Die Pflanzen waren vertrocknet und falls man sie berührte, würden sie wahrscheinlich zu Staub zerbröseln. Dichte Spinnweben bedeckten den hinteren Teil des Beckens, und Jakob glaubte, dass er etwas Dunkles, Großes mit vielen Beinen hinter einer Wurzel verschwinden gesehen hatte, als er sich dem zerstörten Becken näherte.
Sofas in hässlichen Grüntönen, die früher einmal sicher hochmodern waren, standen kreuz und quer im Raum herum. Einige waren umgestoßen, bei anderen quoll die Füllung aus dem aufgeritzten Stoff. Hinter einem der Sofas befand sich ein Tischkicker, der nur noch drei Beine hatte. Über allem lag eine zentimeterdicke Staubschicht. So ähnlich musste sich ein Archäologe fühlen, wenn er ein Pharaonengrab betrat, dachte Jakob, während er den Raum inspizierte.
Auf einem der Sofas lag ein Tischtennisschläger mit abgenutztem Noppenbelag; die dazugehörige Platte zum Spielen fehlte komplett. Jakob nahm den Schläger in die Hand. Sein Blick wanderte über den Boden und die Sofas, doch er konnte keinen weißen Ball entdecken. Schade! Enttäuscht warf er den Schläger zurück aufs Sofa. Kleine Staubwolken wirbelten auf und stiegen träge nach oben. Die Staubpartikel glitzerten im Sonnenlicht, das durch die Fenster drang.
Jakob versuchte sich vorzustellen, wie es hier einmal gewesen sein musste. In den Sechzigerjahren: Die Leute hatten sich wahrscheinlich nach dem Abendessen hier getroffen, um noch ein wenig zu lesen, Karten oder Tischkicker zu spielen oder sich einfach nur mit den anderen Kurgästen zu unterhalten. In einem klobigen Fernseher waren Filme in Schwarz-Weiß gelaufen. Es war eine andere Zeit gewesen. Jetzt brauchte man viel Fantasie, um sich diesen Ort mit Leben vorzustellen.
Er war gerade dabei, ein altes Magazin durchzublättern, als unten im Keller klirrend eine Glasscheibe zerbrach. Aufgeregt fuhr er in die Höhe. Holz splitterte, irgendetwas Großes wurde aus der Wand gerissen. Sofort rannte er zur Treppe und lauschte angespannt. Sein Herz klopfte bis zum Anschlag. Zunächst war nur Stille. Nichts rührte sich. Doch dann stapfte etwas Schweres über den Boden, Glas knirschte. Ein mechanisches Schnaufen ähnlich dem eines Beatmungsgerätes setzte ein. Die Luft wurde krampfhaft aufgesogen und über ein Ventil zischend wieder abgelassen. Etwas unsagbar Böses strömte wie eine scheußliche Ausdünstung von nahezu stofflicher Beschaffenheit die Treppenstufen empor.
»Fuck!«, hauchte Jakob. Die nackte Angst legte sich wie eine Würgeschlange um seine Eingeweide. Einer der tollwütigen Seemänner war in die Kurklinik eingedrungen. Das war neu! Damals hatten die Kreaturen keinen Schritt in das Sanatorium gemacht. Ein polterndes Geräusch drang an sein Ohr. Der tollwütige Seemann stieß irgendein Hindernis – vermutlich einen umgefallener Schrank – aus dem Weg und bahnte sich seinen Weg zur Treppe.
Verzweifelt suchte Jakob nach einem Ausweg. Zurück konnte er nicht, denn dann würde er direkt in die Arme des Unwesens laufen. Der einzige Fluchtweg war ein weiterer Gang, der sich neben dem Aquarium befand. Jakob hatte keine Ahnung, wohin dieser Weg führte. Das gesamte Gebäude war ein verschachtelter und verwinkelter Komplex, ein irrwitziges Labyrinth auf mehreren Ebenen. Der Junge hoffte inständig, dass der Flur ihn nicht in eine Sackgasse führen würde. Denn dann wäre er dem tollwütigen Seemann ausgeliefert. Und es gab niemanden, der ihn davor schützen könnte.
Die mit Graffiti beschmierten Wände flogen an ihm vorbei. Jemand hatte einen Stapel Bücher in einem heillosen Durcheinander auf dem Boden verteilt. Jakob stolperte über ein altes Telefonbuch und wäre um ein Haar mit dem Kopf an eine Glastür geknallt. Im letzten Moment fing er sich wieder, öffnete die Tür und rannte weiter. Am Ende des Gangs befand sich eine Treppe, die nach unten führte. Die Stufen waren mit Schutt und Geröll übersät. Jakob biss sich auf die Zunge, als er die Stufen hinuntereilte. Das Knirschen seiner Schuhe war laut zu hören.
Die Treppe führte nicht ins Erdgeschoss, sondern in die Kellerräume der Kurklinik. Auf dem Boden lagen nebeneinander aufgereiht mehrere Heizkörper. Jakob lief vorsichtig durch den Raum, weil er Angst hatte, eine der alten Heizungen umzustoßen, was einen Dominoeffekt nach sich gezogen hätte. Eine braun gestrichene Kellertür führte weiter in die Tiefen der Kurklinik. Erleichtert atmete er auf, als er feststellte, dass die Tür nicht verschlossen war, und glitt in den nächsten Raum, der in ewiger Dunkelheit lag. Über ihm erklangen die polternden Schritte des tollwütigen Seemanns. Das Monster war direkt über ihm!
Jakob tastete sich Schritt für Schritt nach vorne. Der Raum war zugemüllt mit allen möglichen Sachen, die sich in der Dunkelheit nur erahnen ließen. Einen Schritt vor den anderen setzend – was gar nicht so einfach war. Ganz langsam materialisierten sich am anderen Ende des Raums aus der Schwärze die Umrisse einer Tür, denn durch die Ritzen und Öffnungen flutete ganz schwach Licht. Jakob tastete nach dem Griff und drückte ihn langsam nach unten.
Der angrenzende Raum war komplett weiß gefliest. An vielen Stellen waren die Fliesen schon abgeplatzt oder mutwillig zerstört. Unterhalb der Decke waren Kellerfenster aus Milchglas eingelassen, die lichtdurchlässig waren. Eine Treppe mit einem rostigen Geländer führte nach oben. Jakob hatte eine ungefähre Ahnung davon, wo er sich gerade befand, denn dieser Raum kam ihm vertraut vor. Hier war er mit Schnute, Roland oder Mehlsack schon einmal gewesen. Wenn er sich nicht täuschte, führte die Treppe über einen Nebeneingang in das alte Hallenbad des Sanatoriums. Und tatsächlich war es so. Ein lang gezogener Flur führte zum einstigen Schwimmbad.
Wenige Augenblicke später stand er vor dem gekachelten Schwimmbecken, das sich wie ein gähnendes Loch in der Mitte der Halle erstreckte. Irgendjemand hatte Stühle, einen Schreibtisch und einen Berg von Aktenordnern in das Becken geworfen. An manchen Stellen hatten sich kleine Pfützen gebildet. Aus dem Augenwinkel sah er mehrere pelzige Schatten über den Boden huschen und in der Müllhalde verschwinden. Der Raum lag in einem Dämmerlicht. Es gab zwar zwei große Fenster, aber die Bäume im Freien standen so dicht nebeneinander, dass sie nur wenig Licht in die Halle ließen.
Das schwerfällige Quietschen der Treppe machte ihn darauf aufmerksam, dass der tollwütige Seemann ihm dicht auf den Fersen war. Er spürte, wie die Angst versuchte ihn zu lähmen. Er hatte das Gefühl, als würden seine Füße Wurzeln schlagen und ihn unweigerlich an den Boden binden. Das Zischen aus dem Helm des Seemanns war nun deutlich zu hören. Jakob erwachte aus seiner Schockstarre und rannte los. Hinter dem Schwimmbecken lagen die Umkleidekabinen und dahinter der eigentliche Eingangsbereich. Er rannte an den stählernen Schränken vorbei, die wie stumme Wächter links und rechts aufgereiht waren.
Seine Kehle schien sich zuzuschnüren, als er den Eingangsbereich erreichte. Ein unüberwindbarer Berg aus Schutt und Geröll erhob sich vor der gläsernen Front des Eingangsportals. Teile der Decke waren eingestürzt. Kabelstränge hingen wie die Eingeweide eines toten Tieres von der Decke.
»Oh verdammt!«, fluchte Jakob und musste bitter erkennen, dass er wie ein Tier gefangen war. Die eingestürzte Decke mit dem Schuttberg war neu. Zu seiner Zeit hatte man das Schwimmbad durch die Eingangspforte betreten können. Wieso muss hier alles anders sein! Ich hasse dich, Leonhard!, dachte er und war drauf und dran aufzugeben.
Der Mann mit dem weißen Gewand hatte viele Namen. Über die Jahrtausende hatte er unzählige Identitäten angenommen. Als direkter Abkömmling des Uranos und der Gaia war ihm das ewige Leben zuteilgeworden. Er hatte viele Leben gelebt. Manche Leben waren bedeutungslos und nicht mehr als eine diffuse Momentaufnahme in den hintersten Winkeln seines Gedächtnisses. Doch dann gab es Leben, die so schicksalsträchtig und bedeutungsvoll waren, dass er sie nie vergessen würde. Sie waren fest verwurzelt mit seinem eigenen Ich. Egal, welche Identität er annähme: Diese Leben würde er nicht vergessen. Die Erinnerungen würden nie verblassen. Im Angesicht der Ewigkeit kam dies einem unerbittlichen Fluch gleich. Es sei denn, man konnte die Ewigkeit austricksen …
Der Mann, der sich früher Leonhard Hoyer genannt hatte und über die Jahre hinweg als der Primus aufgetreten war, blickte über die Brüstung seines Palastes. Sein wirklicher Name war Epimetheus, doch dieser weckte keine guten Erinnerungen in ihm.
Der Himmel war wolkenklar. Die Sonne hing als goldene Scheibe über dem Meer und war am heutigen Tag von einer angenehmen Wärme. Warm, aber nicht heiß.
Sein langes pechschwarzes Haar hatte er zu einem Zopf zusammengebunden, das seine asketischen Gesichtszüge noch stärker betonte. Die blauen Augen waren von solch leuchtender Intensität, dass man den Eindruck haben konnte, man blicke in die Abgründe der Seele.
Unten am Strand wiegten sich die Palmen anmutig im Wind. Durch die Nähe zur Küste wehte hier oben immer ein angenehmer Wind, der den Geruch des Meeres mit sich trug. Wenn man sich mit der Zunge über die Lippen fuhr, konnte man das Salz schmecken.
»Das Frühstück ist angerichtet, werter Herr!«, erklang eine vertraute Stimme. Epimetheus drehte sich um und gewahrte einen buckligen Kauz, der die Toga eines Bediensteten trug. Der Alte hielt zu seinem Herrn einen respektvollen Abstand. Seine schlohweißen Haare zeugten von einem langen Leben, ebenso die zahlreichen Altersflecken, die sein Gesicht bedeckten. Die gekrümmte, ausgemergelte Gestalt ließ ihn dem Tod näher als dem Leben stehen. Epimetheus überlegte, ob es nicht an der Zeit war, seinen Diener Stratos gehen zu lassen. Über die Jahrtausende war Stratos ein treuer Diener gewesen. Er hatte unzählige Male das Leben dieses Mannes verlängert. Doch Stratos war ein Mensch. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo der menschliche Körper sich nicht mehr austricksen ließ. Epimetheus nahm den süßlichen Geruch des Zerfalls wahr, den sein Diener ausströmte. Während seiner Gefangenschaft war es ihm nicht möglich gewesen, die zelluläre Struktur des Greises aufzufrischen. Er würde um Stratos trauern – nicht so, wie er um Pandora getrauert hatte (oder noch trauerte), denn Stratos war nur ein Mensch, aber es würde ihn trotzdem berühren.
»Hast du etwas bezüglich der Causa Donald Eldritch herausfinden können?«
Der Greis schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, nein. Meine Häscher vermuten ihn auf der Insel Rhodos, aber es sind nur Gerüchte, denen wir nachjagen. Dieser Mann ist in der Tat ein Geist!«
»Verdopple … nein, verdreifache deine Anstrengungen! Ich will diesen Mann haben! Koste es, was es wolle!«
»Jawohl, mein Herr!« Der Alte deutete eine Verneigung an, wobei seine Knochen hörbar knackten.
»Und noch etwas Stratos …«
»Ja?«
»Es ist schön, dich wieder bei mir zu haben!«, sagte Epimetheus.
»Es ist mir eine Ehre, Euch wieder dienen zu können. Die Zeit im Olymp war ohne Euch sehr … freudlos.«
»Ich komme gleich frühstücken!« Epimetheus wandte sich ab und blickte wieder von den Zinnen hinab. Er hatte dieses Taschenuniversum nach seinen Vorstellungen geschaffen. Ein unberührter Fleck Natur, der die Seele in Schwingung versetzte. In menschlichen Dimensionen gedacht, ein wahres Paradies. Und doch fehlte ihm Pandora zum absoluten Glück. Das Paradies ist nichts, wenn die wahre Liebe fehlt! Sie war sein Seelenpartner gewesen. Er lächelte grimmig, als er daran dachte, wie er den Olymp zerstört hatte. Es hatte einer Black Box bedurft, um den Olymp in Flammen zu stecken. Die tollwütigen Seemänner hatten alles Leben ausgelöscht. Seine Brüder und Schwester waren geflüchtet – nicht einmal sie konnten die Boten der Zerstörung aufhalten. Wahrscheinlich waren sie in ihre eigenen Taschenuniversen geflüchtet. Er würde sie aufspüren! Jetzt nicht, aber irgendwann. Er hatte gehofft, dass ihn seine Rache vergessen lassen würde. Doch dem war nicht so. Jetzt, wo der Hass weg war, blieb die Trauer zurück und erinnerte ihn stärker denn je an seinen Verlust.
Er trat von den Zinnen und betrat seine Räumlichkeiten durch die breit geschwungenen Flügel der Balkontür. Er hätte sich auch teleportieren können, doch er genoss das Laufen durch die Gänge des Palastes. Damals, als Pandora noch lebte, hatten sie darüber gesprochen, sich in ein solches Anwesen – weit weg vom Olymp – zurückzuziehen und eine Familie zu gründen. Sie hatte sich so sehr eine Tochter gewünscht: Pyrrha sollte der Name des Kindes sein. Doch mit dem Ende des goldenen Zeitalters war ihnen alles genommen worden. Pandora hatte ihm Visionen von diesem Ort gezeigt. Der Palast sollte einmal genauso aussehen. Ihrem Andenken zuliebe hatte er das Bauwerk nach ihren Wünschen geschaffen. Pandora und das ungeborene Leben in ihrem Schoß hätten es geliebt.
Die Tafel war beladen mit Köstlichkeiten aus aller Herren Länder: Es gab Honigkuchen, verschiedene Joghurtsorten mit Haferflocken, warmes Brot, herzhaften Schinken bis hin zu feiner Mortadella, Pfannkuchen mit Sirup … Es war eine Reminiszenz an seine Zeit in der Zwischenwelt. Mithilfe seiner Gedanken konnte er jegliche Speise vor sich manifestieren lassen. Es gab in den Küchen des Palastes einen Raum, der immer voller Lebensmittel war. Egal, was man benötigte, in der Vorratskammer war es stets vorhanden. Stratos hatte ein Festmahl aufgetischt.
Gedankenversunken nahm er am Kopf der Tafel Platz und begann, an einem Stück Honigkuchen zu knabbern. Er verspürte keinen Hunger an diesem Tag.
Epimetheus dachte an den Mann namens Donald Eldritch. Egal, in welcher Welt er sich versteckte, er würde ihn finden. Doch die Suche war bislang im wahrsten Sinne des Wortes im Sand verlaufen. Der Mann blieb ein Phantom. Er hatte Männer ausgeschickt, um ihn zu finden, doch niemand hatte den Aufenthaltsort von Eldritch in Erfahrung bringen können. Ein einziger Mann – war so schwer zu finden. Die berühmtberüchtigte Nadel im Heuhaufen.
In diesem Moment trat Stratos noch einmal an die Tafel seines Herrn. Furchen standen auf seiner Stirn. »Ich störe Euch nur ungern, aber wir haben Kunde, dass die Welt, auf die Ihr den Jungen geschickt habt, instabil geworden ist«, berichtete er mit gefurchter Stirn.
»Ich habe es fast befürchtet, Stratos.«
»Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die tollwütigen Seemänner alles vernichten werden.«
»Du sorgst dich um das Leben des Jungen? Jakob Großmüller?«, fragte Epimetheus irritiert. »Er ist ein Mensch! Ein Werkzeug! Er hat seinen Zweck erfüllt.«
»Ein Werkzeug, das Ihr vielleicht noch gebrauchen könnt …«, sagte der Alte und verschränkte seine Arme hinter dem Rücken.
»Inwiefern?«
»Bedenkt eins: Wie viele Leute habt Ihr in der Zeit Eurer Gefangenschaft in die Stadt der Nacht geschickt? Tausende? Hunderttausende? Sie sind alle gescheitert! Niemand hat die Steuerkarte bergen können.«
Epimetheus schwieg nachdenklich. Er wusste, worauf sein Diener hinauswollte.
»Dieser Junge hat Euch die Karte beschafft. Er ist als Einziger aus der dunklen Stadt zurückgekommen.«
»Du findest, ich sollte ihn retten?«
»Ihr solltet ihn als Werkzeug einsetzen.«
»Was geht dir durch den Kopf, Stratos?«, wollte Epimetheus wissen und legte Gabel und Messer zur Seite.
»Ich bin alt, Herr. Ihr wisst besser als ich, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Der Tod lässt sich nicht mehr lange austricksen!«
»Mach dir um Thanatos keine Sorgen, Stratos.«
»Meine Zeit ist gekommen. Ich habe länger gelebt als alle anderen Menschen. Es war ein gesegnetes Leben. Ich bin stolz, Euch über die Jahrtausende hinweg gedient zu haben. Doch es ist an der Zeit, meine letzte große Reise anzutreten. Nehmt den Jungen in Eure Dienste und bildet ihn aus.«
»Der Junge soll dein Nachfolger werden?«
Der Greis nickte. »Wenn Ihr den Jungen retten wollt, dann müsst Ihr Euch beeilen. Die tollwütigen Seemänner sind bereits eingetroffen.«
Epimetheus blickte Stratos an und sein Gesicht war für einen kurzen Moment voller Trauer. Dann schnipste er mit dem Finger. Sein Körper flimmerte kurz und war im nächsten Augenblick spurlos verschwunden. Stratos ging zu dem leeren Platz und begann, die Tafel abzudecken. Es würde dauern, bis sein Herr zurückkäme.