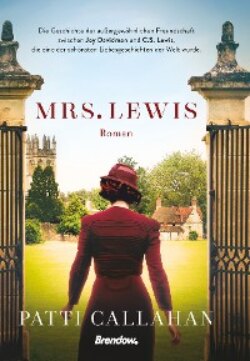Читать книгу Mrs. Lewis - Patti Callahan - Страница 16
5
ОглавлениеLove will go crazy if the moon is bright
„Sonnet III“, Joy Davidman
Ich döste wie in einem nebeligen Wald vor mich hin, als das Gelächter von Davy, Douglas und den Walsh-Mädchen durchs offene Fenster hereindrang. Sie hatten mich aus einem Traum geweckt – wovon hatte ich geträumt?
Sanft wie Kaschmir fiel der Morgen durch das Fenster herein. Ich drehte mich um und schaute zu dem anderen Bett im Gästezimmer hinüber – Bill war offenbar schon aufgestanden. Ich kuschelte mich noch einmal ins Kissen. Weit entfernt hörte ich das Grummeln der vertrauten Gewitterwolken.
Das Gelächter der Kinder schlug in lautes Gebrüll um. Ihre geschwisterlichen Kabbeleien erinnerten mich an meinen halb vergessenen Traum – er handelte von Howie und unseren mitternächtlichen Ausflügen in den Zoo. Ich vermisste die Nähe, die wir als Kinder zueinander gehabt hatten; er fehlte mir so sehr, dass ich es wie einen Schmerz unter meinem Herzen spürte. Ich schloss die Augen und gab mich für einen Moment der Erinnerung an die Zeit hin, als er mich noch geliebt hatte – ein besonderes Gefühl, das im Moment schwer zu fassen war.
Ich öffnete meine Augen für die Morgensonne, die Stimmen der Kinder und den neuen Tag. Für meine Jungen wollte ich eine andere Art Mutter sein, als meine Eltern es für mich gewesen waren. Gelang mir das?
Während dieser langen, trägen Sommertage hatte ich mich zu der Entscheidung durchgerungen, dass es meine oberste Priorität war, mich um meine Söhne, meinen Mann, meinen Garten, mein Haus zu kümmern – alles Gaben, die mir geschenkt worden waren. Ich wollte meine Ehe gesunden lassen, zurückfinden zu dem frühen Glück unserer ersten gemeinsamen Tage. Ich wollte Ruhe finden in der Sanftheit miteinander, die wir in kleinen Momenten fanden: wenn wir zusammen schrieben, mit unseren Söhnen spielten, uns liebten. Dazu würde es tief greifende Vergebung und Gnade brauchen, aber das waren meine Ziele, und wenn ich sie erreichte, würden sich vielleicht auch Freude und Friede einstellen. Hoffen wir das Beste, dachte ich.
Mein baumwollenes Nachthemd verhedderte sich in den Betttüchern, als ich aufstand. Lachend streifte ich das Nachthemd über den Kopf hinweg ab und schlüpfte in ein paar Shorts und ein abgetragenes rotes T-Shirt, das noch aus Bills College-Tagen stammte. Dann zog ich den rot karierten Vorhang zur Seite und rief aus dem Fenster: „Guten Morgen, ihr Süßen da draußen.“
„Mami!“ Douglas winkte mir von der Schaukel aus zu, die am untersten knorrigen Ast einer alten Eiche hing. „Mrs. Walsh macht Pfannkuchen zum Frühstück. Beeil dich!“
Jack:
Aber was ist denn da bei uns in ,The Kilns‘ angekommen? Sie haben Warnie und mir einen Schinken geschickt! Vielen herzlichen Dank. Sie können sich nicht vorstellen, was das bedeutet in dieser Zeit, in der Lebensmittel rationiert sind. Uns fehlt es nicht am Essen, aber wir sind die eintönige Auswahl ziemlich leid.
Joy:
Sehr gern geschehen. Ich konnte es kaum ertragen, zu wissen, dass es bei Ihnen Tag für Tag immer wieder dasselbe zu essen gibt. Hier in meinem Sommergarten sprießt und gedeiht alles! Ich habe Marmelade gekocht, die Bohnen eingemacht und mit den Äpfeln und Birnen aus meinem Obstgarten habe ich Pasteten gebacken.
Dort in Vermont tollten die Kinder durch den Wald, sie waren so wild wie die Blumen dort. Ich unternahm mit allen sechs Kindern lange Spaziergänge durch die Wälder, wo wir Pilze suchten und ich ihnen beibrachte, wie all die Dinge, die dort wild wuchsen, hießen und schmeckten. Die Jungen machten sich über die Mädchen lustig, weil sie zu ängstlich waren, um die Sachen zu essen, die ich von dem weichen Waldboden aufhob und ihnen zum Probieren entgegenstreckte. Ich wusste, dass sie mich für ein bisschen verrückt hielten, aber das war mir egal.
Unsere sommerlichen Stunden mit den Walshs waren redselig und anregend. Wir wanderten und unterhielten uns über Philosophie. Wir spielten Kartenspiele und Scrabble. Wir diskutierten über Bills Gedanken über den Buddhismus, und wir gestanden beide ein, dass wir schon Artikel und Bücher hatten schreiben müssen, zu denen wir nicht unbedingt Lust hatten, um finanziell über die Runden zu kommen. Wir redeten über die Atombombe und darüber, wie sie wohl unsere Welt verändern würde.
Zuweilen empfand ich während dieser lebhaften und intensiven Debatten dieselbe Freiheit und intellektuelle Stimulation, die ich während meiner vier Sommer in der MacDowell-Kolonie erlebt hatte. In dieser Künstler- und Schriftstellergemeinschaft in New Hampshire mitten in einem unberührten Waldgelände hatte die Kombination aus Ruhe zum Schreiben und dem geselligen Umgang mit Kollegen den kreativen Unterbau für meine besten Arbeiten geliefert. Das war noch zu der Zeit, als das Schreiben das Einzige war, was ich tat, wovon ich redete und woran ich dachte.
Jack:
Tut mir leid, dass Sie Mühe mit Ihrer neuen Arbeit über die Zehn Gebote haben. Aber denken Sie daran, Joy, dass etwas, was Sie nicht im Innersten angeht, auch Ihre Leser nicht interessieren wird.
Joy:
Oh, Jack, es betrifft mich durchaus im Innersten. Ich finde es nur schwieriger, über Theologie zu schreiben, als ich es vorausgesehen hatte. Vielleicht war ich noch nicht bereit dafür. Aber manchmal müssen wir einfach Dinge tun, für die wir noch nicht ganz bereit sind.
Es regnete unaufhörlich, aber ich wusste, dass unsere Freunde in New York unter der Hitze stöhnten, während ich den Morgennebel und die dampfende Umgebung genießen konnte. Der Boden war so durchnässt, dass das Unkraut beinahe über Nacht emporspross, und dennoch schienen die Tomaten niemals reif zu werden. Gewitterwolken sammelten sich wie Armeen am Horizont, und die Stürme waren bedrohlich und voll magischer Kraft zugleich.
In der Stadt hatte ich gehört, wie Leute der Atombombe die Schuld an den Wolken und den Gewittern gaben. „Das Ende der Welt“, murmelten sie. Ich schrieb an Jack und erzählte ihm, er könne aus dem, was die Amerikaner so über die letzten Tage redeten, sicher eine gute Geschichte stricken.
Eines mondlosen Abends, der Strom war erneut durch ein Gewitter ausgefallen, unterhielten Bill, Chad, Eva und ich uns wieder einmal übers Schreiben und Publizieren. Eva sagte: „Oh Joy, erzähl uns doch mal, wie Weeping Bay läuft.“
Ich zuckte zusammen, und doch wusste ich, dass sie nur aus liebevollem Interesse fragte. „In Weeping Bay werden alle möglichen falschen Götter bloßgestellt, aber das spielt keine Rolle, denn es ist nicht besonders gut gelaufen.“ Ich trank bedächtig einen Schluck Wein. „In der Vertriebsabteilung gibt es einen sehr eifrigen katholischen Jungen, der mein Buch anstößig fand und es begrub. Man kann es inzwischen kaum noch finden. Wie das ist, wenn man mit seinem Herzblut einen Roman schreibt, der dann gerade wegen seiner Stärken verworfen wird, kann ich dir unmöglich beschreiben.“
„Und was ist mit seinen Schwächen?“, fragte Bill in seinem Südstaatenakzent, den er nach Belieben an- und abschalten konnte. Er hatte recht, der Roman hatte sich nicht gut verkauft, und die Kritiken waren ziemlich schlecht gewesen. „Beeinträchtigt durch Obszönitäten und Blasphemie“, zitierte er aus der verheerendsten Rezension von allen.
„Bill!“, fuhr Eva laut dazwischen. „Es ist doch sicher auch so schlimm genug für sie.“
Ich klatschte mit der Hand auf meinen Oberschenkel. „Bill, warum ziehst du so über meine Arbeit her?“
„Ach, ist das jetzt der Moment, wo du mich daran erinnerst, dass du zwei College-Abschlüsse hast und ich keinen?“
„Das habe ich noch nie getan, Bill. Du bist es, der immer damit kommt.“ Ich sah Chad und Eva an. „Aber was das Buch betrifft, hat er recht“, räumte ich ein. „Manche Besprechungen waren wunderbar, aber andere waren der Auffassung, die Unzulänglichkeiten einer der Hauptfiguren hätten die Geschichte hoffnungslos zerstört. Damit haben sie nicht unrecht, aber ich habe die Geschichte so geschrieben, wie ich es wollte. So, wie ich sie schreiben musste.“ Ich deutete auf Bill. „Und auf eine meiner Lieblingsfiguren, den Whisky trinkenden Prediger, hast du mich gebracht, also sei ein bisschen nett zu mir.“ Ich versuchte ihn anzulächeln. Wie sehr wünschte ich mir, dass wir nett miteinander umgingen.
In diesem Moment rief Damaris, die älteste Tochter der Walshs, aus einem der Kinderzimmer: „Ihr seid so laut da draußen!“
Wir mussten alle lachen, und Eva stand auf, um sie wieder zu Bett zu bringen. Als sie ging, warf sie mir einen Blick voller Herzensgüte zu. „Du hast jahrelang an diesem Roman gearbeitet, Joy. Ich kann mir vorstellen, wie weh es tun muss, so viel Negatives zu hören.“
„Ja. Angefangen habe ich damit vor vielen Jahren in MacDowell. Noch vor den Kindern. Vor Bill und unserer Heirat, und bevor ich je einen Artikel nur um des Geldes willen schrieb. Damals, als noch die Magie, Sätze aneinanderzureihen und eine Geschichte zu erschaffen, die meine Seele beflügelte, mich zum Schreiben trieb.“ Ich lehnte mich in meinem Sessel zurück und spürte, wie Melancholie mich überfiel.
„Fiktionale Prosa muss so viel transportieren“, sagte Chad. „Ich weiß überhaupt nicht, wie ihr das macht.“
„Jack und ich haben darüber geschrieben.“
Kerzenlicht flackerte über Chads Gesicht und spiegelte sich in seinen Brillengläsern. Er sah aus wie ein Gelehrter, genauso wie man sich einen Professor vorstellen würde, doch jederzeit konnte sein unbekümmertes Lächeln die ernsthafte Fassade durchbrechen.
Ich beugte mich vor. „Und darüber, dass die Evangelien keine fiktionale Prosa sind. Weißt du, fiktionale Prosa läuft immer gradlinig, kongruent, wenn du so willst. Aber das Leben ist anders. Daran erkennen wir, dass die Evangelien real sind; sie lesen sich nicht wie fiktionale Prosa.“
„Genau das habe ich Lewis auch sagen hören“, sagte Chad.
„Joy“, warf Bill leise ein. „Wie meinst du das? Ich dachte, wir reden über deine Arbeit.“
„Ich rede ja auch über meine Arbeit, und darüber, was fiktionale Prosa bewirken kann.“
Chad nickte so eifrig, dass ihm die Brille von der Nase rutschte.
Bill drückte seine Zigarette auf der Kruste seiner Pastete aus. Mit einem leisen Zischen schmolz die Asche auf dem Dessert, das ich am Morgen aus frisch gepflückten Äpfeln zubereitet hatte.
„Ich glaube, ich mache Schluss für heute Abend.“ Er stand auf und ging. Chad und ich blieben am Tisch zurück, wo sich zwischen uns der Gestank der ausgedrückten Zigarette festsetzte.
Jack:
Warnie und ich planen für den Sommer unsere jährliche einmonatige Pilgerreise nach Irland. Wir lieben zwar The Kilns, aber jeden Sommer sehnen wir uns nach dem Land unserer Kindheit. Dort besuche ich meinen besten Freund Arthur Greeves, mit dem ich seit der Kindheit verbunden bin. Zurück ins Land der wogenden grünen Hügel und der Bergketten am Horizont, die mich an viele der glücklichsten Tage meines Lebens erinnern.
Joy:
Irland. Ach, wie gern würde ich dieses Land einmal sehen, und ebenso natürlich Oxford! Es scheint, als haben diese Gegenden auch die Landschaft Ihres Herzens geprägt. Für mich war das stets New York, mit Ausnahme eines Jahres als Drehbuchautorin in Hollywood, das meine Seele zermürbt hat. Ihre Beschreibungen sind so lebendig, dass ich The Kilns fast sehen kann, wenn ich die Augen schließe. Wäre es Ihnen wohl möglich, mir ein Foto aus Irland zu schicken? Ihre Joy
„Du hast Jack ja ziemlich ins Herz geschlossen“, deutete Chad vorsichtig an.
Ich antwortete nicht gleich, sondern wägte meine Worte behutsam ab, um nicht der Wirkung des Weins zu erliegen, die mich durchfloss. Chad kannte Jack auf eine Weise, wie ich ihn nie kennen würde – er hatte sechs Wochen bei ihm zu Hause in Oxford verbracht. Er kannte seinen Tagesablauf. Er hatte Jack gesehen, wenn er morgens aufwachte, wenn er arbeitete und wenn er zu Bett ging. Er hatte ihn gesehen, wie er lehrte, wie er in die Kirche ging und wie er das Abendmahl feierte.
„Ja“, sagte ich schließlich. „Ich bin entzückt von seinem Geist. Er ist mir Lehrer und Mentor geworden, und auch ein Freund. Gott ist Bill nicht mehr so wichtig, und wir sind nicht immer einer Meinung. Bei Jack habe ich nicht den Eindruck, dass man je alles ausschöpfen könnte, was er zu sagen hat.“
„Ich glaube, Lewis würde dir sagen, dass du Christus nachfolgen sollst, nicht ihm“, sagte Chad mit einem verschmitzten Lächeln.
„Ja, aber kann ich denn nicht beiden nachfolgen?“ Ich musste einen Moment lang überlegen, bis mir klar wurde, was ich eigentlich sagen wollte. „Ich bin nicht so traditionell wie Jack, aber andererseits ist er auch nicht so traditionell, wie andere es von ihm annehmen.“ Mit Bedacht ließ ich die nächsten Worte auf meiner Zunge ruhen, bevor ich sie aussprach. „Ich wünschte, ich könnte ihn auch besuchen, so wie du. Ich kann diese kühle, grüne englische Welt beinahe spüren. Die Stille. Die Bibliotheken und Kathedralen, umgeben von erhabener Schönheit.“
Chad legte unter seinem Kinn die Fingerspitzen aneinander und nickte. „Es war schon ein tief greifendes Erlebnis, das muss ich zugeben. Vielleicht kommt ja noch der Tag, an dem du das auch machen kannst.“
„Für Männer ist das leichter“, sagte ich. „Das ist nicht fair, aber es ist nun einmal so. Ehefrauen und Mütter können nicht einfach so nach England reisen, um zu forschen und zu schreiben und Interviews zu führen. Du kannst dich zwei Monate lang aus dem Staub machen und studieren und deine vier Kinder bei deiner Frau lassen, aber nach irgendeinem unsichtbaren und ungeschriebenen Gesetz kann ich es nicht genauso machen.“
Chads freundliches Lächeln verriet mir, dass er mich verstand. „Eines Tages vielleicht, Joy. Eines Tages vielleicht.“
„Jesus sagt uns, wir sollen uns nicht um das Morgen sorgen. Glauben wir ihm das?“
„Wie meinst du das?“ Chad rieb sich den Nasenrücken, als wäre seine Brille zu schwer.
„Was wäre“, sagte ich mit gesenkter Stimme und beugte mich näher zu ihm, „was wäre, wenn ich mich auf dieses Gebot verlassen würde? Was in aller Welt würde aus mir werden, wenn ich je den Mut dazu hätte?“
Chad nickte bedächtig. „Ganz richtig, Joy. Was würde aus uns allen werden, wenn wir auf einmal so kühn wären, an seine Worte zu glauben?“
Ein paar Augenblicke lang schwiegen wir, bis Eva nach Chad rief und er sich erhob. Ich blieb allein zurück, während draußen der Sturm wütete.
Nach einer Weile wurde es still im Haus. Ich schlüpfte ins Schlafzimmer, wo Bill schon schnarchte, und suchte mir einen Stapel Papier. Damit ging ich zurück in die Küche, setzte mich, spürte den bebenden Donner von draußen und begann an einem neuen Sonett zu arbeiten. Ich schrieb zwar keine Gedichte mehr, um sie zu veröffentlichen, aber zu meiner eigenen Erbauung tat ich es immer noch. Gefühle, die ich bei Tageslicht nicht eingestehen oder laut aussprechen konnte – der Schmerz unterdrückter Wünsche, das Zurückweisen von Bedürfnissen, weil sie inakzeptabel waren, die Frustration über die Verantwortung, die mich als Frau mit einem engen Korsett umgab –, fanden durch das Tor der Dichtung einen Weg ins Freie.
In meiner kleinen, engen Handschrift erschien die erste Zeile eines Sonetts.
Shut your teeth upon your need. – Beiß deine Zähne zusammen für dein Bedürfnis.