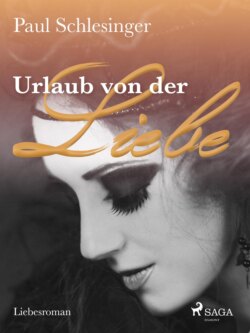Читать книгу Urlaub von der Liebe - Paul Schlesinger - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAls Onkel Oskar auf den Balkon tritt, begegnet ihm ein kaltes Lächeln.
„Na, Oskar, du auch mal wieder?“
„Steglitz ist so weit.“
Und dann gibt’s ein Reden hin und her von gleichgültigen Dingen. Herr Robert Gundermann legt kaum die Zeitung aus der Hand. Aber Mathilde ist sofort aufgesprungen, dem Schwager noch ein Nachtmahl aufzutragen. Der hat es nicht hindern können und isst mit mechanischen Kaubewegungen ein paar Bissen, um schliesslich zu danken. Die elektrische Lampe bescheint nur einen engen Kreis, und das Eiserne Kreuz ist ausserhalb des Scheins geblieben. Das Essen wird hinausgetragen. Robert streckt dem Bruder die Zigarrenkiste hin, und Oskar greift zu.
„Du zitterst ja, Oskar.“
„Man wird nicht jünger, Robert.“
„Na ja, aber ich hatte das bei dir nie bemerkt.“
Fritz reicht dem Onkel das brennende Streichholz, und das Licht flammt bei dem kurzen heftigen Zuge hell auf.
„Du trägst ja dein Kreuz, Onkel?“
„Ach so, ja. Eigentlich eine kleine Bosheit von mir. Ich kam heute an einem Warenhausfenster vorbei. Da waren lauter Aschbecher mit dem Kreuz. Du kannst natürlich nicht dafür, Robert, dass du damals nicht im Felde warst. Aber warum soll ich so gänzlich schmucklos bleiben?“
Herr Gundermann schliesst ein bisschen die scharfen Augen, kneift die Lippen fester zusammen, um eine kräftigere Antwort zurückzuhalten. Dann sagt er:
„Und du fragst gar nicht nach Heinrich?“
Onkel Oskar bemüht sich, ein ganz harmloses Gesicht zu machen. Aber wann soll er denn eigentlich anfangen?
„Heinrich — nun ja — Heinrich — man wagt ja gar nicht so recht an da draussen zu denken.“
„Wieso?“ Robert sitzt ganz aufrecht im Lehnstuhl und hat die Zeitung endgültig aus den Händen gelegt. „Es geht doch vorwärts, gewaltig vorwärts.“
„Nun ja — Robert — es geht vorwärts, aber es kostet auch was.“
„Was — ja, was meinst du denn eigentlich?“ Mathilde sitzt auch steif aufgerichtet da, und Fritz meint für sich, dass die Mutter noch gar nicht die alte Frau sei. Sie ist wie sprungbereit. Die grauen Augen, die für alle Tage so verloren blicken, sind plötzlich mit Licht gefüllt. Der sanft gekrümmte Nacken, die Wange — Fritz sieht plötzlich unter dem grauen Schleier des Alters die junge Mutter. Dann sagt er:
„Weisst du, Onkel, man sollte den Eltern so etwas gar nicht vor die Augen halten. Die Dinge sind schlimm, und man bessert sie nicht, wenn man sie sich vorstellt.“
„Nein, Fritz,“ sagt Mathilde, „der Onkel hat recht. Ich habe an dich gedacht, wie du draussen warst, und ich denke an Heinrich. Aber es ist in unseren Gefühlen immer etwas, was sich beruhigen will, sich zufriedengeben. Und es kommen Briefe und Karten, und man wird wirklich ruhig und sitzt auf dem Balkon, als ob nichts wäre.“
Mutter Mathilde steht auf. Sie hat ihr Taschentuch in der zitternden Hand und geht mit unsicheren Schritten in das dunkle Wohnzimmer. Die drei Männer bleiben schweigend zurück, bis sie ein Schluchzen hören.
„Du hättest ihr das alles nicht sagen sollen, Oskar.“
„Ich habe ja doch nicht viel gesagt, Robert —“
„Nein, nicht viel, aber sie weint.“
„Frauen denken, wenn sie weinen.“
Robert sieht missbilligend auf den Bruder, steht auf, folgt seiner Frau ins Dunkle. Dann erhebt sich auch Fritz. Er tastet sich zurecht, stolpert fast über die Füsse des Vaters, der lang ausgestreckt im Lehnstuhl liegt — und findet endlich die Mutter, die auf dem Sofa sitzt und den Kopf mit beiden Händen auf den Tisch stützt. Endlich trottet Oskar hinterdrein, sucht sich aber ein bescheidenes Stühlchen nahe der Balkontür. Als sich die Augen gewöhnt haben, sehen sie ganz gut die verschwommenen Umrisse von Mutter und Sohn, ein bleiches Leuchten auf Robert Gundermanns kahlem Schädel, vor der Glastür aber den warmen Lichtschein, der das giftige Grün des wilden Weins und die roten Pelargonien so jäh aus dem Schlaf weckt.
Nach einem kurzen Schweigen geht Oskar einen Schritt weiter.
„Ich habe es nicht so gemeint, dass man sich das Schreckliche vorstellen soll. Das am allerwenigsten. Aber man soll sich wohl zu den Menschen, für die man fürchtet, ins rechte Verhältnis setzen.“
Robert wird durch das Geschwätz des Bruders nervös.
„Meinst du etwa, ich stünde zu Heinrich nicht richtig?“
„Du stehst gut zu ihm, Robert, aber richtig? Du stehst ja auch zu mir gut, Robert. Und ich zweifle doch an der Richtigkeit.“
Oskar bekommt keine Antwort, und er fährt fort:
„Bis zu einem gewissen Punkte hat natürlich alles seine Richtigkeit. Man ist jung, kriegt Kinder, die wachsen heran, entwickeln sich so oder so, und man kämpft mit ihnen. Das muss so sein. Jedes kleine Halsübel wird sehr sorgfältig nud sehr liebevoll behandelt und beseitigt. Aber wenn die kleinen Uebel des Herzens beginnen, sind Eltern machtlos. Was sollen sie denn tun? Gewähren lassen? Nein! Hat ein Vater nicht Erfahrung und Willen — eine Mutter nicht Gefühl und Wurzeln? Also man kämpft. Der Junge hat eine Begabung, der Vater hat sein Geschäft —“
„Bist du hergekommen, mir Vorwürfe zu machen?“
„Nein, lieber Robert, ganz im Gegenteil. Ich halte diesen Widerstand für sehr natürlich und notwendig. Die Jugend nascht gerne, auch von der Schönheit. Sie ist geneigt, jedem Gelüst nachzugehen. Und erst am Widerstand lässt sich prüfen, ob’s ernst war. Der Junge brennt von Zuhause durch. Sein leidliches Klavierspiel gibt ihm die Möglichkeit, durch Unterricht sein eigenes Studium durchzusetzen. Der Vater wird weich — aber der Sohn wird verstockt, und man braucht die Hilfe eines alten Onkels, damit der Sohn nur die kleine Unterstützung annimmt, die ihn von der Fronarbeit befreien, sein Studium behaglich machen soll.“
„Na ja, das wissen wir ja alle —“
„Und wisst doch nicht das Eigentliche. Der Sohn arbeitet. Die Notenpapiere um ihn häufen sich. Kompositionen, Pläne, es gehen grosse Dinge vor. Er glaubt an sich, er kennt gar keinen Zweifel.“
„Und dann ist doch alles umsonst.“ Robert Gundermann sagt es mit schwerer Zunge.
„Das ist ja das Merkwürdige, Robert, dass es nicht umsonst ist. Ganz und gar nicht. Die Kompositionen haben keinen Erfolg. Schwarz auf weiss steht es in den Zeitungen, und die Autoritäten sagen es in privaten Gutachten ohne Mitleid: Es reicht nicht. Ginge es um Nichtigkeiten. Aber nein, einer auf Stelzfüssen will den Kilimandscharo besteigen. Die Liebe zur Kunst macht noch nicht den Künstler. Dieser ist ein Dilettant, wie er in den Balkonwohnungen Berlins zu Dutzenden zu finden ist. Dilettant — einer der sich am Guten zu erwärmen vermag, aber selbst keine Flamme, nicht einmal ein Flämmchen. Zusammenbruch. Aber als Dirigent will er’s versuchen, ein Konzert —“
„Erinnere doch nicht daran, Onkel!“
„Jawohl, gerade daran erinnere ich. Gott sei Dank, dass die Philharmoniker auch ohne — und wenn es sein muss — auch gegen den Dirigenten zu spielen verstehen. Noch ein Zusammenbruch. Aber was dann?“
„Schweig’ doch, Oskar, du siehst doch, wie erregt Mathilde ist.“
Aber die Mutter hat längst die Hand von den Augen genommen, und sie sagt ganz fest: „Lasst ihn sprechen! Ich ahne, wo er hinaus will.“
Oskar Gundermann saugt die letzten Züge seiner Zigarre heftig heraus und wirft den Stummel in weitem Bogen über den Balkon.
„Zweiter Zusammenbruch. Heinrich flieht. Niemand weiss, wohin. Jawohl, dieser Zusammenbruch schmerzt. Uns allen ist es wie eine Schande. Der Name Gundermann hat seinen Klang in der Industrie. Aber in die Oeffentlichkeit ist er nicht gedrungen. Gundermanns sitzen Olivaer Platz Numero zwölf. Mehr verlangen sie nicht vom Leben, und Berühmtheit am wenigsten. Aber eines verlangen sie: dass der Name nicht zum Spott genannt wird. Soll man sich von Geschäftsfreunden fragen lassen: Ist das Ihr Sohn, Gundermann? Soll man sich von Onkels und Vettern fragen lassen: Was geschieht mit Heinrich? Und die Scham ist nicht das einzige, was treibt. Die Mutter schreit’s hinaus: Was geschieht meinem Kinde? Verflucht die Kunst, wenn sie einen Menschen zugrunde richtet!“
„Du hast recht, Oskar, wie oft habe ich’s gedacht!“
„Und der Onkel wird wieder mal auf die Suche geschickt und findet den Jungen in einem Tanzlokal am Klavier. Und sagt: ‚Junge, dein Vater ist reich. Hast du deine Liebhabereien, so sollst du sie pflegen dürfen. In allen Ehren, in Beschaulichkeit. Vielleicht wird es dann doch was.‘ Und der Junge steht kaum vom Klavier auf und sagt: ‚Ich danke, danke euch allen. Aber reden wir nicht mehr von der Kunst! Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich will jetzt gar nichts weiter, als meine bürgerliche Existenz mit dem durchsetzen, was ich immerhin — gelernt habe. Nicht, als ob’s mir auf diese Existenz selbst so unbedingt ankäme. In meinem Falle aber ist sie einfach der Gradmesser meiner sittlichen Kräfte. Und deshalb lieber zum Tanz aufspielen als auf bequeme Art.‘“
Robert Gundermann holt tief Atem und sagt: „Es war am Ende Gundermannsch —“
„Mit Verlaub — es war: Robert Gundermannsch — aber das war dir damals nicht so ganz klar. Du warst eben einfach von Herzen unglücklich und hast dich erst beruhigt, als der Weg langsam, langsam, vom Tanzklavier zum Tanzorchester, vom Dirigenten der Tingeltangel zu dem des Badeorchesters führte, bis endlich, endlich mit heissem Bemühen die nicht gerade weithin sichtbare Stelle des Kottbuser Stadttheater-Kapellmeisters errungen war und alles in allem schliesslich bewiesen wurde, dass einer mit schweren Kämpfen, mit härteren Leiden, mit brennenderen Nöten sein Pöstchen erobert hat.“
Und Fritz stimmt ein:
„Und dass die Ehre grösser war als die des anderen Bruders, der sich einfach an den gutpolierten Schreibtisch des Vaters setzte —“
„Jeder seiner Natur nach, Fritz. Du hast ja wohl die Hände nicht in den Schoss gelegt, wie — nun, wie ich. Aber die höhere Ehre, wir mögen sie ihm gönnen. Und wenn wir ihn richtig einschätzen, dann brauchen wir nicht an die Schrecken des Schlachtfeldes zu denken. Was sich dort abspielt, was dort Schicksal ist, das ist es Tausenden, die auch Mütter, Väter, Brüder haben. Aber das Besondere, das haben wir, nur wir mit ihm. In diesem Verhältnis müssen wir mit ihm sein, unbekümmert um das bisschen Gefahr.“
Die Mutter sagt mit tränenlosem Blick: „Dann ist es ja wohl in einem besonderen Sinne gleich, ob einer lebt oder nicht. Wenn wir nur mit ihm leben.“
„Ja, liebe Mathilde, und deshalb bin ich heute abend zu euch gekommen, um euch das zu sagen.“
Da steht die Mutter plötzlich auf. Sie sieht scharf zu Oskar hinüber, dessen bleiches Gesicht von der Lampe draussen zur Hälfte beleuchtet ist. Ihre Blicke begegnen sich, und dann weiss sie, und sie stürzt zusammen — —
Die Lampen in den anderen Käfigen sind längst erloschen. Die Stadt liegt in ihrem frühen Kriegsschlaf. Nur noch selten das Rollen der Bahn, der misstönende Ruf einer Hupe. Bei Gundermanns brennt die Lampe immer noch. Die Vier haben lange geschwiegen. Nun steht Robert Gundermann langsam auf und legt dem Bruder die Hand auf die Schulter: „Ich danke dir, Oskar.“
„Nein — nein, du hast nichts zu danken, du selbst gibst mir die Zeit, über einige Dinge nachzudenken. Aber wir wollen uns darüber auch nicht unklar sein, dass mit dem Tode Heinrichs das eine Problem gelöst wurde. Ein eigentlich glücklicher Mensch konnte er ja nicht werden. Und einer, der sich krampfhaft zwingen musste, fand nun die Ruhe. Auch das macht den Schmerz um ihn linder und endlich heilen. Aber es bleibt —“
Oskar hält inne, Vater und Mutter sind zu tief in ihren Gedanken, um es zu bemerken.
Nur Fritz hört das Zögern und fragt:
„Was bleibt?“
„Gewissermassen ein Vermächtnis. Ich selbst erfuhr davon erst in dem Augenblick, als Heinrich ins Feld rückte.“
„Ein Kind?“ Die Stimme der Mutter klingt fast frohlockend, als erwarte sie, dass das Schicksal ihr nun den Sohn verjüngt wiedergeben wolle.
„Nein, Mathilde, eine Frau.“
An diesem Abend erfahren die Eltern wenig genug; nur dass es eine Dame vom Theater sei, eine Sängerin, und dass die Ehe schon vor drei Jahren in aller Stille geschlossen wurde, und dass Konstanze Gundermann für diesen Sommer am Gutstedter Sommertheater engagiert sei. Der Brief des Sohnes aber lautet zum Schluss:
„Seid freundlich zu ihr! Sie hatte es mit mir nicht leicht. Das Leben am Theater ist ein täglicher Kampf um das Nötigste. Beschützt sie vor dem Schlimmsten! Und, wenn ich sterbe, werde ich einen Dank für Euch auf den Lippen haben.“