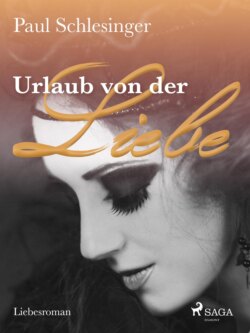Читать книгу Urlaub von der Liebe - Paul Schlesinger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAls Oskar Gundermann in Gutstedt ankommt, gerät er in das abendliche Getriebe des Badeorts. Gellend weisse und rötliche elektrische Lampen kämpfen noch mit dem leisen Blau des sich sacht entfärbenden Himmels. Zwitterfarbig liegt’s über Häusern, Bäumen, Dingen und Menschen. Die tummeln sich geschwätzig, huschen noch in diese und jene Läden oder ziehen in feierlich behäbiger Ruhe zum Abendessen. Die Terrassen der Gasthäuser sind sehr dicht besetzt.
Es ist lange her, dass Oskar Gundermann die Luft einer Badestadt geatmet hat. Mit einer losen Verführung nimmt’s ihn gefangen, als er junge Mädchen in hellen Kopftüchern vorbeilaufen sieht. Erst als er in der weitläufigen Diele des Hotels auf einen Zettel des Gutstedter Kurtheaters stösst, merkt er, dass er für Minuten den Sinn seiner Reise vergessen hat.
„Fledermaus“ — und noch einmal verflüchtigt sich das Bewusstsein seiner ernsten Gegenwart. Ein toller Rhythmus jagt plötzlich durch seinen Körper, eine süsse Kantilene ist ihm im Ohr — was hat’s mit dem armen Jungen zu tun, der da draussen liegt?
Nein, diese Fröhlichkeit spricht nicht gegen die Trauer. Man wird sich an solchen Tagen nicht ins Theater setzen. Aber das schmeichelnde Gift dieser Musik rumort auch ausserhalb des Theaters — in jedem Blut, das seine Erinnerungen hat.
Oskar Gundermann tritt näher — nur aus Neugier — und überfliegt die Namen. Plötzlich erbleicht er, sein Körper zittert — nein, er ist doch kein Mann mehr von unerschütterlichen Nerven. Da steht’s: „Adele — Konstanze Gundermann.“ —
Er fährt auf sein Zimmer, unterschreibt mit unsicherer Hand die Meldung, dann lässt er sich auf den wenig bequemen Stuhl fallen und wischt den unaufhörlich hervorquellenden Schweiss von seinem Gesicht.
„Adele — Konstanze Gundermann.“
Ruhig Blut — was also ist dabei? Entweder sie weiss es noch nicht. Tanzt und hüpft stubenmädchenhaft über die Bühne und weiss nicht, dass der beste Junge mit durchschossenem Kopf in galizischer Erde liegt. Muss man nicht hinstürzen in das Theater, sie zurückhalten? Darf eine solche Vorstellung überhaupt stattfinden?
Oder — sie weiss es — weiss es seit gestern und übt ihren Beruf. Nun — und? Hat er nicht selbst vorhin gefühlt: Diese Fröhlichkeit spricht nicht gegen die Trauer? Uebrigens ihr Beruf — nicht wahr? Eine plötzliche Absage, die Vorstellung kann nicht stattfinden, der Direktor ringt verzweifelt die Hände. Dem Toten kann das alles nichts nutzen — aber der Theaterdirektor kämpft um seine Existenz und um die seiner Mitglieder.
Aber sie selbst — wie bekommt sie’s über sich? Wenn sie ihn geliebt hat —
In Oskar Gundermanns Zimmer ist es dunkel geworden. Er will sich entschliessen, springt auf, nimmt Stock und Hut.
Als er über die Terrasse des Hotels geht, spürt er, dass er lange nichts gegessen hat. Nun ja, die Zeit will auch hingebracht sein. Er bestellt Gleichgültiges und isst ohne Lust und Hunger.
Und plötzlich ist es ihm klar: Er muss Konstanze Gundermann sehen. Als Adele. Er wird den Schlüssel zu ihrer Persönlichkeit in der Hand haben, bevor er sie spricht. Er wirft dem Kellner das Geld hin, lässt sich den Weg zeigen, verirrt sich in dem grossen, mächtigen Kurpark auf den ewig geschlungenen, zu keinem bestimmten Ziele führenden Spazierwegen, dreimal, bis er endlich vor dem Theaterchen steht. Ein Trinkgeld öffnet ihm den Verschlag, der den Namen Fremdenloge führt.
„Mein Herr Marquis,
Ein Mann wie Sie.“
Da steht Adele-Konstanze. Zart, schlank, kaum in Mittelgrösse. Ein Ballkleid — dieses hat Adele nicht ihrer feudalen Herrin gemopst, es stammt aus dem eigenen Kleiderschrank — rosa mit Flittern. Oskar denkt nach. Alt gekauft aus der Garderobe eines Hoffräuleins von Lippe oder Waldeck. Nun ja, Heinrich konnte sie nicht glänzend ausrüsten, und die eigene Gage — Oskar rechnet sie an der Stimme aus, an diesem kleinen, dürftigen Stimmchen, das kaum dieses Theater zu füllen vermag. Ist Konstanze heiser? Nein, die Stimme ist, wie sie ist — gebrochen. Da tut auch Heinrichs Tod nichts ab und nichts zu. Und dann spürt er doch den Reiz eines Knabenorgans im Stimmwechsel — schwach, zuweilen krähend, aber hie und da ein süss verschleierter Ton.
Aber nein, Oskar ist kein Musikkritiker. Den Menschen sucht er und findet — ein Gleitendes, Hüpfendes, Kosendes. Diese matte Fahne eines Ballkleides will nichts besagen gegen die schlanke Fülle einer besonderen Eleganz in Gang und Gebärde. Nein, nein, nicht Soubrette, nicht Stubenmädel, das mit der Schleppe tolpatscht — nein, Dame, die das Damenhafte karikiert. Verliebt erfahrene Kinderhände, ein Körperchen, kaum mittelgross, aber durchgebildet, biegsam, tanzend in jedem Schritte. Und über den offenen kleinen Brüsten ein runder, schlanker Hals — ein Kopf —
Heinrich ist tot! Oskar Gundermann muss es vor sich hinsagen — hörte sie nichts davon? Im braunumlockten Oval eine kurze Nase, ein Mund, frauenhaft reif, zwei Augen, nicht zu dunkel, übergross, merkwürdig verliebte Trauer. Das ist es. Oskar denkt an Chopin. Das ist nicht Trauer um Heinrich, nicht Verliebtheit in Heinrich. So ist sie für sich — und wo sie blickt, muss die Liebe keimen. Und wo die keimt, muss Konstanze entweichen, mit einem letzten guten Lächeln um den Mund, der so viel weiss. Und Oskar findet das Motiv wieder in jedem Rühren des Armes und der Füsse, in jeder Biegung des Körpers, in der gebrochenen Stimme selbst. Trauer — um was? Verliebtheit — in die Welt. Zutiefst eine Tollheit, eine Auflösung in Johann Strauss, darüber die jähe Verzweiflung einer halben Begabung, die sich mit Routine preisgibt — zynisch das eigene Unvermögen verspottet.
Fünf Leute klatschen, am eindringlichsten ein grosser schwarzer Mann, mit hagerem, knochigem Gesicht, glatt rasiert, mit dünnem, gescheiteltem Haar — er sitzt Oskar Gundermann gegenüber — und scheint das Publikum mit sich fortreissen zu wollen. Aber Konstanzens Stimme ist selbst für Gutstedt keine Stimme. Alles mögliche, dass man nicht zischt, und Konstanze macht eine traurige Verbeugung gegen den einsamen Klatscher.
Oskar Gundermann stürzt aus dem Hause. Was ist das, was geht hier vor? Er kann es nicht mit ansehen. Der Pförtner sagt ihm, um Elf würde die Vorstellung zu Ende sein. Oskar rennt durch den Park. Zuweilen ruht er erschöpft auf einer Bank, jagt wieder empor. Lichtschein lockt ihn zum Kurhaus, Musik vertreibt ihn auch von dort. Dann sitzt er eine volle Stunde in einer dunklen Hecke. Nur ab und zu geht ein Pärchen an ihm vorüber. Ein Gymnasiast mit seinem Schwarm. Ein Feldgrauer, verwundet, mit einem Dienstmädchen.
Um dreiviertel Elf ist er am hinteren Ausgang — um Elf flammen die Lichter des Eingangs auf. Zweihundert Menschen trotten im Geschwätz davon. Einer, hager, gross, dunkel, löst sich aus der Menge. Stellt sich hin und starrt auf den Bühnenausgang.
Nun kommen auch die Künstler. Zuweilen lüftet der Schwarze seinen breitrandigen, steifen Strohhut. Und endlich Konstanze. Dieses schwarz-weiss karierte Taftkleid ist nicht aus der Garderobe des Hoffräuleins von Lippe. Noch dieser umgehängte Covercoatmantel, dessen breite, männliche Formen Konstanzens Fraulichkeit nur schärfer profilieren. Noch dieser leicht schief gesetzte Hut mit dem seitwärts abstehenden Reiher.
Der Schwarze geht auf sie zu, hebt den Hut kaum, drückt ihr flüchtig die Hand. Einige Worte mögen gewechselt werden. Nun treten sie beide unter den Lichtkegel einer Bogenlampe. Oskar Gundermann sieht in aller Deutlichkeit das wie gegerbte Gesicht des Mannes mit der spitzen, langen Nase, er sieht die gelben, grossen, unregelmässigen Zähne in dem breiten, schmallippigen Mund. Den grossen Ring auf der mageren, behaarten Hand.
Plötzlich steht Onkel Oskar vor ihnen.
„Verzeihung, habe ich die Ehre, Frau Heinrich Gundermann zu sprechen?“
Zwei erschreckte Augen blicken auf ihn.
„Ich bin Heinrichs Onkel, Oskar Gundermann.“
„Wirklich?“
Das war Freude — unverhohlene, mit Dank und Zärtlichkeit gemischt.
„Gut, dass Sie kommen — wie gut!“ Sie packt mit beiden Händen Oskars Rechte, die Tränen stürzen aus den Augen — „wie gut, wie gut!“
„Ja, es ist wirklich gut,“ sagt der dunkle Mann mit tiefer, hohler Stimme. Dann nimmt er nochmals den Strohhut ab. „Ich bin Gerhard Stein“ — und nach einer Sekunde: „Ein Freund Heinrichs. Sie können sich denken, wie ratlos wir sind — ich kam gestern und brachte Konstanze die Nachricht —“
Konstanze lässt die Hand Oskars nicht los.
„Ich muss mit Ihnen sprechen.“
„Deshalb komme ich ja her — aber wo gehen wir hin?“
Gerhard Stein antwortet für Konstanze: „Ich weiss hier in der Nähe eine kleine Gartenwirtschaft. Da sind wir ungestört. Konstanze muss etwas essen.“
Man setzt sich in Gang.
Gerhard Stein spricht: „Ich habe Konstanze so gebeten, heute abend nicht zu spielen.“
Konstanze schüttelt ungeduldig den Kopf — Oskar sagt begütigend:
„Der Direktor wäre wohl in grosse Verlegenheit gekommen —“
Konstanze macht ein Geräusch mit den Lippen —
„Ach der — was geht der mich an — aber ich, ich frage Sie, Herr Gundermann, was wird gebessert, wenn ich drei Tage in meinem Zimmer heule, um dann doch zu spielen? Alles Unsinn. Angst, blödsinnige Angst habe ich die sechs Wochen, jeden Tag gehabt, seitdem Heinrich im Felde ist. Jeden Tag ist er für mich gestorben, jeden Tag habe ich ihn begraben und habe gespielt. Warum vorgestern noch, wo er tot war und ich nichts wusste? Heute, wo ich es weiss, habe ich gar keine Träne mehr.“
Gerhard Stein meint ernst:
„Nun ja, Konstanze, aber gerade ‚Fledermaus‘ —“
„Unsinn, alles Unsinn. Als Iphigenie engagiert mich niemand. Das solltest du doch wissen, dass uns die Spielerei im besten Falle ein bisschen Arbeit ist — ich hab’ doch keinen Ball mitgemacht, ich hab’ doch nicht getanzt — alles Unsinn.“
Stein bleibt hartnäckig.
„Nun ja, ich kann’s verstehen. Aber Herr Gundermann.“
Konstanze ist gereizt:
„Dann kann ich Herrn Gundermann auch nicht helfen — nehmen Sie mir’s nicht übel, lieber Herr! Die Familie verliert viel an Heinrich — ich — ich verliere alles. Obgleich das auch nicht stimmt. Ich habe nämlich noch mich. Verstehen Sie, was ich meine? Heinrichs Schicksal ist beklagenswert. Er liebte das Leben, er liebte mich. Und solange er am Leben war, hatte er mich. Das heisst also — ich spreche natürlich nicht vom Geld — es war jemand da, der einen Teil, einen sehr grossen Teil — von mir besass und sozusagen verwaltete — ich weiss wirklich nicht, ob Sie mich verstehen —“
Sie hält im Gehen inne und sieht Oskar so nahe aus leuchtenden, denkenden Augen an, dass es ihn verwirrt.
„Also passen Sie auf! Wir haben alle Fehler, und ich habe besonders viele, wie eine — ich muss das schon sagen — wie eine Lokomotive, die x-mal aus dem Gleise geworfen wurde und oft weite Strecken über knirschenden Kies gelaufen ist.“ Ein flüchtiges Lächeln. „Der Vergleich stammt nicht von mir. Also ich habe viele Fehler, und wenn ich mit mir allein bin, dann schlägt’s über mir zusammen. Ich bin eigentlich furchtbar lustig und kann doch mit dem Leben nichts anfangen, verstricke mich. Ach, Sie wissen nicht, wie schwer es ist. Und dann kommt einer und ist lieb, heiratet sogar. Nun brauche ich mich mit dem Schweren nicht allein zu quälen, nicht wahr — er stützt mich doch — er nimmt die Fehler in Behandlung und erträgt sie. Schelten Sie mich nicht egoistisch! Es ist aber zu zweit alles leichter. Nun ist er plötzlich tot. Keiner hat so Grund zur Klage wie ich. Aber von ihm ist alle Sorge genommen. Und ich habe mich wieder ganz allein. Ich denke an ihn, traure um ihn, verliere mich darüber. Aber wenn ich klug bin, muss ich mich aufraffen, an mich denken. Verstehen Sie, das ist bei aller Freundschaft jetzt das Wichtige —“
Man geht weiter — Oskar Gundermann sagt:
„Sie haben Ihren Beruf, nicht wahr?“
„Beruf!“ Oskar hätte nicht geglaubt, dass Konstanze so bitter werden könnte. „Beschäftigung, lieber Herr, Beschäftigung. Das heisst, ich mache es mit den Armen, mit den Beinen, mit den Augen — wenn Sie drin gewesen wären, Sie wüssten Bescheid.“
„Ich war — für ein paar Augenblicke —“
„Gott sei Dank, dass Sie es sagen. Für ein paar Augenblicke. Sie wissen Bescheid, und ich brauche Ihnen nicht weiter viel zu erklären. Also ich bin nicht dumm, ich weiss auch Bescheid.“
Sie sind in dem wenig besuchten Wirtschaftsgarten angekommen, wo Efeuwände in langen, schmalen Kästen kleine, nach drei Seiten abgeschlossene Nischen bilden. Die elektrischen Leuchter auf den Tischen schweben wie bunte Kugeln in der Nacht.
„Man ist hier fast allein —“
Konstanze schlägt den Mantel fester um den kleinen, spitzen Ausschnitt des Halses.
„Sie müssen entschuldigen, Herr Gundermann, dass ich nicht in Trauer bin —“
„Aber wie sollten Sie so rasch —“
„Nein — aber wozu aller Welt verkünden, dass — man ist hier in einem Badeort — ich bin für Humor engagiert, und ich wünsche keine Teilnahme.“
Konstanze isst ein Fleischgericht mit einem Heisshunger, der zu erkennen ist, trotz der wohlerzogen graziösen Haltung. Dann schiebt sie den Rest plötzlich, wie von einer Uebelkeit befallen, von sich fort. Aus ihrer umfangreichen silbernen Handtasche nimmt sie ein Zigarettenetui.
„Sie entschuldigen, Herr Gundermann — ach, ich habe das Gefühl, als müsste ich Sie immerzu um Entschuldigung bitten, dass ich so bin — dass ich überhaupt bin —“
Ihre Augen werden feucht, sie sucht es zu meistern.
„Liebes Kind — ich bin doch ein Mensch —“
Oskar Gundermann greift nach der zarten, schmalen, kleinen Hand, deren rosige Nägel heute mit derselben Sorgfalt poliert sind wie gestern und vorgestern.
„Ja, Herr Gundermann, das merke ich wohl. Aber was nützt es — oder was würde es schaden, wenn Sie es nicht wären?“
Oskar zieht die Hand zurück. Konstanze hat sich weit zurückgelehnt und stösst den Rauch aus ihren reifen Lippen. Oskar Gundermann sieht: da ist Schminke darauf, nicht von der Bühne her. Nein, aufgetragene. Die Haut der Wangen — leicht angegriffen — ist sorgfältig behandelt, das Schwarz der Wimpern etwas verklebt, die Wölbung der Augenbrauen fein verstärkt. Nun blickt sie wieder so sinnend auf ihn.
„Sie meinen es gut mit mir, wie Gerhard Stein und etliche andere Leute, und helfen kann mir doch keiner, und der eine ist tot —“
„Aber ich bin ja hergekommen, um Ihnen zu helfen.“
„Ueberlegen Sie sich doch, Herr Gundermann.“ Konstanze beugt sich vor und stemmt die Ellenbogen auf den Tisch. „Sie sind sich ja noch gar nicht klar. Nehmen Sie irgendeine andere Witwe, die es vielleicht viel trostloser hat. Unversorgte Kinder — oder wenn nicht — einen Haufen Hausrat, eine Partie Möbel, die ihr in aller Schäbigkeit was bedeuten. Denn so ist es doch: der Schreibtisch des Mannes, der Esstisch, unter den Mann und Frau ihre Füsse gesteckt haben, das bedeutet doch etwas wie Geschichte. Und in Gedanken an diese Geschichten kann man weiterleben oder, wenn man es nicht kann, zum Fenster hinausspringen. Aber Heinrich und ich haben nichts Gemeinsames. Nichts Greifbares. Kein Kind — nicht eine Teekanne. Man ist verheiratet — jawohl. Und lebt drei Jahre in möblierten Zimmern und Hotels. Ich tue meine Arbeit — er seine — manchmal waren wir monatelang getrennt. Dann wieder zusammen, wie es der gute oder böse Wille von Theaterdirektoren fügte. Vielleicht vermissten wir das gar nicht, was andere Menschen Gemütlichkeit nennen. Aber heute weiss ich wohl, dass ich eine andere Witwe geworden wäre, wenn wir manches anders gemacht hätten.“
Oskar Gundermann nickt.
„All das glaube ich, mein liebes Kind. Und all das hätte anders sein können, wenn Heinrich nicht den einen Fehler begangen hätte, seine Ehe den Eltern zu verschweigen. Sie hätten euch geholfen und euch die Umstände geschaffen, unter denen ihr euch wohlfühlen konntet.“
„Ja und nein, Herr Gundermann. Wir haben lange darüber nachgedacht. Und manchmal lag es uns nahe, aus äusseren und inneren Gründen. Denn Sie wissen, er hat seine Eltern geliebt. Aber sein Entschluss gründete sich hier auf einen Satz, und der ist unanfechtbar. Er schrieb ihn mir einmal, und ich habe ihn ungefähr auswendig gelernt: ‚Meine Ehe ist eine Angelegenheit innerster Art, und keine leichte. Sie ist ganz im Gefühlsleben begründet und hat weiter keine materielle Grundlage. Denn jeder sorgt für sich selbst. Also will ich nicht, dass andere Menschen an diesen inneren Vorgängen teilnehmen, namentlich nicht Menschen, die mir gut sind, denen diese Ehe nur eine Sorge mehr ist, und die beim besten Willen nicht imstande sind, meine Gefühle zu teilen.‘“
„Glauben Sie wirklich, Konstanze, dass es den Menschen so schwer wird, Sie zu lieben?“
Konstanze verzieht schmerzlich den Mund —
„Aber wissen Sie, lieber Freund, wie weit ich imstande bin, eine Liebe zu belohnen?“
Gerhard Stein hat schweigend dabeigesessen und eine Zigarette nach der andern geraucht. Nun rückt er plötzlich an seinem Hut.
„Mir fällt plötzlich — zu spät wohl — ein, dass Sie meine Anwesenheit als überflüssig empfinden könnten —“
„Aber nein,“ sagt Oskar Gundermann. „Wenn ich recht verstehe, gehören Sie ja zum nahen Freundeskreis — und wir sind ja hier in derselben Angelegenheit.“
„Doch haben Sie vielleicht etwas Besonderes mit Konstanze zu besprechen —“
„Nichts, was Sie nicht hören dürften, Herr Stein. Heinrich hat in seinem letzten Brief an die Eltern von seiner Frau gesprochen und ihren Schutz für sie erbeten.“
Konstanze reckt den Kopf.
„Was für Schutz?“
„Nehmen wir die Dinge bürgerlich und materiell. Mein Bruder Robert hat — hatte zwei Söhne, Heinrich und Fritz, für den als zukünftigen Mitinhaber der Fabrik vollkommen gesorgt ist. Sie begreifen, dass die Eltern nicht wünschen, jemand, der ihrem Sohne nahestand, könnte Mangel leiden.“
„Ich leide nicht — ich klage nicht, Herr Gundermann.“
„Aber wie sprachen Sie vorhin von Ihrem Beruf! Sie sagten ‚Beschäftigung‘. Ist es nicht vielleicht pure Notwendigkeit —“
„Gewiss Notwendigkeit, aber auch das beklage ich nicht. Was soll ich denn in aller Ewigkeit mit mir anfangen? Oder halten Sie es auch nur für einigermassen möglich, dass ein fünfundzwanzigjähriges Frauenzimmer sich als pensionierte Witwe zur Ruhe setzt? Und wäre ich als Kind in die Ehe getreten und wüsste nichts von der Welt als Heinrich und hätte nichts angebetet als ihn — nein, Herr Gundermann, die Frage ist doch einfach: Soll Konstanze Gundermann ins Wasser gehen oder weiterleben? Ins Wasser bin ich nicht gegangen, also weiterleben, mit all dem Gepäck von Lastern und Belastungen — ich — und für mich —“
„Konstanze —“ Oskar spricht warm und herzlich. „Ich darf so zu Ihnen sagen. Nicht darum handelt es sich heute. Ihr Leben soll nicht beengt und beschränkt werden. Aber da sind zwei alte Leute, die ihren Sohn beweinen. Und die in derselben Stunde, die ihnen den Sohn nimmt, erfahren, dass sie eine Tochter haben.“
„Nein, Herr Gundermann, die Frage hat Heinrich entschieden. Ich sage Ihnen offen: Hätte er anders entschieden — ich würde mich gar nicht so sehr gesträubt haben. Unser Leben war hart genug, und man hat mehr als einmal heimlich den Wunsch gehabt: so vier Wochen Bürgerlichkeit in warmer, guter Stube. Das hätte mal sehr gut getan; er hat es nicht gewollt.“
„Nun hat er es aber doch gewollt. In dem Augenblick, wo er nicht mehr sorgen konnte — da gab er Ihnen den Weg zur Zuflucht frei.“
„Jetzt aber hat Heinrich keine Macht mehr über mich. Und stützt mich auch nicht. Auch nicht den Eltern gegenüber. Was soll so ein bunter Vogel —,“ und leise: „und ich bleibe ein bunter Vogel, auch in schwarzen Kleidern — im Trauerhaus? Man wird sich anstaunen — zu verstehen suchen, alles wird ersticken in Familienliebe — und so fort. Herr Gundermann — oder ich sage auch, lieber Onkel Gundermann, Sie sind ein herzlich guter Mensch. Und die Eltern Heinrichs sind es gewiss auch. Aber wissen Sie, ob ich es bin? Wozu erst all das Betasten und Beriechen, bis der Konflikt kommt — der jetzt noch nicht da ist?“ Konstanzens Tränen stürzen vor, sie schluchzt ins Taschentuch.
„Sei ruhig, Konstanze,“ sagt Gerhard Stein.
„Aber sag’ du doch dem Herrn, dass es unmöglich ist —“
„Ich finde es nicht unmöglich, Konstanze. Es handelt sich vorläufig um das: Da sind ein paar Menschen in Trauer. Die in Berlin und du hier. Sie trauern um denselben Gegenstand. Und nun setzen sie sich für ein paar Tage oder Wochen zusammen. Das ist alles, was von dir verlangt wird, und mit Recht. Und dann gehst du deiner Wege, wie du es verlangen kannst.“
Konstanze weint und schweigt lange.
Dann sagt sie: „Lassen Sie mir Bedenkzeit! Diese Nacht — morgen werde ich Ihnen darüber Bescheid sagen.“
Oskar Gundermann sucht nun abzulenken.
„Sie sind auch hier engagiert, Herr Stein?“
Oskar glaubt in den tiefgrauen Augen Steins eine Unsicherheit wahrzunehmen.
„Nein, in Hamburg. Aber wir waren alle drei in Breslau zusammen — es ist wohl vier Jahre her. Heinrich als Korrepetitor, ich beim Schauspiel, Konstanze —“ Er stockt.
„Im Chor — sag’s doch, im Chor —“
Oskar hat einen leichten Schwindelanfall zu überwinden.
Konstanze lächelt wie in Erinnerung an eine heitere Zeit.
„Das war gar nicht so schlimm, wie Sie es sich ausmalen. Uebel daran ist nur der Dumme. Wer mit Bewusstsein handelt, kann alles tragen.“
„Nun ja, ich kann verstehen, eine Frau, die zum Ziele kommen will. Ich weiss, Konstanze, und habe in jungen Jahren auch einiges mit dem Theater zu tun gehabt. Es gibt verschiedene Arten, Karriere zu machen.“
Und wieder lächelt Konstanze —
„Nein, Onkel Gundermann, auch das sollen Sie nicht glauben, dass ich mit brennendem Ehrgeiz und mit übertriebenen Hoffnungen zum Theater gegangen wäre. Denn ich habe immer gewusst, was Kunst ist — aber ich habe zu einer gewissen Zeit gesehen, dass eine Frau von gewissem Herkommen, gewissem Charakter und einem — immerhin — gewissen Talent in dem Betriebe der Kunst Unterschlupf findet — so etwa wie ein Jurist von durchschnittlichem Kaliber tausend Unterschlupfe hat —“
„Sind Sie wirklich so durchschnittlich —?“
„Nichts als das. Achtzig Prozent kommen mit irgendeiner kleinen Begabung, die sie über ihre Umgebung stellt, von unten — zwanzig Prozent, die sich aus irgendwelchen Ursachen nicht in ihrem natürlichen Kreis halten können, kommen von oben, und verwenden ein kleines Talentchen, das unter normalen Umständen gerade gereicht hätte, die Freunde im Salon zu unterhalten. Man muss sich eben verwerten. Ich weiss, dass es die Familie lieber gesehen hätte, wenn ich mich an die Schreibmaschine gesetzt hätte. Vielleicht hatte die Familie sogar nicht unrecht, und ich habe kein Wort dagegen sagen mögen, als sie mein Schwesterchen dazu herumkriegten. Aber sehen Sie, Onkel, den Widerspruchsgeist habe ich mit auf die Welt bekommen, und als ich merkte, dass die Familie nicht für mich da ist, sah ich nicht ein, weshalb ich für die Familie da sein sollte.“
Oskar Gundermann sticht eine kleine Neugierde —
„Und die Familie ist etwas so gar Kompaktes?“
„Sie bildet es sich ein. Die Herren und Damen von Distel führen ihren Wert darauf zurück, dass ein Urgrossvater durch ungeheures Sitztalent es mal zum Kabinettsrat Friedrich Wilhelms des Dritten gebracht hat. Dieses Von brachte die Söhne in die Ministerien und Offiziersstellen, die Töchter aber zu anderen armen Bons, deren Urgrossväter auch mal Kabinettsräte waren. In der Familie werden Sie sich vergebens nach einem bedeutenden Kopf umsehen. — Sie werden dann höchstens meinen armen Vater finden — aber der — es ist nicht gut, wenn einer plötzlich alles hat — dann hat er zuviel — aber wir wollen darüber schweigen.“
„Sagen Sie mir eins, Konstanze — wenn ich Sie das fragen darf — nimmt Ihr Vater noch eine Stellung ein?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Er war Oberbaurat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten und ist schon seit fünfzehn Jahren ausser Dienst.“
Es ist spät geworden. Die beiden Herren bringen Konstanze vor ihr bescheidenes Logis.
„Auf morgen —“
Es stellt sich heraus, dass Gerhard Stein und Oskar Gundermann im selben Hotel wohnen. Aber kaum hat Oskar sein Zimmer betreten, als ihm etwas Vergessenes einfällt. Er geht ins Vestibül hinab, um eine Depesche an seinen Bruder aufzugeben:
„Hoffe Konstanze, die Euch gefallen wird, morgen zur Reise nach Berlin zu überreden. Sie ist Tochter eines Oberbaurats a. D. von Distel.“
Als er dem Portier die Depesche übergibt, kommen sie ins Gespräch. Und beiläufig fragt Oskar:
„Herr Stein ist wohl schon seit langer Zeit hier —“
„Seit etwa vierzehn Tagen —“
Nachdenklich steigt Oskar Gundermann die Treppe wieder hinauf.