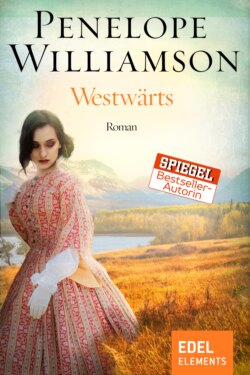Читать книгу Westwärts - Penelope Williamson - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sechstes Kapitel
ОглавлениеClementine blieb unter den lauten Kuhglocken von Sam Woos Laden stehen und wartete, bis sich ihre Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten. An diesem Tag roch es nach geräuchertem Fleisch, neuen Schuhen und Essig, der aus dem Spund eines Holzfasses tropfte.
Sam Woo lehnte über der Theke; zwischen seinen Ellbogen lag der offene Brautkatalog. Der grüne Schirm und die Brille verbargen die obere Hälfte seines Gesichts, aber Clementine sah, daß er den Mund verzog. Möglicherweise lächelte er, möglicherweise zog er aber auch eine Grimasse der Verzweiflung.
»Guten Tag, Mrs. McQueen!« Er wirkte mit dem steifen Papierkragen und den Ärmelschonern aus schwarzem Satin fast so korrekt wie ein Büroangestellter. »Was für eine große, was für eine wundervolle Überraschung!«
Clementine hatte den Verdacht, daß es für Mr. Woo keineswegs eine Überraschung war, sie zu sehen. Denn sobald sie am späten Morgen die Ranch verlassen hatten, war durch einen unsichtbaren Telegrafen die bevorstehende Ankunft von Gus McQueen und seiner jungen Ehefrau in Rainbow Springs angekündigt worden.
»Guten Tag, Mr. Woo«, sagte sie und nickte steif, um einen plötzlichen, peinlichen Anfall von Schüchternheit zu überdecken. »Ich ...«, sie suchte in der Tasche ihrer enganliegenden Schoßjacke. »Ich habe einen Brief aufzugeben, und mein Mann sagt, Sie könnten ...«
»Ihn für Sie abschicken. Aber natürlich, natürlich.«
Sam Woo nahm mit einer schnellen Bewegung den grünen Augenschirm ab und ersetzte ihn durch eine spitz zulaufende blaue Stoffmütze. Er ging in eine Art vergitterten Kasten, der sich an einem Ende der Theke über einem vergilbten Plakat für ›Rosebud Whiskey‹ befand. Clementine schob ihren Brief unter dem Gitter hindurch.
Sie hatte das Gesicht ihrer Mutter in Gedanken vor sich gesehen, als sie ihr am Abend zuvor von Gus, von der Ranch und dem erschreckenden Wunder ›Montana‹ schrieb. Doch sie wußte, nur die Augen ihres Vaters würden ihre Nachricht sehen, denn die Dienstboten hatten Anweisung, alle Korrespondenz zu ihm zu bringen. Vielleicht würde er den Brief lesen. Wahrscheinlicher war, daß er ihn ungeöffnet ins Feuer warf. Sam Woo schob die Brille auf die Nasenspitze und spähte darüber hinweg. Als er die Adresse auf dem Umschlag sah, nickte er und sagte: »Massachusetts, hm? Das wird Sie zwei Dollar kosten.«
»Zwei Dollar!«
»Weiterleitungsgebühren. Jemand muß den Brief nach Helena bringen, damit er auf die Postkutsche in Richtung Osten kommt. Helena und die Postkutsche sind weit weg, Mrs. McQueen.«
»Welcher jemand?«
Er zuckte die Schultern. »Jemand, den ich damit beauftrage.«
»Mr. Woo, Sie sind ein hervorragendes Beispiel für die Habsucht und den Einfallsreichtum der Yankees.«
Er verbeugte sich tief, als habe sie ihm ein Kompliment gemacht. Vermutlich war es das auch, denn bestimmt hatte ihn noch nie jemand als ›Yankee‹ bezeichnet.
Mr. Woo ist ein seltsamer kleiner Mann, dachte sie. Trotz all seiner Bemühungen ist und bleibt er ein Fremder.
Sie waren beide Außenseiter, die nie ganz hierher gehören würden und niemals dorthin zurückkonnten, woher sie gekommen waren.
»Haben Sie sich eine Braut ausgesucht, Mr. Woo?« fragte sie.
Er schüttelte den Kopf. Sein langer Zopf baumelte auf den Schultern hin und her. »Noch nicht, noch nicht. Bald ist es soweit, sobald ich tausend Dollar gespart habe.«
»Das dürfte nicht lange dauern, wenn Sie noch mehr Briefe zur Beförderung bekommen.« Sie schob das Fünfdollarstück unter dem Gitter durch. »Nehmen Sie sich davon Ihre unglaublichen Weiterleitungsgebühren. Und ich möchte noch einiges kaufen.«
Sam Woo biß auf das Goldstück und hielt es dann ans Licht, als fürchte er, es sei Falschgeld. »Woher haben Sie das?«
»Ich habe eine Bank ausgeraubt, bevor ich aus Boston weggegangen bin. Ich hätte bitte gern fünf Pfund Mehl und ein Pfund braunen Zucker. Außerdem brauche ich einen Eimer Schmalz und mehrere Dosen Mais und Tomaten. Frische Eier ...«
»Keine Eier, tut mir leid.«
»Und Milch in Dosen. Ich brauche viel Milch.«
Sie sah an seinen Augen, daß er allmählich begriff, was es mit dem Einkauf auf sich hatte. »Großer Gott, nur das nicht! Weiß Mr. McQueen davon?«
»Noch nicht, aber ich bin sicher, daß es ihm jemand sagen wird.«
»Ich nicht, Madam.« Er schüttelte lachend den Kopf. Sein Lachen war ein weiches, trillerndes Kichern und klang wie das Lachen eines Kindes. »Meine Wenigkeit, dieser bescheidene Chinese, liebt die Indianer nicht, aber er ist auch nicht verrückt, nein, nein ... nur das nicht.«
Er wechselte die Kopfbedeckung und trug nun wieder den grünen Augenschirm des vielbeschäftigten Geschäftsmannes. Er räumte eine fast leere Kerzenkiste völlig aus und packte die gewünschten Dinge hinein, wobei er in einer Mischung aus Englisch und Chinesisch vor sich hin murmelte.
Clementine blickte sich im Laden um und suchte nach Neuzugängen in Mr. Woos buntem Sortiment. Sie sah das übelriechende Bündel Büffelhäute, das sie von Nickel Annies Wagen kannte, Gläser mit Traubengelee, einen gehäkelten Vorleger ...
Als sie über den Faßdaubenboden ging, um sich den Vorleger näher anzusehen, knirschte Asche unter ihren Schuhen. Sie stellte fest, daß der Aschenkasten des bauchigen Ofens überquoll. Offenbar hatte ihn Mr. Woo seit Wochen nicht mehr geleert. Sie würde die Männer nie verstehen: Wie konnten sie sich in manchen Dingen so große Mühe geben, Tag und Nacht schuften und dann in anderen so nachlässig sein?
Sie fand den Vorleger schön. Durch das Gewebe eines Jutesacks waren mit der Häkelnadel Kattunreste in Rot, Gelb und Grün gezogen worden, die einen großen Strauß Frühlingstulpen bildeten. Im Haus ihres Vaters waren die Teppiche alle dick und teuer und hatten unaufdringliche, geschmackvolle Farben. Sie wußte, ihre Mutter hätte den Vorleger wahrscheinlich ›vulgär‹ gefunden, aber Clementine gefiel er.
Sam Woo trat mit der gefüllten Kerzenkiste zu ihr. »Es ist eine gute Sache, Mrs. McQueen, die Sie vorhaben. Aber klug ist es nicht. Die Cowboys haben drüben in Jeremys Mietstall gerade ein Treffen. Sie wollen einen Trupp zusammenstellen und ... jemanden hängen.«
Er übergab ihr die Kiste, und sie schwankte unter dem Gewicht. Sie glaubte, er werde anbieten, sie an ihrer Stelle zu tragen. Aber er kniff die Augen zusammen und zog sich hinter die Theke zurück.
An der Tür blieb Clementine stehen. »Mr. Woo, warum sind Sie nicht bei dem Treffen?«
»Nur das nicht, meine Wenigkeit, dieser Chinese, ist nicht verrückt«, sagte er. Allerdings lachte er diesmal nicht.
Es war ein kühler Tag, obwohl die Sonne bereits hoch am Himmel stand, und Clementine bekam von der Anstrengung, die es bedeutete, mit ihrer Last durch den Schlamm zu waten, schnell rote Wangen. Ihr Atem ging schnell und flach.
Sie blieb stehen, um sich etwas auszuruhen. Die Kiste stellte sie zwischen die knorrigen Wurzeln einer Esche. Ihre Arme schmerzten. Der Schweiß rann ihr über den Hals in das Mieder. Die lange Flanellunterhose klebte feucht an den Beinen und juckte.
Sie sah sich um. Der Hügel mit der hutförmigen Spitze, der dem Regenbogenland seinen Namen gegeben hatte, ragte schroff in den blauen Himmel. Die trockenen Hänge waren übersät mit grauem Geröll, das die Eingänge der Minen kenntlich machte. Die meisten waren aufgegeben. Neben einem der größeren Geröllhaufen erkannte sie eine Tafel mit der gemalten Aufschrift ›Vier Buben‹. Ein verrottetes Holzgeländer umgab ein Loch in der roten Erde und eine baufällige, handbetriebene Förderwinde. Die Mine sah nicht aus, als würde sie in absehbarer Zeit ein Vermögen hergeben.
Ihr Blick wanderte zu dem Wigwam, der fahl in der Frühlingssonne leuchtete. Der Fluß befand sich zwischen ihr und dem Wigwam. Er strömte schnell und laut unter der wackligen Brücke aus Steinen und alten Holzbohlen hindurch, bevor er in einem weiten Bogen um ein Espenwäldchen floß. Jeder in Rainbow Springs konnte sie sehen, wenn sie die Brücke überquerte und auf den Wigwam zuging.
Ein Prickeln lief über ihren Rücken. Clementine drehte den Kopf und blickte über die Schulter zurück. Die morastige Straße lag verlassen. Der Wagen, auf dem sie mit Gus gekommen war, stand einsam vor dem Mietstall. Das zweiflüglige Schiebetor des Schuppens war geschlossen. Gus und Jeremy und die anderen Männer von Rainbow Springs waren alle da drin und planten einen Lynchmord.
Sie wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn, holte tief Luft, hob die schwere Kiste hoch und machte sich wieder auf den Weg.
Clementine bog von der Straße ab und lief einen schmalen Pfad entlang, der durch den kleinen Friedhof der Stadt führte. Die grob gezimmerten Holzkreuze standen mit einer Ausnahme alle schief und waren verwittert. Über dem neuen Kreuz hing ein Paar Stiefel in Männergröße. Sie mußte nicht langsamer gehen, um den eingebrannten Namen zu lesen. Sie wußte, wer dort begraben lag – der Schotte MacDonald, den die Rinderdiebe getötet hatten.
Sie näherte sich der Brücke. Sie hatte inzwischen eine Gänsehaut, als seien die Blätter der Espen tausend zwinkernde Augen, die sie beobachteten. Zach Raffertys schleppende Stimme schien wie eine Kriegstrommel in ihrem Blut zu hallen: ›Die Indianer haben den armen alten Henry in so viele Stücke gehauen, daß man ihn in einem Eimer einsammeln mußte, um ihn begraben zu können.‹ Im Geist sah sie Joe Proud Bear, der durch die Straße galoppierte. Sein Lasso pfiff und zischte durch die Luft ...
Als Clementine auf die Brücke trat, blieb sie mit dem Absatz in einem gespaltenen Balken hängen. Ihr Knie gab nach, und sie wäre beinahe gestrauchelt. Ein merkwürdiger Laut drang aus ihrem Mund. Es klang wie der Todesschrei eines erstickenden Vogels.
Sei nicht albern, ermahnte sie sich. Niemand wird dich am hellichten Tag unter den Augen von ganz Rainbow Springs umbringen.
Sie ging langsam auf den Wigwam zu. Sie konnte das gescheckte Pferd nirgends entdecken und atmete erleichtert auf.
Der Wind hatte sich gelegt. Eine blasse Rauchspirale stieg in die Luft. Die Espen bebten in der Sonne wie silberne Regentropfen. Sie warfen gesprenkelte Schatten auf eine alte Decke aus Büffelhaut, die vor dem Wigwam auf der Erde lag, und auf das kleine Kind, das darauf saß. Clementine blieb am Rand der Decke stehen und versuchte, durch den Spalt in das kegelförmige Zelt zu spähen. Die sonnenverblaßte Büffelhaut war mit eigenartigen Gestalten bemalt.
»Hallo?« rief sie vorsichtig.
Niemand antwortete. Das Kind steckte sich vier Finger in den Mund und blickte mit großen dunklen Augen zu ihr auf.
Clementine stellte die Kiste mit den Lebensmitteln ins Gras und kniete sich neben das Kind. Die Büffeldecke roch unangenehm nach Holzrauch und ranzigem Fett. Über dem Feuer brodelte ein Topf, der an einem Dreifuß hing.
»Na, wie geht es dir, mein Kind?« fragte sie übertrieben freundlich. Es war schwer zu sagen, doch sie vermutete, daß das Kind ein Mädchen war. Sie beugte sich weit vor, bis ihre Nasen dicht beieinander waren, und sah in dem billigen kleinen Spiegel mit einem Papierrücken, der an einem Lederband um den Hals des Kindes hing, ihr eigenes Gesicht. Das Kind hatte dicke Backen, aber einen jämmerlich mageren Körper. Es trug eine lange Hose aus Wildleder und einen blauen Baumwollkittel, der liebevoll mit Glasperlen und gefärbten Stachelschweinborsten verziert war.
»Wo ist deine Mama?« fragte Clementine. Das Kind sah sie an, ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl in einem Augenwinkel eine Fliege kroch. Clementine verscheuchte sie. »Ma-ma«, sagte sie noch einmal.
Das Kind nahm die Finger aus dem Mund und deutete in Richtung Fluß. Clementine richtete sich langsam auf und kämpfte dabei mit ihrem engen, schweren Satinrock.
Die Mutter des Kindes kam mit großen Schritten auf sie zu. Sie trug eine weite Jacke aus rotem Deckenstoff, die ihr bis zu den Knien reichte, und darunter hohe, gefranste Mokassins. Sie waren mit Perlen, Stachelschweinborsten, Elchzähnen und roten Stoffstückchen verziert. Die Mokassins waren schön und noch viel bunter als der Vorleger in Sam Woos Laden. Sie trug einen Ledereimer, aus dem Wasser tropfte.
Als die junge Frau Clementine fast erreicht hatte, blieb sie zögernd stehen. Sie blickte sich schnell um. Ihr langes glattes Haar flog durch die Luft. Es glänzte blauschwarz in der Sonne.
»Was wollen Sie?«
»Ich habe Dosenmilch für Ihr Baby gebracht.«
Die Indianerin ging an Clementine vorbei und stellte den Eimer am Feuer ab. Ihr Gesicht war ausdruckslos.
»Es ist gestorben.«
»Oh ... das tut mir sehr leid.« Es klang oberflächlich und sinnlos. Doch Clementine wußte nicht, was sie sonst hätte sagen sollen.
Die junge Frau zuckte die mageren Schultern, aber Clementine sah den Schmerz in ihren Augen. »Mein Mann würde Sie hier nicht sehen wollen«, sagte sie leise.
Clementine nickte. Sie bekam plötzlich vor Angst einen trockenen Mund. Sie machte einen Schritt zur Seite und stieß dabei gegen einen Pfahl des Dreifußes. Der Topf schwankte, und etwas von der Flüssigkeit schwappte ins Feuer. Im Topf kochte ein dicker Eintopf mit viel Fleisch. Sie hoffte um Joe Proud Bears willen, daß es sich um Wild handelte.
Clementine blickte auf und stellte fest, daß die Indianerin sie mißtrauisch ansah. »Warnen Sie Ihren Mann. Er soll aufhören, mit Iron Nose zu den Rinderherden zu reiten, sonst werden sie ihn fangen und hängen.«
Die dunklen Augen der jungen Frau wurden groß. »Joe hat diesen weißen Mann nicht umgebracht, und sein Vater war es auch nicht. O ja, sie stehlen vielleicht hin und wieder ein paar Rinder, aber ...«
Ihr Kopf fuhr herum, denn man hörte Pferdegetrappel. Das gescheckte Pferd tauchte zwischen den Espen auf, durchquerte den Fluß direkt an der Biegung. Funkelnde Wassertropfen spritzten in der Luft.
Die Indianerin faßte Clementine am Arm und schob sie in Richtung Brücke. »Gehen Sie.«
Clementine kam nicht weit. Der Indianer hatte sie schnell eingeholt. Er brachte das Pony mit einem heftigen Ruck der Zügel zum Stehen. Dabei bespritzte es Clementines Rock mit Schlamm. Er sprang aus dem Sattel und versperrte Clementine den Weg. Seine Frau rief ihm etwas zu. Er schrie in seiner harten, gutturalen Sprache etwas zurück. Clementine blieb wie angewurzelt stehen. Der Mann wirkte an diesem Tag noch mehr wie ein Wilder. Er trug Knochen auf der Brust und hatte sich mit Fettfarben die Stirn und die Wangen in roten und ockergelben Streifen bemalt. Die Kupferarmreifen glühten in der Sonne wie Feuer. Er war sehr jung, doch er hatte das zornige und haßerfüllte Gesicht eines alten Kriegers.
Er starrte Clementine mit funkelnden dunklen Augen an, zu denen die langen, dichten Wimpern, die eher zu einem jungen Mädchen gepaßt hätten, einen seltsamen Gegensatz bildeten. Clementines Magen krampfte sich zusammen, und ihr Mund wurde trocken.
»Ah, die weiße Frau macht einen Höflichkeitsbesuch, wie?«
Seine Frau streckte ihm die Hand entgegen, als flehe sie ihn an, sie zu verstehen oder ihr zu vergeben.
»Joe, nicht ... sie hat Milch für das Baby gebracht.«
Er lachte hart und bitter und musterte Clementine mit zusammengekniffenen Augen. Er bewegte die Lippen so heftig, daß die Federn auf seinem Kopf zitterten. Er beugte sich weit vor und spuckte auf ihr Mieder.
»Das ist für Ihre Wohltätigkeit.«
Clementine konnte nur dastehen und zittern. Die Stelle, wo die Spucke sie getroffen hatte, brannte, als habe er durch alle Schichten ihrer Kleider hindurch die nackte Haut getroffen.
Er verzog den Mund zu einem bösen Lächeln. Er beugte sich noch einmal vor, so weit, daß sie ihn roch – Holzrauch und ranziges Fett, wie die Decke aus Büffelhaut. Er hob die Hand. Sie richtete sich auf und wurde starr wie ein Pfahl. Er griff nach einer Locke ihrer Haare, die unter der Hutkrempe hervorsah. Sie zuckte zusammen, als er sie zwischen die Finger nahm und dabei leise, seltsame Geräusche von sich gab.
»Hübsche Haare, weiße Frau. Wie sonnengereiftes Gras. Es würde sich gut als Schmuck an meiner Kriegskeule machen.«
Sie wich so abrupt zurück, daß sie beinahe gefallen wäre, und er lachte. In diesem Augenblick kam ihr die strenge Erziehung ihrer Kindheit zu Hilfe. Sie ließ sich nicht aus der Fassung bringen, auch nicht von diesem Wilden, sondern hob stolz das Kinn und wandte ihm den Rücken zu. Sie versuchte, so würdevoll wie möglich zu gehen, obwohl sie in Wirklichkeit davonrennen wollte.
Hannah Yorke saß in ihrem geflochtenen Schaukelstuhl auf der Veranda des weißen Hauses und sah den Wolken nach, die über die große blaue Leere des Himmels von Montana segelten. Der Wind war ausnahmsweise nur ein leiser Hauch, der das Espenlaub bewegte. Zum ersten Mal in diesem Jahr lag die Wärme des Sommers in der von der Sonne durchfluteten Luft.
Sie trug an diesem Nachmittag ein Kleid, das so glühendrot war wie der Klatschmohn im Frühling. Leise summend, legte sie die Hände in den Schoß und genoß das Gefühl der glatten, gerippten Seide auf der Haut und freute sich über das leuchtende Rot. In der Bergarbeiterstadt in Kentucky, wo sie aufgewachsen war, hatte jahrein, jahraus eine dicke Rußschicht über allem gelegen. Erst als sie von zu Hause wegging, stellte sie fest, daß die Welt nicht nur aus Grautönen bestand.
Hannah hob die Hände über den Kopf und gähnte. Sie war etwas träge nach den letzten Tagen im Bett. Bei dem Gedanken an den Cowboy lächelte sie wehmütig. Sie würde es bestimmt bedauern, ihn zum Liebhaber genommen zu haben. Aber noch war es nicht soweit – nicht heute. Sie war ein wenig traurig, denn wenn er sie liebte, brachte er sie dazu, alles zu vergessen. Aber es war eine gute Art von Traurigkeit. Hannah war so lange unglücklich und unzufrieden mit der Welt gewesen. Und vor allem so verdammt einsam.
Von ihrem Schaukelstuhl auf der Veranda konnte sie Rainbow Springs überblicken. Sie beobachtete, wie sich die Männer in Jeremys Mietstall versammelten, und wußte, was sie vorhatten. Sie kamen einzeln und warfen schnell einen Blick über die Schulter, ehe sie in dem Schuppen verschwanden.
Es gefiel den Männern, ihre albernen Spiele zu spielen und sich wichtig vorzukommen. Diese Männer waren eigentlich alle noch Kinder, aber sie glaubten, sie seien richtige Männer.
Hannah Yorke kannte sie gut. Die meisten grüßten die Hure, wenn sie ihr auf der Straße begegneten. Einige wenige taten es nicht.
Wenn Rainbow Springs wuchs und immer mehr von seiner Bedeutung als eine ordentliche Stadt erfüllt war, würde auch die Zahl der Einwohner wachsen, die sich zu fein vorkamen, um die Hure zu grüßen. Eines Tages, das wußte Hannah, würde sie hier nicht mehr erwünscht sein.
Hannah sah Gus McQueen und seine Frau auf dem Wagen in die Stadt kommen. Mrs. McQueen trug die Art Kleid, in der man Leichen aufbahrte. Es war ein teures Sonntags-Ausgehkleid. Der graue Satin war von bester Qualität und mit Besatz und Schleppe aus burgunderfarbener Ripsseide. Man brauchte ein Fälteleisen, und es kostete Stunden, so viele Falten in einen Rock zu bügeln. Hannah beobachtete, daß die junge Frau in Sam Woos Laden ging. Dabei fielen ihr die eleganten geknöpften Lederschuhe auf, als sie die Schleppe hob, und der schlichte schwarze Filzhut, der genau mit der richtigen Neigung auf ihrem Kopf saß. Diese Mrs. McQueen hielt sich so gerade, als habe sie einen Besenstiel verschluckt. Doch um der Wahrheit die Ehre zu geben, sie hatte etwas Würdevolles an sich, das Hannah liebend gerne auch besessen hätte.
O ja, Mrs. McQueen war eine vierzehnkarätige Dame. Hannah war nicht ganz sicher, aber sie glaubte, die junge Frau zu hassen. Sie bestand nur aus Förmlichkeit, guter Herkunft und besten Manieren.
Etwa zehn Minuten später kam Mrs. McQueen aus dem Laden heraus. Sie trug eine schwere Kiste, die mit blauen Dosen gefüllt war. Dosenmilch?
Hannah stellte den Fuß fest auf, um den Schaukelstuhl anzuhalten, und setzte sich gerade. Sie sah, daß die Frau von Gus McQueen aus der Stadt hinaus, über den Friedhof zur Brücke und zum Wigwam der Indianer auf der anderen Seite des Flusses ging. Man mußte tollkühn sein, um, nur mit Dosenmilch bewaffnet, allein in ein Nest von Viehdieben zu marschieren.
Als Joe Proud Bear zwischen den Bäumen hervorgaloppierte, sprang Hannah erschrocken auf. Instinktiv wollte sie einen Warnschrei ausstoßen, aber es gelang ihr gerade noch, ihn zu unterdrücken. Sie war nicht so dumm, sich in eine solche Sache einzumischen. Außerdem hatte es dieses vornehme Ding verdient, daß ihr der Indianer einen gewaltigen Schrecken einflößte. Wie konnte man auch nur so dumm sein?
Trotzdem atmete Hannah erleichtert auf, als sie sah, daß Mrs. McQueen das Lager unversehrt verließ und mit den feinen Lederschuhen würdevoll und zielstrebig durch den roten Schlamm kam. Am Boot Hill blieb sie lange Zeit stehen. Sie zog ein Taschentuch hervor und wischte sich damit das Oberteil ihres Kleides ab. Hinterher ballte sie das weiße Batisttuch zusammen und warf es in hohem Bogen weg, als sei es beschmutzt. Sie strich sich die blonden Haare glatt und näherte sich mit langsamen, gemessenen Schritten der Stadt.
Hannah wußte nicht genau, was sie dazu veranlaßte, daß sie auf dem hölzernen Gehsteig vor ihrem Gartentor stand und darauf wartete, daß Gus McQueens vornehme Frau an ihr vorbeiging. Hannah hatte schon vor langer Zeit begreifen müssen, was es bedeutete, eine Hure zu sein und ein Leben am Rand der Gesellschaft und Legalität zu führen. Sie hatte sich schließlich damit abgefunden, diesen Preis zu zahlen. Nur ein Schwachkopf würde glauben, die Welt habe sich geändert, weil sie an diesem Morgen ausnahmsweise einmal glücklich aufgewacht war.
Mädchen zur Unterhaltung, leichtes Mädchen, Freudenmädchen, jedermanns Mädchen.
›Wie geht's, bestellen Sie mir etwas zu trinken, Mister?‹
Wenn die Nacht angenehm und er nett ist, überläßt du dich vielleicht dem Traum, und sei es auch nur einen Augenblick lang, du seist das Mädchen eines Mannes, der dich liebt.
Hannah Yorke machte sich deshalb vorsichtshalber darauf gefaßt, daß die junge Frau angesichts der Schande, die die Anwesenheit der sündigen Hannah Yorke darstellte, entsetzt die Röcke heben und davonrauschen werde.
»Guten Tag, Mrs. McQueen.«
»Guten Tag, Mrs. Yorke«, erwiderte Clementine ruhig und höflich. Hannah staunte. Die ehrbare Dame meinte das offenbar auch noch ehrlich. Wußte sie nicht, daß Hannah so wenig eine echte Witwe war wie ein Ring von der Losbude auf dem Jahrmarkt echtes Gold enthielt? Mrs. Yorke gehörte jedem Mann und keinem.
Plötzlich stellte Hannah fest, daß sie nicht recht wußte, was sie als nächstes tun sollte. Sie konnte kaum eine Dame wie Mrs. McQueen zum Tee ins Haus bitten.
O Hannah, daß der Cowboy so gut im Bett war, muß dir den Verstand geraubt haben ...
Es war absolut lächerlich zu glauben, sie könnte die Bekannte dieser jungen wohlerzogenen und respektablen Frau werden.
Doch an diesem Tag hatte Hannah Mut. Irgendwie war alles anders. Der verrückte Cowboy war daran schuld. Wie auch immer, sie wollte wissen, wie es war, sich mit einer echten Dame wie Mrs. McQueen zu unterhalten. Vielleicht würde sie sich dann selbst eher wie eine Dame Vorkommen, so wie eine Silbermünze, die man in der Hand hielt, einem das Gefühl geben konnte, reich zu sein.
»Ich habe gesehen, was Sie gerade getan haben«, sagte Hannah und versuchte es mit einem Lächeln. »Das war sehr nett von Ihnen.«
Die schön geschwungenen Augenbrauen auf der hohen Stirn zogen sich zusammen. »Ich bin zu spät gekommen. Das Kind ist tot.«
In diesem Augenblick beschloß der Wind, wieder zu wehen. Eine Böe fuhr über sie hinweg, zerrte an den Baumwipfeln und versuchte, den Hut vom Kopf der jungen Frau zu reißen. Sie hielt ihn mit einer Hand fest; bei dieser Bewegung rutschte der Ärmel nach oben und enthüllte ihr zartes Handgelenk. Voll Neid sah Hannah, daß ihre Haut blaß und makellos glatt war.
»Sie halten sich besser von Joe Proud Bear fern«, riet ihr Hannah, und es klang fast vorwurfsvoll. »Er haßt alle Weißen.«
»Es heißt, er schließt sich seinem Vater an und sie stehlen Rinder.«
Hannah zuckte die Schultern. Gus McQueen und Rafferty verkauften die meisten ihrer Rinder an die Regierung. Die Regierung hatte es übernommen, Fleisch kostenlos an die Indianer in den Reservaten zu verteilen. Doch jeder wußte, daß nur ein Drittel der an die Agenten der Regierung verkauften Rinder in die Mägen hungriger Rothäute wanderte. Die Rancher bekamen ihr Geld, die Agenten nahmen sich ihren Teil, und den Indianern blieb von dem wenigen, was übrig war, ein Drittel. Sie hatten Land, auf dem nicht viel wuchs und wo ihnen verboten war zu jagen. Es war nicht gerecht, aber so war eben das Leben.
Mrs. McQueens düsterer Blick richtete sich auf den Wigwam. Sie hatte seltsame Augen, so graugrün wie das Meer. In diesen Augen gab es unsichtbare, geheimnisvolle Tiefen.
»Sie treffen sich gerade im Mietstall«, sagte Hannah. »Sie wollen den jungen Mann aufhängen. Sie wollen alle aufhängen, wenn sie die Indianer beim Rinderdiebstahl erwischen.«
Und Ihr Gus wird ganz vorne reiten und den Trupp anführen, dachte Hannah und schwieg. Ihr war es gleichgültig, was mit den Indianern geschah. Es hätte Mrs. McQueen ebenfalls gleichgültig sein sollen. Aber richtige Damen wie Mrs. McQueen konnten es sich offenbar leisten, nett zu sein.
»Joe Proud Bear weiß, was er riskiert. Wenn ein Mann unbedingt ertrinken will, findet er selbst in der Wüste die Möglichkeit dazu«, fügte Hannah nach einer kurzen Pause hinzu.
»Aber was soll seine Frau dann tun? Sie hat das Kind und ist noch so jung. Sie ist beinahe selbst noch ein Kind.«
»Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Squaw. Sie ist nicht so zart, wie sie aussieht. Und ich wette, daß sie kaum jünger ist als Sie.«
Die graugrünen Augen richteten sich auf Hannah. »Und wie alt sind Sie?«
Die Frage verblüffte Hannah so sehr, daß es ihr einen Augenblick den Atem verschlug. Sie spürte, wie sie die Lippen zusammenpreßte und sich die Falten um den Mund tiefer eingruben. Sie spürte, wie ihre Haut schlaff wurde und die Sonne die winzigen Fältchen um die Augen hervortreten ließ. Sie hatte das Gefühl, daß all das, was jeder Mann, jede Enttäuschung, jedes gebrochene Versprechen in ihr zurückgelassen hatten, wie Schweißtropfen, wie Tränen auf ihrem Gesicht zu sehen war, damit die junge Frau, dieses Mädchen, sie verhöhnen und bemitleiden konnte. Das Mitleid war am schlimmsten von allem.
Sie erwiderte mit ihrem liebenswürdigsten Lächeln: »Ich bin erst neunundzwanzig, deshalb interessiere ich mich noch nicht für den Friedhof. Und wenn es darum geht, einen Mann zufriedenzustellen ... es gibt Leute, die sagen, ein begabter Mund ist einem jungen Ding allemal überlegen.«
Hannah erwartete, die junge Frau werde über ihre schockierende, ordinäre Bemerkung entsetzt sein. Aber Mrs. McQueen war so verdammt unschuldig, daß sie wahrscheinlich genausoviel verstanden hätte, wenn Hannah chinesisch gesprochen hätte. Sie sah Hannah ruhig mit ihren geheimnisvollen, unergründlichen Augen an. Dabei hatte Hannah plötzlich das unangenehme Gefühl, als könnte die junge Frau mehr sehen, als Hannah ihr zeigen wollte, womöglich mehr, als Hannah selbst sah.
»Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, so unhöflich zu sein«, sagte Mrs. McQueen. »Es ist nur so, daß die Leute hier älter zu sein scheinen, als sie aussehen.«
Das liegt daran, daß das Leben in der Wildnis jeden schnell alt werden läßt, dachte Hannah. Das Altwerden fängt im Herzen an. Das Herz kann tot und begraben sein, noch ehe man dreißig ist. Hannah lief ein Schauer über den Rücken. Diese junge Frau brachte sie auf merkwürdige Gedanken.
»Sie sollten gehen, Mrs. McQueen. Rainbow Springs mag zwar keine ehrenhafte Stadt sein, aber sie hat auch ihre Regeln. Man sollte nicht sehen, daß Sie mit jemandem wie mir reden.«
»Ich rede, mit wem ich will«, erwiderte Mrs. McQueen, und obwohl das kindisch und naiv war, hatte ihr Kinn dabei etwas Eigenwilliges, das Hannah überraschte. Sie sah die junge Frau plötzlich mit anderen Augen und überlegte, ob sie sich vielleicht ein falsches Bild von ihr gemacht hatte.
Sie war eigentlich keine klassische Schönheit. Auffallend waren nur ihre Augen, die weit auseinanderstanden und erstaunlich groß waren. Und der Mund – eine volle, etwas kleinere Oberlippe, die nicht ganz mit der sehr sinnlichen aufgeworfenen Unterlippe zusammentraf. Die porzellanhafte Zerbrechlichkeit und das Rühr-mich-nicht-an-Benehmen standen eindeutig im Widerspruch zu diesem Mund. Mit diesem Mund konnte man auf dem Strich in Deadwood ein Vermögen verdienen.
Im Augenblick schien dieser Mund etwas sagen zu wollen, hatte aber so große Mühe, es hervorzubringen, daß Hannah lächeln mußte.
»Ich überlege, Mrs. Yorke ...« Sie brach ab, holte tief Luft und begann noch einmal. »Das heißt, wäre es möglich, falls es Ihnen nicht zu große Umstände macht ... würden Sie mir erlauben, Sie irgendwann einmal zu photographieren?«
Das Lächeln verschwand von Hannahs Gesicht. Von Nickel Annie wußte sie, daß Gus McQueens junge Frau einen ganzen Koffer voll photographischer Ausrüstung mitgeschleppt hatte, doch sie hatte es nicht geglaubt. Oh, sie konnte sich gut die reichen, vornehmen Eltern von Mrs. McQueen vorstellen, wie sie mit morbider Neugier ihr Bild betrachteten.
›Liebe Mama, lieber Papa! Es gibt viele arme, gefallene Frauen wie sie hier im Westen. Sie nennen sich leichte Mädchen, und sie sind eine Schande für unser ganzes Geschlecht, das sie entehrt haben.‹
Hannah richtete sich auf und sah die junge Frau wachsam und mißtrauisch an. »Weshalb wollen Sie mich photographieren?«
»Sie haben ein interessantes Gesicht.« Sie lächelte. »Guten Tag, Mrs. Yorke. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern. Vielleicht können wir uns bald einmal Wiedersehen.«
Hannah war sprachlos. Sie konnte nur nicken, als Mrs. McQueen die Schleppe hob und auf dem Holzsteg davonging. Ihr Satinrock raschelte leise, und die Absätze klickten gemessen. Ja, so bewegte sich eine Dame. Nach ein paar Schritten drehte sie sich jedoch plötzlich um und kam zurück. Sie hielt ihren Hut fest, damit der Wind ihn nicht davontrug.
»Haben Sie Spaß an Ihrem Klavier?« rief sie über das Rauschen der Blätter hinweg.
Hannah schluckte, als müsse sie verhindern, daß ein Stein in ihrer Kehle nach oben stieg. »Ich habe noch niemanden gefunden, der spielen kann. Shiloh, mein Barmann, spielt nur die Fiedel.«
»Mein Vater war der Meinung, daß Musik, Tanzen und Singen den Charakter verdirbt und zu Weltlichkeit und Sünde führen kann. Aber ich würde Ihr neues Klavier gerne einmal hören. Ja, ich würde es wirklich gerne hören, Mrs. Yorke.«
Sie drehte sich um und ging mit anmutigen, damenhaften Schritten zu Sam Woos Laden.
Hannah mußte lachen, denn sie stellte sich plötzlich vor, wie sie einen musikalischen Nachmittag im ›Best in the West‹ veranstaltete, über dessen Schwelle keine ehrbare Frau jemals einen Fuß gesetzt hatte. Sie würde Spitzendeckchen auflegen und Ingwergebäck und Limonade servieren; die Damen würden alle die Hüte auf- und die Handschuhe anbehalten, mit kleinen Schlucken Tee aus zierlichen Porzellantassen trinken und höflich klatschen, wenn der Pianist ein Musikstück beendet hatte. Natürlich dürfte es nichts Frivoles sein, nein, nein, das würde zu weit gehen, sondern etwas Ernstes und Erhebendes.
Hannah stellte plötzlich fest, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten. Irgend etwas blieb ihr im Hals stecken; es schmerzte.
Aber tief im Herzen war plötzlich ein neues Gefühl, eine Mischung aus Traurigkeit und Glück. Es dauerte einen Augenblick, bis sie begriff, daß es Hoffnung war.
»Ich habe dir schon einmal gesagt, Cowboy, das kleine Biest gehört in den Stall.«
Rafferty rekelte sich auf dem Stuhl. Er legte die Stiefel mit den Sporen auf der Tischplatte übereinander, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und grinste unter der Hutkrempe. »Es gibt hier alle möglichen kleinen Biester. Hast du ein bestimmtes im Sinn?«
»Das vierbeinige.«Hannah deutete auf das braunweiße Kalb, das mit gespreizten Beinen dastand und aussah, als werde es im nächsten Augenblick den Fußboden des Saloons wässern. Die kleine Patsy hatte ein Bein über seinen Rücken geschwungen und versuchte, es zu reiten.
»Hab doch ein Herz, Liebling«, sagte Rafferty. Seine tiefe Stimme und der schleppende Tonfall zeigten ihn unverwundbar gegen ihre Argumente. Der Whiskey schenkte seiner Zunge noch mehr Sicherheit. Mit den Bartschatten auf den Wangen und den langen dunklen Haaren, die lockig über seinen Kragen fielen, wirkte er gefährlich, aber leider auch unwiderstehlich. Das wußte er. »Das arme kleine Kälbchen hat sich so einsam in deinem Stall gefühlt, in dem nicht einmal ein Karrengaul steht, um ihm Gesellschaft zu leisten.«
»Shiloh wird noch kündigen, weil ich ihm gesagt habe, er muß dem Kalb die Mutter ersetzen, mit dem Lutschbeutel und weiß Gott noch was.«
Rafferty legte den Kopf zurück und blickte von unten zu dem Barmann, der hinter der Theke stand und Gläser abtrocknete. »Das macht ihm doch nichts aus oder, Shiloh?«
»Nein, Sir. Es macht mir nichts aus. Solange man sich um das Kleine kümmert, ist es keine Last.«
Raffertys Kopf fiel wieder nach vorne, und er lachte zufrieden.
Hannah ballte die Hände zu Fäusten, um sich gegen das Lachen zu wehren. Es war so schön wie Gold und genauso verführerisch, um es besitzen zu wollen.
Was würdest du damit tun, du sentimentale Närrin, fragte sie sich ärgerlich. Soll ich es zusammen mit den Blumen von der Hochzeitstorte unter dem Glassturz aufbewahren?
Doch er lümmelte sich groß und schlank auf dem Stuhl und lächelte sie unbekümmert an. Wieder überkam sie das eigenartige weiche Gefühl, und die Welt erschien ihr plötzlich hell, jung und verheißungsvoll.
Hannah versuchte fast in Panik, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Sie würde es sich nie verzeihen, wenn sie sich in den Cowboy verliebte.
»Wenn das kleine Biest in meinen Saloon pinkelt, Zach, dann bringe ich dir den Putzlappen und den Eimer.« Sie drehte sich gespielt wütend um und brachte schnell die Theke zwischen sich und den großen Cowboy mit dem übermütigen Lächeln. Sie zog die Geldschublade auf und gab sich den Anschein, als zähle sie die Einnahmen des Vortags, obwohl sie sich im Grunde überhaupt nicht dafür interessierte. Sie wußte, Shiloh würde sie niemals betrügen.
Hannah spürte den erstaunten Blick des Barmanns auf sich gerichtet, und ihr entging auch nicht, daß es um seine Mundwinkel zu zucken begann. Er wußte natürlich, wo sie die letzten drei Tage und Nächte gewesen war, was sie getan hatte und warum. Sie und Shiloh waren seit Deadwood zusammen, und er kannte sie in- und auswendig. Manchmal gelang es ihr, sich selbst etwas vorzumachen; bei Shiloh schaffte sie das nie.
Sie warf ihm einen Blick zu, der, wie sie hoffte, glühend genug war, um Speck zu braten. »Sag es nicht.«
Er hielt ein Glas ans Licht, blies darauf und polierte es. »Schönes Wetter haben wir heute, Miss Hannah. Die Sonne scheint, scheint immer länger, und der Schlamm wird im Handumdrehen trocknen. Wahrscheinlich wird das Geschäft dann bessergehen.«
Sonne hin, Sonne her, zur Zeit kamen nur wenige Männer in den Saloon. Selbst der Berufsspieler war entweder zu fetteren Weidegründen gezogen, oder er schlief irgendwo seinen Rausch aus. Hannah kam gerade zu dem Schluß, daß im Augenblick niemand in Rainbow Springs unternehmungslustig genug sei, um in ihren Saloon zu kommen, als die Tür des Hinterzimmers aufging. Ein übler Geruch drang heraus, dem der Schafhirte folgte. Er knöpfte seine Hose zu und murmelte wie immer vor sich hin. Dicht hinter ihm erschien Saphronie. Sie starrte auf den Boden und hielt den zusammengeknüllten Schleier in der Hand, den sie üblicherweise vor dem Gesicht trug.
Ohne die Tätowierung wäre sie eine ganz normale junge Frau gewesen. Ihre Haare und Augen waren so braun wie das Fell von Präriehunden. Sie hatte eine blasse, fast mädchenhafte Haut. Doch die Tätowierung – vier dunkelblaue Tropfen, die sich von der Unterlippe bis zur Kinnspitze zogen – verlieh ihr eine Häßlichkeit, die eigenartigerweise fast schon wieder an Schönheit grenzte. Es fiel schwer, Saphronie nicht anzusehen.
Saphronie hielt den Blick auf die Schuhe gerichtet, während sie langsam drei Silberdollar auf die Theke legte. Die schweren Münzen klirrten auf dem zerkratzten Holz. Hannah warf eine in die Geldschublade. Wenn ein Mädchen mit einem Mann ins Hinterzimmer ging, behielt es zwei Dollar für sich, und Hannah bekam einen Dollar als Miete.
Es war eine bessere Abmachung, als die meisten Saloons sie mit ihren hübschen Bedienungen trafen. Dafür verlangte Hannah, daß sich die Mädchen an ihre Regeln hielten. Wer versuchte zu betrügen, wurde auf der Stelle entlassen. Und sie stellte niemals eine Jungfrau ein. Die Frauen konnten verwitwet, geschieden oder gefallen sein, aber ein niedliches junges Ding, das seine Unschuld verlieren wollte, mußte das woanders als im ›Best in the West‹ tun. Außerdem durften die Frauen nicht trinken. Wenn ein Mann einem Mädchen etwas zu trinken bezahlte, bekam es kalten Tee, der sah genauso aus wie Whiskey, aber sie blieben nüchtern. Nichts war erbärmlicher als eine saufende Hure.
Hannah sah Saphronie aufmerksam an, aber nicht wegen der Tätowierung. Die heruntergezogenen Mundwinkel und die tiefen Schatten unter den Augen sagten deutlich genug, wie es dem Mädchen zumute war. Hannah goß einen doppelten Whiskey ein und drückte Saphronie das Glas in die zitternde Hand. Saphronie ging nicht allzu häufig ins Hinterzimmer, und jedesmal, wenn sie es tat, war es für sie wie eine Vergewaltigung. Sie mußte sich wie eine abgetakelte Hure an die widerlichsten Männer verkaufen – Maultiertreiber, Trapper und Wolfsjäger. Hannah hatte Saphronie eingestellt, um den Saloon sauberzuhalten; das andere war ihre freie Entscheidung. Aber Saphronie mußte drei Tage putzen, um soviel zu verdienen, wie ihr zehn Minuten im Hinterzimmer einbrachten.
Ihr Problem bestand darin, daß sie sehr lange brauchte, um über ihre Scham- und Schuldgefühle hinwegzukommen. Saphronie trank den Whiskey in zwei Zügen und starrte auf die Flasche. Hannah seufzte und goß ihr noch etwas ein. Wenn sie so weitermachte, verschenkte sie an Whiskey, was sie gerade als Miete eingenommen hatte.
»Hat er dir weh getan, Liebes?« fragte sie sanft.
Saphronie schüttelte den Kopf. Sie trank einen Schluck, und ihre Zähne schlugen gegen das Glas. »Er hat mir die ganze Zeit ins Gesicht gestarrt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und hinterher hat er gesagt ...« Ihre Lippen zitterten. Sie preßte die Faust an den Mund und verdeckte dabei auch die Tätowierung. »Er hat gesagt, er hätte es noch nie mit einem Monster gemacht.«
Hannah tätschelte ihr den Arm. Aber sie kam sich sofort dumm vor und wurde verlegen. »Niemand zwingt dich, mit solchen Männern ins Hinterzimmer zu gehen.«
»Solche Männer sind die einzigen, die mich haben wollen.« Saphronie blickte auf ihre Tochter, die es gerade geschafft hatte, auf das Kalb zu klettern, wenn auch verkehrt herum. Das Kalb hob den Kopf und muhte. Saphronies Gesicht hellte sich auf, und sie lächelte. »Ich muß der kleinen Patsy ein besseres Leben ermöglichen.«
Hannah seufzte wieder. Die kleine Patsy ... Sie war süß und hübsch wie ein Engel, aber leider das Ergebnis eines Besuchs im Hinterzimmer, wie der, von dem ihre Mutter gerade zurückkam. Saphronie konnte hoffen und huren, vielleicht auch ein wenig sparen, doch für die kleine Patsy würde es nie etwas Besseres geben. Das arme Kind würde ihr Leben da beenden, wo es begonnen hatte: im Hinterzimmer eines heruntergekommenen Saloons in einer namenlosen staubigen Stadt.
Hannah sagte sich gerne vor, das ›Best in the West‹ sei eine Stufe besser als andere Lokale dieser Art. Sie hatte sich große Mühe gegeben, es gemütlich zu machen und sich hübsche Dinge einfallen lassen, wie die Zirkusplakate an den Wänden und die Spucknäpfe aus richtigem Porzellan. Für die meisten Männer in der Gegend war es in gewisser Hinsicht das einzige Zuhause, das sie kannten. Sie benahmen sich auch so. Sie kamen frisch gewaschen und ließen sich die Haare schneiden, um im Saloon einen zu trinken, mit einem der Mädchen zu tanzen oder, wenn sie es sich leisten konnten, ins Hinterzimmer zu gehen.
Aber der Teil von Hannahs Wesen, der sich nicht belügen ließ, wußte, was billig und schäbig und sündig war. Sie hatte arme, aber rechtschaffene Eltern gehabt. Das wenige, das sie besaßen, war immer sauber und gepflegt. Hannah Yorke war damals ebenfalls innerlich und äußerlich sauber. Sie würde nie die erste Nacht vergessen, die sie nicht zu Hause, sondern in einem schmuddeligen Gasthaus in Franklin verbrachte. Mein Gott, sie hatte Wanzen im Bett gefunden und wäre am liebsten gestorben. Sie saß später dann die ganze Nacht auf einem Stuhl und schämte sich darüber, wie tief sie gesunken war. Damals wußte sie nicht, daß es noch tiefer abwärts ging und daß sie den Weg dorthin finden würde.
Etwa in ein schäbiges Zimmer in dem Bordell von Deadwood, wo der Name ›Rosie‹ in das Holz über der Tür eingebrannt war. In einer Ecke stand ein Bett, in einer anderen ein Ofen, und daneben lag ein Bündel Anmachholz. An der Wand aus Baumstämmen stand eine kleine Kommode mit einer Waschschüssel. Die andere Wand bestand nur aus einer Segeltuchbahn, die ihr Zimmer vom nächsten trennte. Das Zimmer war heiß im Sommer und kalt im Winter, und es stank das ganze Jahr hindurch nach Haaröl, billigem Eau de Cologne und Sex.
An den meisten Tagen trug sie nichts außer einem grellbunten Morgenmantel. Am Fuß des Bettes lag eine alte rote Decke, die sie beim Schlafen über sich zog. Tagsüber legte sie ein Stück Wachstuch darüber, um zu verhindern, daß ihre Freier die Decke mit den Stiefeln schmutzig machten. Die Männer, die zu ihr kamen, zogen nie die Stiefel aus. Sie zogen überhaupt nichts aus, sondern nahmen nur die Hüte ab und nannten sie immer ›Madam‹.
›Wie geht es Ihnen, Madam? Woher kommen Sie, Madam? Ich hätte es gerne so, Madam. Wenn Sie bitte ...‹
Am frühen Nachmittag, bevor die Männer kamen, lag sie auf dem Bett und starrte auf die Dachbalken, die Wasserflecken hatten und mit Spinnweben überzogen waren. Heiße, salzige Tränen stiegen in ihr auf, quollen aus den Augenwinkeln und liefen ihr in die Ohren.
Ich werde nicht weinen, sagte sie sich immer und immer wieder, bis sie eines Tages tatsächlich nicht mehr weinte.
Sie wurde so müde, so müde und hatte kaum noch die Kraft aufzustehen und sich zwischen den einzelnen Männern zu waschen.
Wenn nicht dieser alte verrückte Goldsucher gestorben wäre und ihr seine Ledersäckchen voll mit Goldstaub vermacht hätte, wäre es ihr in dem letzten Winter in Deadwood bestimmt gelungen zu sterben.
Doch wenn sie sich jetzt im Saloon, in ihrem Saloon umsah, empfand sie eine Art wehmütigen Stolz auf die roten Lampen, die Porzellanspucknäpfe, das Klavier, das stumm die weißen und schwarzen Zähne bleckte, weil niemand spielen konnte, die angegilbten Plakate und die Hirschgeweihe an den Wänden. Es war nicht viel, aber es gehörte alles ihr, und sie war niemandem etwas dafür schuldig. Auch sie gehörte sich selbst und war niemandem etwas schuldig. Sie war wieder Hannah Yorke, nicht mehr ›Rosie‹, und sie würde nicht als alte kranke Hure in einer stinkenden Gosse sterben, auch wenn nur ein glücklicher Zufall sie davor bewahrt hatte. Was geschehen war, war geschehen, und sie vergaß es am besten.
Doch die Zeit war keine Sanduhr, die man umdrehen konnte, um zu sehen, wie die Sandkörner wieder zurückrieselten. Die Jahre in Deadwood hatten Narben in ihrem Herzen hinterlassen.
»Die ganze Stadt redet darüber, daß Sie etwas mit Zach Rafferty angefangen haben«, sagte Saphronie. Ihr Blick richtete sich sehnsüchtig auf die Flasche. Hannah stellte sie weg.
»Die ganze Stadt sollte lernen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.«
Saphronie beugte sich vor und senkte die Stimme und fragte neugierig: »Na und, wie ist er?«
Hannah wollte ihn nicht ansehen, aber sie tat es trotzdem. Vor ihm stand eine halbvolle Whiskeyflasche. Er hatte den Hut mitten auf den Tisch gelegt und warf nacheinander ein ganzes Blatt Spielkarten hinein. Er trank und vertrieb sich die Zeit, bis sie fertig war und wieder mit ihm zurückgehen würde in das Schlafzimmer mit den roten Seidentapeten und dem großen Federbett. Er war wild, unberechenbar und gefährlich. Er würde ihr das Herz brechen. Das taten solche Männer immer.
»Er ist nicht anders als alle Männer«, sagte sie wegwerfend. »Hast du nichts zu tun?«
Saphronie wurde über und über rot. Sie schob das leere Glas so heftig über die Bar, daß es auf dem Holz klirrte. »Danke für den Whiskey. Ich weiß, was Sie vom Trinken halten. Ich meine. Sie erlauben den anderen Mädchen nie ...«
Hannah griff nach der Hand der jungen Frau und drückte sie. »Tu es nicht mehr, Saphronie.«
Sie zog ihre Hand zurück. »Ich muß es tun, Mrs. Yorke, für die kleine Patsy.«
In diesem Augenblick ging die Tür auf. Mit der frischen Luft drang ein Sonnenstrahl herein. Sporen kratzten über den Boden. Saphronie drehte sich um, Hannah hob den Kopf und sah überrascht, daß Gus McQueen in ihren Saloon kam.