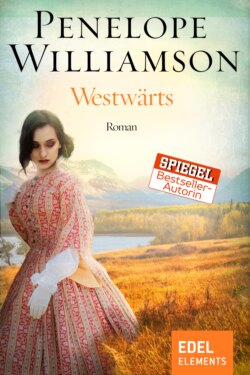Читать книгу Westwärts - Penelope Williamson - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
ОглавлениеGus McQueen hielt das Pferd einen Augenblick an und blickte über das Tal, das sein Zuhause war.
Er empfand eine beruhigende Freude, als er das Wort ›Zuhause‹ in Gedanken aussprach. Der Himmel war klar und blau und erstreckte sich bis ans Ende der Welt. Die kupferne Sonne warf einen Schein auf den Regenbogenfluß, der sich durch die saftigen Wiesen mit den Teppichen blaßvioletter und rosa Wildblumen wand. Meile um Meile wogte üppiges, saftiges Gras bis zu den baumbestandenen Bergen und den verwunschenen Hügeln mit den Kiefernwäldern. Das Regenbogenland wirkte an diesem Tag beinahe liebenswert und friedlich, nicht so wild und grausam, wie es wirklich war. Gus wußte sehr wohl, hier herrschte die Einsamkeit, die jeden bei dem kleinsten Anzeichen von Schwäche überfallen konnte.
Er wandte den Blick vom Horizont ab und sah seine Frau an. Sie saß auf dem hohen harten Wagensitz, als sei er ein Thron. Ihr blasses Gesicht war vom Wind gerötet, die vornehmen Kleider waren staubig und fleckig. Aber so wie ein Cowboy ein gutes Pferd daran erkannte, wie es sich bewegte und den Kopf hielt, so bestand kein Zweifel an Clementines Qualitäten. Sie war eine Dame.
Clementine ...
Selbst das Echo ihres Namens in seinem Kopf weckte seine Leidenschaft. Er dachte daran, wie sie an jenem Abend, als es schneite, ihr lachendes Gesicht zum Himmel gehoben hatte. Das Verlangen nach ihr hatte ihn beinahe um den Verstand gebracht. Sein Körper glühte und wollte sie, aber er hatte sich beherrscht. Seine Grundsätze hatten damals wie so oft den Sieg über seine Gefühle davongetragen.
Es hatte getaut. Im Frühling hielt sich der Schnee im Gegensatz zum Winter nicht lange, wenn die Schneewehen höher werden konnten als das Dach des Hauses. Dann wurde es so kalt, daß einem der Atem in der Brust gefror. Der Winter in Montana konnte über eine Frau den Sieg davontragen und sie wie Korn zwischen Mahlsteinen zermalmen. Der Winter und der Wind.
Leidenschaft und Angst kämpften in seiner Brust, als er seine Frau ansah. Sie war wertvoller als das Land. Er hätte nie geglaubt, daß er das einmal von einer Frau denken würde. Sie nahm einem Mann den Atem. Ihr Haar war golden wie das Licht der aufgehenden Sonne, ihre Augen waren grün und schimmerten wie das Präriegras im Frühling. Alles an ihr war zart und zerbrechlich wie edles, hauchdünnes Porzellan.
Man sollte sie unter eine Glasglocke stellen, dachte er, damit sie nicht zerbricht und ihre Reinheit nicht beschmutzt wird.
Der Winter und der Wind. Gus McQueen wußte, was Montana einer Frau antun konnte, und erschauerte.
In diesem Augenblick drehte sie den Kopf und sah, daß er sie beobachtete. Sie verzog den Mund zu einem scheuen Lächeln. Das Lächeln entfachte jedesmal sein körperliches Verlangen. Manchmal schämte er sich deshalb.
»Dein Regenbogenland gefällt mir, Mr. McQueen«, sagte sie. »Es ist wirklich so schön, wie du gesagt hast.«
Ein Stein schien ihm vom Herzen zu fallen. Bis zu diesem Augenblick war ihm nicht bewußt geworden, was er die ganze Zeit befürchtet hatte. Es bestand die Gefahr, daß sie zurückwollte, nachdem sie gesehen hatte, wohin er sie brachte. Er hatte gefürchtet, daß sie zurück in die Zivilisation, nach Boston und zu dem gewohnten Leben wollte. Er lächelte sie strahlend an. Sie konnten hier im Regenbogenland glücklich werden – er und Clementine, trotz aller Gefahren und Widerstände.
»Wenn du das hier schön findest, Clementine«, sagte er und lachte aus Freude am Leben und aus Freude über sie, »dann warte, bis du die Ranch siehst.«
Nickel Annie gab einen Laut von sich wie ein Schwein am Futtertrog. »Ha, die Ranch! Das ist der schönste Ort auf der Welt, um sich zu Tode zu arbeiten.«
Clementine mußte sich zusammennehmen, um vor Aufregung nicht auf dem Holz hin und her zu rutschen: Wochen waren vergangen, in denen ihr der unaufhörliche Wind Tag um Tag ins Gesicht geblasen hatte, so daß sich ihre Haut rauh und wund anfühlte; der Wind, der an ihren Haaren und den Kleidern gezerrt und ihr den Mund mit Staub gefüllt hatte. Wochen litt sie nun schon, in denen sie die Nächte entweder auf der harten Erde oder auf klumpigen, von Ungeziefer wimmelnden Matratzen in einer trostlosen Ranch am Wegrand verbracht hatte, Wochen, in denen sie wie ein Spatz auf dem Sitz des Frachtwagens saß, der rumpelnd und holpernd und schaukelnd Meile um Meile zurücklegte, während sie aufpassen mußte, daß Nickel Annies Anzüglichkeiten oder ihre Tabakbrühe sie nicht trafen. Es waren lange Wochen gewesen mit Tagen und Nächten und Meilen, die irgendwie ertragen werden mußten. Und nun lag das alles endlich beinahe hinter ihr!
In den letzten Tagen waren sie durch Wälder mit Tannen und Lärchen gefahren, deren lange Äste mit den dichten Nadeln die Sonne filterten und den Wind abhielten. Die Schönheit der Natur hatte Clementine tief berührt. Am Vortag hatten sie auf einem Paß gletscherbedeckte Berge überquert und ein weites Tal überblickt, das sich wild und leer wie der Himmel von Montana unter ihnen ausbreitete. Gus hatte sie auf einen Hügel hingewiesen, der in der Prärie aufragte und wie ein Hut aussah.
»Am Fuß dieses Hügels liegt Rainbow Springs, und auf der anderen Seite dahinter ist meine Ranch ... unsere Ranch«, verbesserte er sich.
Bei diesen Worten wurde ihr warm, und sie lächelte.
»Der Hügel hat dem Regenbogenland seinen Namen gegeben«, fuhr er fort. »Man erzählt, daß vor langer Zeit ein Indianermädchen während einer großen Hungersnot ihren Geliebten verlor. Er hatte gejagt, um die Angehörigen seines Stammes zu ernähren, und nichts für sich zurückbehalten. Am Morgen nach seinem Tod trug sie die Leiche auf den Hügel. Dort tanzte sie tagelang vor Kummer und Leid und weinte so sehr, daß ihre Tränen wie Regen auf das Tal fielen, während die Sonne schien. Ein Regenbogen entstand, und im nächsten Sommer wurde das Büffelgras höher als ein Krieger auf seinem Pferd und dichter als das Fell eines Grizzlybären. Ihr Volk hatte von da an Nahrung im Überfluß.« Er legte den Kopf schief und sah sie mit lachenden Augen an. »An der Geschichte mag durchaus etwas Wahres sein.«
Clementine interessierte es nicht, ob es eine wahre Geschichte war. Die Geschichte war traurig und schön. Sie dachte daran, während der Hügel größer wurde, während sie auf dem gewundenen Weg, der den Flußbiegungen folgte, durch das Tal fuhren. Endlich, endlich sah sie die Blechdächer von Rainbow Springs in der Sonne glänzen. Hier war Gus zu Hause, und von jetzt an auch sie. Es war ihre Heimat.
Pappeln und Espen säumten den Fluß, wo er sich um den Hügel wand, auf dem das Indianermädchen um den Geliebten getrauert hatte. Am gegenüberliegenden Ufer stand ein brauner Wigwam in der Sonne. Clementine suchte nach Zeichen von Leben, nach einem Indianermädchen und ihrem Mann. Doch der Wigwam wirkte unbewohnt. Auch die breite Straße – breit genug, damit ein Maultiergespann Platz zum ›Manövrieren‹ hatte, wie Nickel Annie sagte – lag verlassen. Sie endete am Hang des großen Hügels, den aufgegebene Minenschächte wie Pockennarben überzogen.
Mit einem Berg Blechdosen und leeren Flaschen begann das, was man sich, wie Clementine inzwischen gelernt hatte, in Montana unter einer Stadt vorstellte. Es folgten einzelne verwitterte Blockhäuser mit rostigen Blechdächern. Zwei dieser Häuser trugen Schilder: ›Best in the West Casino‹ und ›Sam Woo – Gemischtwarenhandel‹. Beide Schilder stammten offenbar von demselben Künstler, denn die Großbuchstaben hatten die gleichen geschwungenen Schnörkel.
Am meisten beeindruckte Clementine jedoch der Schlamm. Die Hufe der Maultiere machten saugende und schmatzende Geräusche im breiigen Schlamm. Der Wagen versank beinahe bis zu den Radnaben, und Clementines Rock war bald über und über mit roten Schlammspritzern bedeckt. Nickel Annie fluchte und schwang die Peitsche klatschend über den Köpfen der Tiere, die den schweren Wagen mühsam zogen. ›Gumbo‹ nannte man diese Art Schlamm. Er war rot, klebrig und roch nach Sümpfen und Wildnis.
Der Wagen hielt schließlich vor einem Mietstall. Zu dem Stall gehörte auch eine Schmiede. Im Schatten der Esse arbeitete ein Mann mit einem struppigen langen Bart und einem Hängebauch unter der Lederschürze an einem Deckel für einen Sarg.
Gus sprang vom Pferd. Im Haus fiel eine Tür laut ins Schloß. Eine Frau in einem gerafften Rüschenkleid, das so leuchtete wie künstliche Veilchen, eilte herbei. Sie hob die Röcke und hüpfte über den Steg aus Brettern und Planken. Dabei sah man ihre roten Schuhe, einen rosa- und fliedergestreiften Unterrock und feuerrote Seidenstrümpfe.
»O Annie, du bist ein Schatz!« rief die Frau lachend, noch bevor sie den Wagen erreicht hatte. »Da ist es endlich! Du hast mein Klavier gebracht!«
Als die Frau Gus sah, blieb sie so unvermittelt stehen, daß sie beinahe gestolpert wäre, und ließ die Röcke sinken. Eine flammende Röte überzog ihre Wangen, während sie sich ein paar Haare aus dem Gesicht strich. Sie hatte kastanienrote Haare. Aber Clementine fand, daß ihr Gesicht für rote Haare und ein violettes Kleid wie geschaffen war. Sie hatte Grübchen, und sie war frech und verführerisch.
»Ach, Gus McQueen«, sagte sie mit einer Stimme, die wie die eines jungen Mannes im Stimmbruch klang. »Cowboy, du warst so lange weg, daß sogar ich dich vermißt habe.«
Gus ging an ihr vorbei, als sei sie unsichtbar.
Clementine kletterte mit seiner Hilfe von dem hohen Wagen und benutzte dabei das Rad und die Nabe als Stufen. Die Frau war auf Hie andere Seite gegangen und hatte Nickel Annie umarmt. Sie stellte sich gerade auf das Rad, um ihr Klavier in Augenschein zu nehmen, ohne darauf zu achten, daß man die roten Quasten an ihren Schuhen und die feuerroten Seidenstrümpfe sah.
Clementine fand die Frau in dem violetten Kleid faszinierend. Sie wußte, ihre Mutter hätte ein solches Kleid vulgär gefunden. Es war ihr nie erlaubt gewesen, etwas anderes als elegante Grau- oder Brauntöne zu tragen. Clementine überlegte, wie sie in einem so auffallenden Kleid aussehen und wie sie sich darin fühlen würde.
»Allmächtiger, wenn das nicht Gus McQueen ist!« Der Schmied kam schwerfällig zu ihnen herüber. Die Lederschürze klatschte gegen seine Schienbeine. Er grinste. »Wie geht's, Cowboy?« Er lachte dröhnend und schlug Gus mit seiner riesigen Hand auf die Schulter. »Wir haben dich seit Urzeiten nicht mehr gesehen.«
»Wie geht's, Jeremy? Für wen ist denn die Kiste?« fragte Gus und wies mit dem Kinn auf den Sarg. Er stand auf einem Sägebock und war aus Kiefernbrettern gemacht, die oben breit und unten schmal waren. Der Sarg war für einen großen Mann bestimmt.
»MacDonald, dieser Schotte, hat sich umbringen lassen«, erwiderte der Schmied. Clementine hatte Gus die Hand auf den Arm gelegt und spürte, wie er sich entspannte, als habe er sich vor der Antwort gefürchtet. »Man hat ihn mit einem Schuß im Rücken auf der Weide im Norden gefunden. Wir vermuten alle, daß Iron Nose und seine Männer es getan haben. Der arme Kerl hat sie wahrscheinlich dabei erwischt, wie sie seine Frühjahrskälber eingefangen haben. Als er es verhindern wollte, haben sie ihm eine Kugel in den Leib gejagt. Ein paar von uns sagen, es wäre Zeit, daß wir einen Trupp zusammenstellen, um die Verbrecher aufzuspüren und an einen Baum zu hängen.« Die Blicke des Schmieds waren zwischen Gus und Clementine hin- und hergewandert wie ein Ball an einem Gummizug. Nun sah er Gus an. Seine Augen waren klein und blaß wie Kürbiskerne, und man konnte deutlich die Frage darin lesen, die er nicht stellte.
Gus legte Clementine den Arm um die Taille. »Jeremy, ich möchte dich mit meiner Frau bekannt machen. Jeremy gehört der Mietstall, betreibt die Schmiede und ist bei Bedarf auch noch Leichenbestatter.«
Clementine nickte höflich. »Guten Tag, Mr. ...« Sie konnte nicht einfach ›Jeremy‹ zu ihm sagen.
Der Schmied starrte sie mit offenem Mundan. Als er ihn schloß, hörte man das Klicken seiner wenigen Zähne. »Du machst wohl Witze, Gus. Du hast dir eine Frau mitgebracht. Also wirklich, das ist eine Überraschung!«
»Willkommen in Rainbow Springs, Mrs. McQueen.« Die Frau im violetten Kleid war zu ihnen getreten, und Clementine drehte sich beim Klang der tiefen Stimme nach ihr um.
Clementine sah, daß die Röte im Gesicht der Frau teilweise von der Schminke herrührte. Sie lächelte freundlich, aber in ihren kaffeebraunen Augen lag eine Spur Wachsamkeit und Verletzlichkeit, als sie den Blick von Clementine abwandte und Gus ansah.
Gus spannte den Arm um Clementines Taille an und zog sie weg. »Ich bin gleich wieder da, Jeremy«, sagte er, faßte Clementine am Ellbogen und zog sie mit sich. »Komm, Clementine.«
Die Stimme der Frau klang jetzt trocken und spöttisch, als sie sagte: »Manche Leute haben Manieren wie ein wild gewordener Esel.«
Clementines Schuhe versanken im Schlamm. Sie bemühte sich, mit der einen Hand die Röcke zu heben, während sie versuchte, sich auf einer der Planken in Sicherheit zu bringen, die scheinbar wahllos verteilt waren. »Warte, Mr. McQueen. Ich bleibe im Morast stecken.«
»Daran kannst du dich gleich gewöhnen, Clem«, sagte er über die Schulter. »Es wird bis Juni so bleiben.«
»Willst du mir nicht wenigstens sagen, wohin du so eilig gehst und warum du so unhöflich zu der Frau bist?«
»Ich stelle meine Frau doch nicht der Hure dieser Stadt vor.«
Die Hure ...
Clementine hätte sich am liebsten umgedreht und noch einmal einen Blick auf die Frau geworfen. Sie sah in Gedanken das auffallende, violette Seidenkleid vor sich.
Die wenigen Häuser der Stadt bestanden alle aus behauenen Baumstämmen. Nur der Saloon war etwas herausgeputzt. Er hatte weiß gestrichene Rahmen um die Fenster, und über der großen Doppeltür hingen Hirschgeweihe. Im Vorbeigehen sah Clementine dahinter inmitten von Espen und Kiefern ein anderes Haus. Es war zweistöckig, hatte weiß gestrichene Bretter, und der Giebel war mit geschnitzten Rosetten und Ornamenten geschmückt. Außerdem hatte es eine Veranda mit einem gedrechselten Geländer. »Wer wohnt in dem Haus dort?« fragte sie.
»Du hast sie gesehen. Hannah Yorke ist die Besitzerin des ›Best in the West‹ und die Hure. Mrs. Yorke nennt sie sich, obwohl ich mein Pferd mit Haut und Haaren fresse, wenn sie mit einem der Männer verheiratet war, mit denen sie im Bett gelegen hat. Vergiß sie, Clementine. Du wirst mit ihr bestimmt keinen Umgang haben wollen.«
Es muß etwas einbringen, dachte Clementine, wenn man seinen Körper an Männer verkauft. Nach all den armseligen Hütten, in denen sie unterwegs die Nächte verbracht hatten, fürchtete sie allmählich, es könnte sich herausstellen, daß ihr Mann auch in einem solchen Schuppen hauste. Aber bestimmt, dachte sie, muß unser Haus mindestens genauso hübsch sein wie das der Hure.
Gus blieb plötzlich stehen. »Hier ist der Laden«, sagte er und wies auf ein niedriges Haus mit einem einzigen Fenster. Eine der Scheiben war zerbrochen, und die Öffnung war mit einem Sack zugestopft; die anderen Scheiben waren so schmutzig, daß Clementine vom Innern nur das schwache Licht einer flackernden Laterne sah. »Warum gehst du nicht hinein und siehst dich um? Ich muß noch einmal zurück und einen Wagen mieten, damit wir zur Ranch fahren können. Wenn du etwas findest, was dir gefällt, dann sagst du Sam Woo, er soll es auf die Rechnung setzen.«
Clementine beobachtete, wie ihr Mann mit großen Schritten durch den Morast zum Stall und zu Nickel Annies Frachtwagen zurückging. Er hatte sie nur deshalb hierher zu dem Laden gebracht, damit sie nicht durch den Kontakt mit der Hure beschmutzt werden würde. Dabei wirkte die Frau überhaupt nicht verworfen, sondern nur fröhlich und vielleicht sogar etwas schüchtern.
Clementine blieb stehen und sah, wie Hannah Yorke aufgeregt um den Wagen herumlief. Nickel Annie und der dicke Schmied kämpften mit dem Klavier. Sie versuchten, ein Seil darumzulegen, damit man es mit der Winde aus dem Wagen heben konnte. Das heitere, silberhelle Lachen der Frau, das an Glöckchen erinnerte, mischte sich mit Annies herzlichem, dröhnendem Gelächter.
Sie sind Freunde, dachte Clementine. Hannah Yorke, die Hure, Nickel Annie, das Mannweib, und Jeremy, der dicke zahnlose Schmied.
Während Clementine ihnen zusah und ihr fröhliches Lachen hörte, wurde sie traurig und spürte wieder einmal so etwas wie Neid. War es denn wirklich ihr Schicksal, immer nur von weitem zuzusehen? Warum durfte sie nicht am Leben teilnehmen wie die anderen?
Clementine drehte sich seufzend um und stieg die zwei ausgetretenen Stufen zum Laden hinauf. Die Tür stand bereits einen Spalt offen. Sie drückte vorsichtig dagegen. Dabei stieß die Tür gegen ein paar Kuhglocken, die laut bimmelnd ihre Ankunft verkündeten. Clementine sah sich nach einem Fußabstreifer um, erkannte aber sofort, daß es sinnlos gewesen wäre, die Schuhe zu säubern. Der unebene Boden aus großen alten Faßdauben war beinahe so schmutzig wie die Straße.
Sie hob die Röcke, um über die hohe Schwelle zu steigen, und blickte in den Laden. Drei Männer starrten sie wie ein Gespenst an. Zwei der Männer wärmten sich den Rücken an einem schwarzen bauchigen Ofen. Der eine war eine richtige Bohnenstange mit großen ernsten Eulenaugen und einem eingefallenen zahnlosen Mund. Der andere Mann war klein und rund. Sein Kopf war völlig kahl, aber dafür hatte er einen langen dichten Bart, der ihm bis zur Mitte der Brust reichte und so verblichen war wie altes Wachs. An ihren Kleidern hing roter Lehm, und sie trugen genagelte Schuhe. Clementine hielt sie für Goldsucher.
Die Ladentheke bestand aus ungehobelten Brettern, die auf zwei Fässern lagen, die vermutlich einmal gepökeltes Fleisch oder Heringe enthalten hatten. Dahinter stand offensichtlich Sam Woo, der in Schnörkelschrift auf dem Ladenschild als der Besitzer angekündigt wurde. Er blickte sie durch eine Brille an, die ein grüner Augenschirm zum größten Teil verbarg. Er hatte ein flaches Gesicht und einen tintenschwarzen Schnurrbart, der so spärlich und starr war, daß er an eine Bürste erinnerte.
Als Clementine über die Schwelle stieg, schienen die drei Männer gleichzeitig zu seufzen.
»Ich will ...«, begann der große magere Mann.
»... verdammt sein«, sagte der kleine Dicke.
»Nur das nicht«, murmelte Sam Woo.
Clementine nickte ihnen höflich zu. Sie war schüchtern und verlegen.
Der Chinese legte die Handflächen aneinander und verneigte sich. Dabei baumelte sein langer Zopf in Höhe der Hüfte hin und her. »Sam Woo heißt Sie in seinem bescheidenen Laden willkommen, Madam. Meine armselige Wenigkeit fühlt sich geehrt. Sagen Sie mir, wie ich Ihnen dienen kann.«
Clementine befeuchtete sich die Lippen mit der Zungenspitze und schluckte. »Ich möchte mich heute nur einmal umsehen, vielen Dank. Ich weiß noch nicht genau, was ich alles brauchen werde.« Sie wies auf die beiden Goldsucher. »Bitte bedienen Sie die beiden Herren weiter.«
Sam Woo verneigte sich noch einmal. Als er sich aufrichtete, blitzten seine Brillengläser im trüben Licht. Unter den neugierigen Blicken der Männer wurde es Clementine unbehaglich, und sie wandte sich ab. Sie tat, als interessiere sie sich für einen eisernen Vogelkäfig, in dem noch Federn eines sicher längst verendeten Kanarienvogels lagen. Nach einem langen verlegenen Schweigen steckten die Männer die Köpfe zusammen und beugten sich über einen Katalog mit Eselsohren, der aufgeschlagen auf der Theke lag.
Clementine hatte noch nie so viele Dinge beisammen gesehen, die nichts miteinander zu tun hatten. Sie rümpfte die Nase beim Geruch von Kohlenöl und Sattelseife, Stockfisch und verschimmelten Käselaiben. Ein Schachspiel lag auf einem Stapel Bratpfannen, die unsicher auf ein paar Schmalzeimern balancierten. Messinglaternen hingen neben den Unaussprechlichen für Männer, kleine Büchsen mit einer roten Paste standen neben Bonbondosen. Etwas streifte ihren Kopf und verfing sich in ihrer Haube. Als sie aufblickte, sah sie eine altmodische Krinoline an der Decke hängen.
Auf der Theke entdeckte sie neben einer Schachtel Rosenseife eine Waage, die, wie sie aus Shonas Romanen wußte, zum Wiegen von Goldstaub benutzt wurde. Sie trat näher, der Rosenduft stieg ihr in die Nase und versetzte sie zurück in das Haus am Louisburg Square. Sie sah das Gesicht ihrer Mutter vor sich und umklammerte den Beutel mit den Münzen, den sie immer noch ganz unten in der Manteltasche bei sich trug.
Clementine sah sich in dem Laden mit seinen übervollen, uralten und verstaubten Regalen um. Ihr Blick schweifte von dem schmutzigen Fenster zu dem Schlamm auf dem Fußboden. Die Wände waren so roh, daß sich an manchen Stellen noch die Rinde in weichen grauen Fetzen löste. Von der flackernden Öllampe stieg fettiger, übelriechender Rauch auf, und irgendwo hörte sie Ratten oder Schlangen oder anderes schreckliches Ungeziefer im offenliegenden Gebälk herumkriechen. Sie war mitten in der Wildnis, in einer Welt des Nirgendwo und Nichts, und so fern von Boston, daß sie den Rückweg niemals allein finden würde. Sie hatte ein flaues Gefühl im Magen und kam sich plötzlich sehr einsam vor. Zum ersten Mal hatte sie wirklich Angst bei dem Gedanken an das, was sie getan hatte.
Sie nahm irgendwie wahr, daß der dicke Goldsucher sehr laut redete, ja beinahe schrie. Zuerst drang der eigenartige Klang seiner Stimme in ihr Bewußtsein, denn sie war hoch und klang wie eine rostige Pumpe. Was er sagte, schien so erschreckend, daß sie ihr Elend vergaß und näher zur Theke ging, um besser zu hören.
»Das ist nicht legal, Sam«, sagte der dicke Mann und stieß mit dem krummen Zeigefinger auf den Katalog, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Du kannst keine Sklavin kaufen. Weißt du nicht, daß wir vor einer Weile nur deshalb einen Bürgerkrieg geführt haben, um klarzumachen, daß wir alle freie und gleiche Bürger der Vereinigten Staaten sind? Selbst die Schwarzen sind jetzt frei. Die Indianer, na ja – die sind nicht ganz gleichberechtigt und Frauen auch nicht. Aber frei sind sie alle – sozusagen. Verdammt, Nash, hast du deine Zunge verschluckt? Erklär dem Mann, was ich zu sagen versuche.«
Der magere Goldsucher zog den Katalog unter dem Finger des anderen hervor und hielt ihn in das graue Licht des Fensters. »Er sagt, du kannst dir keine Frau kaufen, Sam, nicht einmal eine chinesische. Wieviel kostet sie überhaupt?«
»Das versteht ihr nicht. Ich heirate sie, also bezahle ich ihrem Beschützer einen Brautpreis, eine Art umgekehrte Mitgift, könnte man sagen.« Sam Woo beugte sich über die Theke und deutete auf das Bild eines Mädchens in einem hochgeschlossenen Kleid. Clementine sah, daß der Katalog nur Holzschnitte von Frauenköpfen enthielt. »Die da«, sagte Sam Woo. »Gefällt sie euch, he? Sie ist ein hübsches Ding, nicht wahr? Sie würde mich tausend Dollar kosten.«
»Tausend Mäuse? Allmächtiger!«
Der große dünne Mann riß sich den Hut vom Kopf und schlug damit dem Kleinen auf den Bauch. Eine Staubwolke stieg auf. »Paß auf dein loses Maul auf, Pogey.«
Der dicke Mann öffnete den Mund, um zu protestieren, als sein Blick auf Clementine fiel.
Er starrte sie an. Er zupfte sich zuerst an einem Ohr und dann am anderen. Seine Ohren waren so groß und rund wie Nickel Annies Pfannkuchen. »Madam, ich will nicht neugierig sein«, sagte er zu ihr. »Aber sind Sie eines der neuen Mädchen von Mrs. Yorke? Ich frage nur, weil ich so sicher wie das Amen in der Kirche noch nie ein lockeres Mädchen gesehen habe, das so aussieht wie Sie! Verd ...!« rief er, als ihm der andere noch einen Schlag mit dem Schlapphut verpaßte. »Warum zum Teufel haust du mich dauernd, Nash?«
»Paß auf, was du sagst, du alte Sau.«
»Aufpassen, was ... zum Teufel.« Er rieb sich den Bauch und blickte traurig und anklagend zur Decke. »Warum kann ich nicht einmal einen Furz lassen, ohne daß du gleich eine Erklärung dazu abgeben mußt und mir eine Strafpredigt hältst?«
»Ich sage, hier ist eine Dame. Ich sage, ein Herr sollte in Anwesenheit einer Dame nicht fluchen.«
»Allmächtiger Gott! Was ist schon eine Unterhaltung, wenn man sie nicht mit ein oder zwei Flüchen würzt?«
»Ich sage, wenn es dich irgendwo juckt, wo es unhöflich ist, sich zu kratzen, dann kratzt du dich eben nicht.«
»Du redest Quatsch, weißt du das, Nash? In all der Zeit, die ich dich kenne, habe ich bei dir auch nicht eine Spur von Vernunft erlebt. Was aus meinem Mund kommt, versteht auch eine Dame. Und das ist mehr, als man über das sagen kann, was aus deinem Mund kommt. Du heulst wie ein verdammter Kojote den Mond an, aber nicht ein einziges Mal ist aus deinem großen Mund ein Satz herausgekommen, der einen gottverdammten Sinn ergeben hätte!«
»Jeder mit einem Gehirn, das größer ist als eine Erbse, versteht, was ich meine. Ich sage, du sollst dich benehmen, Pogey, mehr nicht.«
Was immer Pogey darauf erwidern wollte, blieb ungesagt, denn in diesem Augenblick bimmelten die Kuhglocken, weil die Tür aufging.
Eine Indianerin stand auf der Schwelle. Auf ihrer Hüfte hielt sie ein etwa zweijähriges Kind, und auf dem Rücken trug sie in einem Körbchen einen Säugling. Über einer langen Lederhose und Mokassins, die mit bunten Stachelschweinborsten und Glasperlen besetzt waren, trug sie ein einfaches rotes Baumwollkleid. An ihrem Hals hing ein kleines goldenes Papistenkreuz. Sie war jung, beinahe selbst noch ein Kind. Doch ihr rundes Gesicht mit der kupferfarbenen Haut wirkte ängstlich. Unsicher blickte sie von einem der Männer zum anderen.
»Bitte, Mr. Sam«, sagte sie und machte zwei zögernde Schritte in den Laden. »Können Sie mir Dosenmilch für mein Baby geben? Es ist krank, und meine Brust gibt nicht mehr genug her.«
Pogey sah die Indianerin finster an und zupfte an seinem riesigen Ohr. »Wieso läßt du so was wie die überhaupt rein, Sam?«
»Ich lasse sie nicht rein.« Sam Woo eilte hinter der Theke hervor, hob die Schürze und tat so, als seien die Indianerin und ihre Kinder Hühner, die er verscheuchen wollte. »Ohne Geld keine Milch, Squawmädchen, hörst du? Kein Geld, keine Milch. Raus, raus, raus!«
Die Indianerin drehte sich schnell um. Sie riß die Tür auf, stieß dabei fast mit Gus McQueen zusammen und rannte auf die schlammige Straße.
Gus sah ihr flüchtig nach. Dann trat er in den Laden und schloß die Tür hinter sich. Sein Blick fiel auf die Gruppe an der Theke. »Na, Jungs, ich sehe, ihr habt euch meiner Frau vorgestellt.«
Sam Woo verzog langsam die Lippen zu einem Lächeln. »Es ist mir eine große wunderbare Freude, Sie kennenzulernen, Mrs. McQueen.«
»Also, ich will ...«, Nash grinste über das ganze Gesicht.
»... verdammt sein«, ergänzte Pogey.
Gus beugte sich vor und sah Nash fragend an. »Was zum Teufel hast du mit deinen Zähnen gemacht?«
»Oh!« Nash legte schnell die Hand auf den Mund und versuchte, etwas zu sagen.
Pogey stieß ihm mit dem Ellbogen in die Rippen. »Du kannst selbst ohne Zähne im Mund kein vernünftiges Wort von dir geben. Ich will es ihm sagen ... Nash und ich, wir haben eine Runde Karten mit dem Angeber gespielt, der an einem Tisch im Saloon scheinbar Wurzeln geschlagen hat. Wir haben Nashs neues Gebiß gegen einen Herzflush gesetzt und dann eine Kreuzzwei gezogen. Aber wir bekommen seine Zähne wieder zurück, jetzt, wo wir ...« Er stöhnte, weil sein Partner ihn heftig mit dem Hut auf den Bauch geschlagen hatte. »Äh, darüber reden wir später mit dir, Gus.«
Gus sah die beiden Männer aufmerksam an. Aber als sie nur stumm grinsten, sagte er achselzuckend zu Clementine: »Wir sollten uns auf den Weg machen. Ich habe alles auf den Wagen geladen, Clementine, und wir haben noch zwei gute Stunden bis zur Ranch.« Er legte ihr die Hand auf den Rücken und schob sie in Richtung Tür.
»Es war mir ein Vergnügen, so viele meiner neuen Nachbarn auf einmal kennenzulernen«, sagte Clementine und lächelte.
Die Tür schloß sich unter dem Geläut der Kuhglocken hinter ihnen. Im Laden breitete sich Stille aus, eine so tiefe Stille, daß man hörte, wie der Zwieback auf dem Boden des Fasses knackte.
»Das Land wird zahm, Pogey«, sagte Nash nach einer Weile und schüttelte traurig den Kopf.
»Zahm wie eine Katze, die mit Sahne gefüttert wird.« Pogey zupfte an seinem Ohr und seufzte. »Raus mit der Flasche, Sam. Wir müssen uns vollaufen lassen, um diesen Schock zu verkraften.«
»Da möchte man ja am liebsten Rotz und Wasser heulen«, sagte Nash. »Erst kommen die Weiber, und dann gibt es im Handumdrehen Zäune und Schulen.« Er schüttelte sich. »Und Teegesellschaften und kirchliche Veranstaltungen.«
»Nur das nicht«, murmelte Sam Woo und holte eine Flasche Whiskey unter der Theke hervor. Die Männer dachten schweigend über die traurige Tatsache des Näherrückens der Zivilisation nach.
»Ich dachte, Gus ist nach Boston, um seine sterbende Mutter noch einmal zu sehen«, sagte Nash nach einer Weile.
Pogey seufzte tief. »Er hat seine Mutter verloren und eine Frau gefunden.«
»Ein Prachtexemplar von Frau.«
»Eine Frau von der Sorte, die Ingwerplätzchen ißt und Limonade trinkt.«
»Nur das nicht«, murmelte Sam Woo, trank direkt aus der Flasche und gab sie in Pogeys wartende Hand weiter.
»Ich frage mich, ob Zach es schon weiß«, sagte Nash.
»Nur das nicht«, murmelte Sam Woo noch einmal.
Clementine trat mit hochgehobenen Röcken auf die Straße. Die Indianerin, die mit ihrer schweren Last durch tiefen Schlamm waten mußte, war noch nicht weit gekommen.
»Warte!« rief Clementine. »Bitte warte!«
Gus packte sie am Arm. »Was zum Teufel willst du mit ihr?«
»Die Indianerin ... wir müssen ihr Geld geben. Sie muß Dosenmilch kaufen.«
Er schüttelte energisch den Kopf. »Sie ist die Squaw von Joe Proud Bear. Wenn er will, daß sie etwas zu essen hat, kann er es ihr verschaffen. Es überrascht mich, daß er ihr nicht ein paar von meinen Rindern bringt.«
»Aber das Baby ...«
»Wenn sie Geld hätte, würde sie es nicht für Milch ausgeben. Sie würde sich bei Sam Woo sinnlos betrinken.«
Sein Griff schmerzte, aber Clementine spürte es kaum. Die Indianerin hatte sie gehört und kam zurück, allerdings langsam, als spüre sie die Gefahr, als habe sie Angst vor Gus und seinem Zorn.
»Das verstehe ich nicht«, sagte Clementine.
»Die Saloons dürfen nichts Alkoholisches an Indianer verkaufen, und deshalb versuchen sie, alles in die Hände zu bekommen, was Alkohol enthält. Wenn sie nicht will, daß ihre Kinder hungern, kann sie sich ihre Ration Rindfleisch beim Sheriff abholen. Sie ist ein Halbblut, und Joe Proud Bear auch. Sie sind zwar keine Vollblutindianer, aber sie haben Verwandte, zu denen sie gehen können.«
Die Indianerin hatte im Laden nicht nach Alkohol gefragt, sondern um Milch gebeten.
Ich habe Geld, dachte Clementine plötzlich. Ganze hundert Dollar. Dummerweise ist es in meiner Tasche eingenäht. Ich muß die Nähte mit den Fingernägeln auftrennen.
Sie machte sich von Gus los und begann, die Handschuhe auszuziehen. Das weiche Leder blieb an ihrem Ehering hängen.
Ein lauter Schrei drang durch die Luft. Ein Indianer auf einem gefleckten Pony näherte sich auf der Straße vom Fluß. Das Pferd galoppierte so schnell, daß der rote Schlamm aufspritzte. Er trug eine karierte Hose und ein verblichenes blaues Hemd. Ohne die dicken Kupferringe an seinem Arm und die in seine Zöpfe geflochtenen Eulenfedern hätte er wie ein Cowboy ausgesehen. Er war jung, kaum älter als Clementine. Aber er stieß furchterregende Schreie wie ein Indianer auf dem Kriegspfad aus, und Clementine erstarrte vor Angst.
Gus schob Clementine vorwärts. Sie kletterte gerade auf den Sitz, als der Indianer noch einmal schrie.
Der Mann hatte ein Lasso aus geflochtenem Leder vom Sattel gelöst und schwang es über dem Kopf. Die Schlinge flog durch die Luft, sank über die Schultern der Frau und legte sich eng um das Kind in ihren Armen und das Baby auf ihrem Rücken.
Das Leder spannte sich pfeifend. Der Indianer schlang das Ende schnell um den Sattelknopf, wendete das Pferd und ritt in Richtung Fluß zurück. Er zog die Frau mit den Kindern hinter sich her wie Vieh. Die arme Frau hatte Mühe, um im Schlamm nicht auszurutschen und zu fallen.
»O bitte, unternimm etwas!« rief Clementine. »Hilf ihr doch ...«
Gus rührte sich nicht. Mrs. Yorke, Nickel Annie, Jeremy – sie alle sahen zu und taten nichts.
Gus griff nach den Zügeln und ließ sich auf den Wagensitz fallen. Clementine schwankte. Sie klammerte sich an das Messinggeländer, aber sie rückte von ihm ab.
Die Achsen des niedrigen Wagens knarrten und quietschten, als er sich seinen Weg durch den Schlamm bahnte. Gus schlug mit der Peitsche auf das Pferd ein.
»Clementine«, sagte er, und seine Stimme klang jetzt ruhiger. »Die beiden sind verheiratet, zumindest nach indianischer Sitte. Es steht niemandem von uns zu, sich einzumischen.«
Clementines Finger klammerten sich in den dicken Wollstoff ihres Mantels. Sie schwieg. Die Berge von Blechdosen und Glasflaschen lagen bereits hinter ihnen, der Wigwam ebenfalls. Sie blickte nicht zurück.
»Im Regenbogenland herrschen andere Sitten, Clem. Du mußt lernen, dich damit abzufinden, wenn du hier leben willst.«
»Ich werde mich nicht mit deinen Sitten abfinden, Mr. McQueen, nicht mit allen.«
Er preßte die Lippen aufeinander. »Du wirst das tun, was ich dir sage.«
»Das werde ich nicht.«
Der Wagen zog wie ein Schiff eine breite Spur durch das dicke hellgrüne Büffelgras. Ein eigenartiger warmer Wind war aufgekommen, der nach wildem Senf und Kiefern roch. Der Wind übertönte das Klirren des Pferdegeschirrs und das Knirschen der eisenbeschlagenen Räder auf dem steinigen Boden. Er übertönte den Ruf der erschrockenen Präriehühner und Gus McQueens Schweigen.
Clementine blickte auf das verschlossene Gesicht ihres Mannes. Er preßte immer noch die Lippen zusammen, als spare er seinen Vorrat an Worten auf. Sein Zorn war anders, als sie ihn gewohnt war. Er strafte sie mit Schweigen anstelle von lauten Vorwürfen und Bitten.
Clementine hielt ihre Haube fest, während sie beobachtete, wie der trockene warme Wind seine Hutkrempe umbog und den Mantel gegen seinen Oberkörper drückte. Ihr Blick fiel auf seine Hände, die locker die Zügel hielten. Es waren starke, große Hände. Ihr Mund wurde trocken, und sie spürte eine Spannung in der Brust und wußte, es war Angst. Sie schloß die Hände um die Narben auf den Handflächen.
Er darf mich nicht schlagen. Ich werde nicht zulassen, daß er mich schlägt ...
Er hob den Kopf und sah, daß sie ihn beobachtete. »Spürst du den Wind, Clementine?«
Sie blinzelte verwirrt. »Wie?«
»Diese Art Wind nennt man ›Chinook‹. Er kann über Nacht allen Schnee schmelzen, der während eines Schneesturms fällt.«
»Ach.«Clementine überlegte, ob er ihr zu zeigen versuchte, daß er nicht mehr wütend auf sie war. Sie warf noch einmal einen Blick auf sein Gesicht. Sie ärgerte sich noch immer über ihn. Doch wenn er bereit war, das Ganze zu vergessen, wollte sie nicht nachtragend sein.
Der Wind war sehr warm. Sie wurde davon ganz traurig und fühlte sich einsam. »Wie lange dauert es noch, bis wir die Ranch erreichen?« »Wir sind seit einer Viertelstunde auf der Ranch.«
Clementine blickte sich um. Sie sah grünbraune Wiesen und Hügel mit fettem Weidegras. Mit Kiefern bewachsene Berge ragten in den blauen Himmel, über den weiße Wattewolken zogen. Ein in der Sonne glänzender Fluß floß hell wie Quecksilber zwischen Pappeln, Espen und Weiden dahin. Es war ein reiches Land, ein leeres Land, ein wildes Land. Genau so, wie er es beschrieben hatte. Nein, Gus McQueen hatte ein paar wichtige Einzelheiten ausgelassen.
Sie betrachtete wieder sein Profil: den hartnäckig vorgeschobenen Unterkiefer, den straffen Mund und seine Augen, die so blau waren wie der Himmel von Montana.
»Nickel Annie hat mir von Mr. Rafferty erzählt«, sagte sie, »von deinem Bruder.«
Auf seiner Wange erschien ein roter Fleck, aber er sah sie nicht an. »Ich hätte es dir schon früh genug gesagt.«
»Wann?«
»Jetzt. Ich wollte es dir jetzt sagen. Zach und ich, wir sind frei und ungebunden im Süden aufgewachsen, bis unsere Eltern sich trennten und wir auseinandergerissen wurden. Meine Mutter und ich, wir sind nach Boston gegangen, und Zach ... ist geblieben. Aber vor drei Jahren haben wir uns wieder getroffen und uns zusammengetan, um die Ranch hier zu bearbeiten.«
Sie wartete. Doch die Quelle, aus der seine Worte kamen, schien wieder versiegt zu sein. »Und was ist mit ihm, mit deinem Bruder?«
»Ich habe es dir doch gesagt. Wir führen zusammen die Ranch.«
»Ist er älter oder jünger?«
»Jünger. Ich war zwölf, und er war zehn, als ... als Mutter und ich gegangen sind.«
»Dann habt ihr also nicht denselben Vater?«
»Doch, wir sind richtige Brüder. Zach hat nur ... nun ja, er hat vor einer Weile seinen Namen geändert. Warum, weiß ich nicht. Hier draußen tun Männer das manchmal, wenn sie das Gesetz übertreten haben.«
Ein Rauhfußhuhn, dick wie ein gut gefüttertes Farmhuhn, rannte vor ihnen über den Weg, und das Pferd scheute im Geschirr.
»Siehst du, Clementine«, sagte Gus, »siehst du die blaßvioletten Blumen? Es sind Anemonen. Die Indianer nennen sie ›Erdohren‹. Und die rosa Blumen sind Prärierosen. Die Hühner und Wachteln fressen sie gern. Die Schwarzbären leider auch.«
Clementine blickte nicht auf die Anemonen und nicht auf die Prärierosen. Sie blickte auf ihn, und sie spürte eine schmerzliche Mischung aus Liebe und Enttäuschung. »Du hast einen Mund wie eine Bärenfalle, Mr. McQueen.«
Die Spitzen seines Schnauzbartes zuckten. »Ach ...«
»Ja«, sagte sie und imitierte seine schleppende Redeweise, so gut sie konnte. »Du schweigst wie ein Grab.«
Er zog die Zügel an. Der Wagen hielt. »Was willst du wissen?«
»Warum hast du mir nicht gesagt, daß dein Vater Pfarrer ist?«
Er lachte. »Weil er es genaugenommen nicht ist. Na ja, er bezeichnet sich als ›Reverend‹, aber ich glaube nicht, daß er von jemandem geweiht worden ist, der dazu berechtigt war, es sei denn, vom Teufel persönlich. Ihm ging es immer nur um seine sehr menschlichen Freuden und um das Geld anderer Leute. Obwohl ... mit seinen angeblichen Wundern und den frommen Worten kann er den Leuten Gott besser verkaufen als jeder andere.« Er verzog den Mund und schüttelte den Kopf, als sei das, was er gerade gesagt hatte, so unwahrscheinlich, daß er es selbst nicht glaubte. »Hin und wieder behauptet er, ein ›Doktor‹ oder ›Professor‹ zu sein, wenn er Wunderheilmittel oder nicht existierende Goldminen verkauft. Mein Gott, wenn er anfängt zu reden, könntest du schwören, daß er in der Lage ist, einfach alles zu verkaufen.«
Es klang, als sei sein Vater ein Betrüger. Sie konnte sich nicht vorstellen, daß ein solcher Mann einen Sohn wie Gus großgezogen haben sollte. Aber Gus war ja auch bei seiner Mutter aufgewachsen. »Trotzdem muß er ein intelligenter Mann sein, Mr. McQueen«, sagte sie, denn sie wollte ihn nicht verletzen und spürte, daß er sich schämte. »Zumindest ein Mann mit großer Erfahrung, wenn er ›alles‹ verkaufen kann.«
»Nun ja, er ist Magister der Philosophie, oder zumindest behauptet er das. Er hat sogar ein Stück Pergament mit einem Siegel, um es zu beweisen.« Er schob die Lippen vor und starrte in den leeren Himmel. »Aber ein wirklicher Meister ist er darin, das Bedürfnis der Menschen, an etwas zu glauben, zu seinem Vorteil zu nutzen. Ich nehme an, du begreifst jetzt, daß ich dir nichts von ihm sagen wollte, nachdem ich gesehen hatte, woher du kommst.«
Er brach unvermittelt ab, als sei ihm die Luft ausgegangen. Sie berührte seine Hände, die die Zügel umklammerten. »Mir ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern nur, wo du jetzt bist.«
Er senkte den Kopf und blickte auf den Wagenboden. »Ich wollte dir nichts von Zach sagen, weil ich möchte, daß du ihn nicht ablehnst. Aber ich fürchte, daß du ihn nicht mögen wirst. Er ist ... nun ja, sehr rauh und wild.«
Aus einem unerfindlichen Grund hätte sie am liebsten gelächelt. »Annie hat gesagt, er ist ein Halunke.«
»Es war nicht leicht, etwas anderes zu werden, wenn man bei Reverend Jack McQueen aufwachsen mußte.«
Er schnalzte mit der Zunge, und die braune Stute setzte sich mit einem Ruck in Bewegung. Der Wagen rollte durch das dichte, feuchte Gras. Der Wind wehte immer noch trocken und warm. Gus versank in düsteres Schweigen. Diesmal war er nicht zornig, sondern eher niedergeschlagen.
Sie fragte sich nach dem Grund für das Auseinanderbrechen der Familie McQueen. Warum war Gus mit seiner Mutter nach Boston gegangen und sein Bruder zurückgeblieben? Sie öffnete den Mund, um ihn das alles zu fragen, als Gus halb vom Sitz aufstand und die Hand über die Augen legte. Sie spürte seine Aufregung. Sie hatten gerade den Kamm einer Anhöhe erreicht und sahen, daß vor ihnen auf dem Weg ein Mann ging. Er führte ein Pferd, und über dem Sattel lag etwas, das aussah, als sei es tot.
»Es ist Zach ... Zach!«
Gus winkte mit seinem Hut und stieß einen lauten Schrei aus. Er trieb das Pferd an, und der Wagen hüpfte und schwankte über die aufgeweichte Erde.
Der Mann blieb stehen und drehte sich um. Er war groß und schlank. Von der Hüfte aufwärts war er nackt. Die breiten Schultern und der muskulöse Oberkörper waren von der Sonne gebräunt. Blut klebte an seiner Haut. Beim Näherkommen sah Clementine, daß im Sattel ein ebenso blutiges Kalb lag.
Gus schlang die Zügel um den Bremsengriff und sprang vom Wagen. Er breitete die Arme aus, um seinen Bruder zu umarmen, überlegte es sich aber anders. »Mein Gott, Zach, du bist beinahe so nackt und blutig wie das Kalb«, sagte er.
Der Mann, sein Bruder, sagte nichts, nicht einmal Guten Tag.
»Du hast sicher gerade mit dir gewettet, daß ich nicht zurückkomme«, sagte Gus und lachte.
Zach Rafferty machte einen Schritt auf den Wagen zu. Jeder Muskel in Clementines Körper spannte sich. Ihr stockte der Atem. Sie hatte noch nie zuvor einen so nackten Mann gesehen. Selbst Gus, mit dem sie verheiratet war, hatte sich vor ihren Augen noch nicht nackt ausgezogen. Sie wollte den Blick abwenden, konnte es aber nicht, denn sie fand ihn nicht abstoßend. Schweiß und Blut glänzten auf seiner Haut, verklebten die Haare und liefen ihm langsam über den Bauch. Am Gürtel seiner Hose hinterließen sie einen dunklen Fleck. Der Mann sah gefährlich und wild aus.
Er steckte die Daumen in den Patronengürtel, der um seine Hüften hing. Den staubigen schwarzen Hut hatte er tief in das schmale kantige Gesicht gezogen. Die weiche Krempe verdeckte seine Augen. Er roch nach Blut und den animalischen Ausdünstungen der Geburt. Die Stute schnaubte.
Das Kalb muhte und durchbrach die gespannte Stille. Gus lächelte nicht mehr. Er wies mit dem Kinn auf das Kalb. »Und was ist mit seiner Mutter?«
»Tot«, erwiderte Zach Rafferty. Er hatte einen solchen Südstaatenakzent, daß es klang, als hätte das Wort zwei Silben. »Die Wölfe haben sie erwischt.«
Gus schob die Hände in die Manteltasche und zog die Schultern hoch. »Na ja, ich nehme an, da ich zurück bin, kannst du dir denken, daß Mutter tot ist. Es hat lange gedauert, aber sie ist friedlich gestorben. Wir hatten ein anständiges Begräbnis für sie. Es waren viele Leute da.« Er räusperte sich und strich sich über den Schnurrbart. »Sie hat nach dir gefragt, Zach.«
»Ja, da bin ich sicher.«
Er trat näher an den Wagen, so nahe, daß es Clementine vorkam, als stehe er direkt vor ihr. Die Hutkrempe hob sich etwas, als er darunter hervorspähte, um sie zu mustern. Der Wind zwischen ihnen war wie ein trockener, warmer Atem, der ihr ins Gesicht blies.
Er schob den Hut mit dem Daumen höher, um sie besser zu sehen. Er hatte eigenartige Augen. Sie waren ausdruckslos, kalt und fast gelb. Sie glänzten wie geputztes Messing. »So, und wer ist sie?«
Gus zuckte zusammen und blickte verlegen auf Clementine, als habe er sie völlig vergessen. »Meine Frau. Sie ist meine Frau. Clementine Kennicutt. Das heißt, jetzt Mrs. McQueen. Ich habe sie in Boston kennengelernt, und das ist an sich schon eine Geschichte. Du wirst über mich lachen, wenn ich sie dir erzähle, Zach ...«
Der Mann senkte den Kopf. Der Hut verdeckte sein Gesicht bis auf den harten Mund.
»Bruder«, sagte er, »was hast du bloß wieder angestellt?«