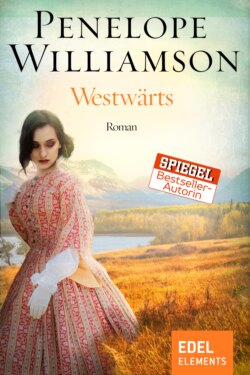Читать книгу Westwärts - Penelope Williamson - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel
ОглавлениеSie hatten geheiratet. Die junge Frau stand am grasbewachsenen Schiffsanlegeplatz und blickte auf die desolate Reihe verwitterter Häuser und lieblos gezimmerter Schuppen, die eine Stadt, nämlich Fort Benton in Montana, darstellten.
Clementine wollte sich nicht erlauben, enttäuscht zu sein. Sie hatte auch bisher noch keinen ›Elefanten‹ gesehen, doch sie vermutete, daß Elefanten, aus der Nähe betrachtet, stinkende, schmutzige Kolosse waren.
Das Dampfschiff hatte sie und ihr Gepäck kaum abgesetzt, als Gus erklärte, er müsse sich sofort um einen Wagen bemühen, der sie in das Regenbogenland bringen werde, denn das war eine kaum befahrene Strecke.
»Warte hier auf mich, Clementine«, sagte er und deutete auf den Boden, als sei sie zu dumm, um zu wissen, was er mit ›hier‹ meinte. Zu allem Überfluß fügte er hinzu: »Rühr dich nicht von der Stelle.«
Sie wollte gerade fragen, ob sie wenigstens im Schatten auf der anderen Straßenseite warten könnte, aber er ging bereits mit großen Schritten davon. Sie folgte ihm mit den Blicken, als er die Straße überquerte und in der gähnenden Toröffnung eines Mietstalls verschwand.
Ja, das war Gus McQueen, ihr Mann. Manchmal, wenn sie ihn ansah, spürte sie ohne jeden Grund ein schmerzliches Ziehen in der Brust. Sie vermutete, daß der Anblick dieses großen, starken und lachenden Mannes schuld daran war.
Ein ablegender Dampfer zog eine Weile ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie vertrieb sich die Zeit damit, die pechschwarzen Rauchwolken aus den beiden Schornsteinen auf dem weiten Weg zum Himmel zu verfolgen. Aber sie hatte den Eindruck, daß diese Wolken eher auf der Erde bleiben würden. Die riesigen Schaufeln des Rades am Heck wühlten das kaffeebraune Wasser auf, das ans Ufer klatschte und den Gestank von toten Fischen und faulenden Pflanzen mitbrachte. Der Raddampfer steuerte mit schrillem Pfeifen und zischendem Dampf zur Flußmitte, und ihr Interesse richtete sich wieder auf die andere Seite der staubigen Straße.
Sie waren sechs Wochen unterwegs gewesen, um dieses Nichts von einer Stadt zu erreichen.
Vor einigen der schäbigen Häuser hingen Schilder. Sie konnte einen Kramladen erkennen, ein Hotel mit einer morschen Veranda und einen Laden, der Sättel und Pferdegeschirr verkaufte. Die hohe Scheinfassade des Kramladens bot auf dieser Seite am Ufer den einzigen Schatten.
Erstaunt stellte Clementine fest, daß Frauen auf den Planken der Anlegestelle auf und ab spazierten. Manche waren allein, aber die meisten gingen zu zweit Arm in Arm und unterhielten sich lachend. Sie waren zum großen Teil herausgeputzt, trugen auffallende Hüte mit Straußenfedern und Seidenblumen und Kleider mit langen, gefältelten und gerüschten Schleppen in bunten Regenbogenfarben. Clementine betrachtete die hübsche Szene sehnsüchtig und auch etwas neidisch. Ihr schwarzseidener Sonnenschirm schien die ungewöhnlich warme Frühlingssonne geradezu auf ihren Kopf zu lenken. Schweißtropfen sammelten sich zwischen den Brüsten, und sie schien mittlerweile am ganzen Körper verschwitzt zu sein. In dem Batisthemd, der langen Flanellunterhose, dem Korsett mit den Stahlstäbchen, dem mit Daunen gefütterten und gesteppten Unterrock mit zwei Volants, dem Baumwolljäckchen und dem hellbeigen Reisekostüm aus Serge mit der samtbesetzten ärmellosen Jacke glaubte sie, bald zu ersticken.
Sie blickte ungeduldig zu dem Mietstall und hoffte, Gus werde endlich auftauchen. Aber sie sah ihn nicht. In dieser langweiligen Stadt gab es bestimmt keine Indianer oder Bankräuber. Warum also die Vorsicht? Warum sollte sie ›hier‹ warten? Sie konnte sich nicht vorstellen, daß es etwas schaden würde, wenn sie über die Straße ging und sich ein paar Augenblicke in den Schatten des Kramladens stellte, der ihr eine wohltuende Erleichterung verschaffen würde. Natürlich würde sie das Gepäck nicht aus den Augen lassen.
Clementine mußte die Röcke heben, um einen Weg zwischen den Pferdeäpfeln und Kuhfladen auf der breiten, ausgefahrenen Straße zu finden. Als sie auf den Gehsteig trat und den Kopf hob, sah sie auf der Veranda des Hotels einen Mann in einem geflochtenen Schaukelstuhl sitzen. Er starrte sehr unhöflich auf ihre Beine. Sie ließ den Rock sinken, obwohl die ausgetretenen Planken schmutzig von getrocknetem Lehm und Spucke waren. Wenigstens hatte ihr Reisekleid nur eine kurze Schleppe. Sie ging auf den Schatten des Kramladens zu, als sie feststellte, daß sich daneben ein Saloon befand. Neugierig spähte sie über die halbhohen Schwingtüren. Durch den Tabakrauch hindurch sah sie das in Fleischfarben gemalte Bild einer üppigen, völlig nackten Frau. An der Theke vor dem Bild lehnten Männer. Sie hatten das Gewicht auf ein Bein verlagert und standen leicht vorgebeugt nebeneinander wie angebundene Pferde. In diesem Saloon drängte sich wahrhaftig eine bunte Mischung. Die Männer sahen alle so aus, als seien sie geradewegs Shonas Wildwestromanen entstiegen: Soldaten in blauer Uniform, Minenarbeiter in ihrer Arbeitskluft und Berufsspieler in schwarzen Anzügen mit weißen Rüschenhemden. Die Luft, die über den Schwingtüren herausdrang, stank nach verschüttetem Whiskey und Schweiß. Dem Klirren von Glas an Glas folgten dröhnendes Gelächter und unanständige Witze. Clementine dachte beklommen, daß es wahrscheinlich selbst in Montana nicht richtig sei, wenn eine Dame ihre Augen und Ohren zu lange einer solchen Szene aussetzen würde.
Als sie sich umdrehte, spürte sie, daß etwas ihren Rock festhielt. Sie blickte nach unten und stellte fest, daß sich das Rädchen einer Spore in der Schleppe verfangen hatte. Ihr Blick wanderte langsam von dem glänzenden Stiefel aufwärts. Neben ihr stand der Mann, den sie auf der Hotelveranda gesehen hatte.
Er muß Kundschafter bei der Armee sein, dachte Clementine mit einem flüchtigen Blick auf seine langen blonden Haare, das gefranste Lederhemd und eine Dolchscheide, die mit Messingknöpfen beschlagen war. Aber der blonde Spitzbart war fleckig von Tabak, und als er den Hut zog, stellte sie fest, daß er schwarze Fingernägel hatte.
»Guten Tag, Madam«, sagte er.
»Guten Tag«, erwiderte sie mit einem höflichen Nicken. Natürlich kannten sie sich nicht, doch Gus hatte ihr bereits erklärt, daß die Leute im Westen freiere Sitten hatten. Sie zog leicht an der Schleppe. »Ich fürchte, Sir, Ihre Sporen haben sich in meinem Rock verfangen.«
Er blickte hinunter und machte übertrieben überraschte große Augen.
»Tatsächlich. Ich bitte um Verzeihung.«
Er bückte sich und löste das Rädchen mit den scharfen Spitzen von dem Stoff. Dabei hob er ihren Rock unanständig weit hoch. Als er sich wieder aufrichtete, grinste er. »Ihnen scheint es eine Spur zu heiß zu sein, wenn ich das sagen darf.« Er legte ihr die Hand unter den Ellbogen. »Wie wäre es, wenn ich Ihnen etwas Kühles und Feuchtes bestelle, um das Feuer in Ihren hübschen Wangen ...«
»Laß sie los!«
Clementine drehte sich um und sah ihren Mann, der so schnell näherkam, daß die verwitterten Planken unter seinem Gewicht knarrten. »Ich habe gesagt, du sollst sie loslassen, verdammt noch mal!«
Gus pflanzte sich vor dem Mann auf. Seine Hände hingen locker an den Seiten, aber sein Körper war hoch aufgerichtet und wie eine Feder gespannt. In seinen Augen blitzte eine Kälte, die sie noch nie gesehen hatte. Auch den Revolver, den er trug, hatte sie noch nie gesehen. Das Halfter hing schwer an dem Patronengurt um seine Hüften.
Sie versuchte, den Arm aus dem Griff des Mannes zu befreien, aber er hielt sie noch fester. Er lachte spöttisch und spuckte seinen Kautabak auf die Stiefelspitze von Gus. »Du hast dich in mein Revier verirrt, Cowboy«, sagte er, und seine Stimme, die vorher so freundlich geklungen hatte, wurde kalt. »Ich habe die Dame zuerst entdeckt.«
»Die Dame ist meine Frau.«
Die Männer starrten sich an. Die Spannung wuchs, und in der Luft lag 1eindeutig die Drohung von Gewalt.
Der Mann wandte jedoch plötzlich den Blick von Gus ab. »Mein Fehler«, sagte er und ließ Clementine los. Dann trat er zurück und hob in einer entschuldigenden Geste die Hände.
Gus packte Clementine am Arm und zog sie so unvermittelt auf die Straße hinunter, daß sie zusammenzuckte. »Ich hatte dir gesagt, du sollst dich nicht von der Stelle rühren, Clem. Glaubst du, du kannst dich darüber hinwegsetzen, damit meine Zunge oder mein Revolver nicht aus der Übung kommen?«
Sie stemmte sich gegen ihn, machte sich los und zwang ihn, sich umzudrehen und sie anzusehen. Ein Wagen fuhr schnell an ihnen vorbei. Seine Räder wirbelten eine Staubwolke auf.
»Du hast mir einen Befehl gegeben, Mr. McQueen, und bist davonstolziert. Wenn du noch so freundlich gewesen wärst und mir den Grund genannt hättest, warum ich ...«
Er beugte sich vor und rief: »Du willst den Grund wissen? Es ist mitten am Nachmittag, Zeit für die Parade der Flittchen. Jede Frau, die um diese Zeit durch die Front Street geht, muß damit rechnen, für eine von denen gehalten zu werden. Willst du, daß die Leute das von dir denken, Clementine? Ich meine, daß du ein Flittchen bist?«
Er ballte die Fäuste, aber sie holte scheinbar unbeeindruckt tief Luft. Vor ihm würde sie sich nicht so fürchten wie vor ihrem Vater.
»Du hast dich immer noch nicht klar ausgedrückt. Was ist ein ›Flittchen‹?«
Gus sah sie einen Augenblick stumm an, dann verflog sein Zorn. Er zog sie an sich und legte ihr die großen Hände auf den Rücken. »Ach Clementine, du bist ein solcher Unschuldsengel. Ein ›Flittchen‹ ist ein gefallenes Mädchen. Eine Frau, die ihren Körper an einen Mann verkauft, der bei ihr nur seine Befriedigung sucht.«
Sie spürte ein leises Beben in seinem Körper, und plötzlich begriff sie, daß er mehr besorgt als zornig gewesen war. Der Gedanke, daß auch er Angst haben konnte, irritierte sie.
»Ich wußte nichts von diesem Brauch im Westen, von einer ›Flittchen-Parade‹.«
»Clementine.« Er nahm ihre Hände und hielt sie fest. »Dieses Wort darfst du niemals benutzen, nicht einmal mir gegenüber.«
»Wie soll ich diese Frauen denn sonst nennen?«
»Du solltest überhaupt nichts von der Existenz solcher Frauen wissen.«
»Aber wir sind in Schwierigkeiten geraten, weil ich nichts von ihnen weiß. Du mußt doch einsehen, daß Unwissenheit in einer solchen Lage nicht hilft. Ich bin kein Kind mehr, Mr. McQueen, ich bin eine erwachsene Frau.«
Er wurde wieder böse. Sie sah es an seinen geröteten Wangen und an der pulsierenden Ader an seinem Hals.
»Ich will nicht mitten auf der Straße stehen und mich mit dir über das Benehmen sittenloser Frauen unterhalten. Komm mit.« Er drehte sich um und ging davon. »Ich habe im Hotel ein Zimmer für uns bestellt.«
Sie trugen das Gepäck in das Hotel mit der altersschwachen Veranda. Kaum waren sie auf dem Zimmer, erklärte Gus, er müsse noch einmal weg, um den Fuhrmann ausfindig zu machen, der angeblich am nächsten Morgen ins Regenbogenland aufbrach. Er zog den Hut tief in die Stirn, nahm den Schlüssel und ging zur Tür.
»Du willst mich doch nicht allen Ernstes hier einschließen«, sagte sie. Die Worte klangen nicht laut, aber trotzdem wie ein Aufschrei.
Er drehte sich um. Von ihm ging etwas aus, das nichts mit dem zu tun hatte, was auf der Straße vorgefallen war. Sie empfand diese Spannung auch in sich. In diesem Augenblick schien alles in ihr bis zum Zerreißen gespannt. Er war nicht der lebendig gewordene Cowboy einer Bildkarte. Er war ein Mann, inzwischen sogar ihr Ehemann. Aber plötzlich wurde ihr bewußt, daß sie ihn überhaupt nicht kannte. Während sie in sein sonnengebräuntes Gesicht und in die himmelblauen Augen blickte, dachte sie, daß sie ihn sehr gern kennenlernen würde.
Er hob plötzlich die Schultern, seufzte und warf den Schlüssel auf den Tisch. »Ich wollte nicht abschließen, damit du nicht hinaus kannst, sondern damit das Gesindel nicht hereinkommt. Es gibt hier nicht viele anständige Frauen, und manche Männer vergessen manchmal ihr gutes Benehmen.«
Ihre Blicke begegneten sich. Er mußte schlucken, und dann saugte er sich mit seinen Augen an ihren Lippen fest. Ihr Mund fühlte sich an, als stünde er in Flammen. Sie mußte sich beherrschen, um nicht mit der Zungenspitze darüberzufahren oder die Finger auf die Lippen zu legen.
Nimm mich in die Arme, wollte sie plötzlich zu ihm sagen, küß mich!
»Warum machst du dich inzwischen nicht frisch?« sagte er mit belegter Stimme. Dann schloß sich hinter ihm die Tür.
Clementine drückte die Faust auf den Mund. Ihr war plötzlich heiß und kalt.
Das Zimmer hatte die Größe einer Pferdebox. Es war nur ein Teil eines größeren Raums, den Holzrahmen abtrennten, die mit Leinwand bespannt waren. Eine der Trennwände reichte bis zur Mitte des einzigen Fensters im Raum. Zwischen der Leinwand und dem Fenster in der Nische war ein breiter Spalt. Sie hörte, wie sich auf der anderen Seite Männer bewegten und unterhielten. Die Leinwand war einmal rot gewesen, inzwischen aber zu staubigem Rosa verblaßt. Als einer der Männer an die Wand trat, sah sie durch den Spalt einen braunen Flanellärmel.
Sie seufzte und blickte neugierig durch die staubigen Scheiben auf die ›Flittchen‹, von deren Existenz sie eigentlich keine Ahnung haben durfte. In ihrem bunten Putz und den gerüschten Schleppen promenierten sie wie Paradiesvögel auf dem Gehsteig. ›Gefallene Mädchen‹ hatte Gus diese Frauen genannt, die sich außerhalb des geheiligten Ehebettes an Männer verkauften.
Das Ehebett.
Sie blickte in die Ecke auf das roh gezimmerte Bett mit seiner mottenzerfressenen grauen Armeedecke und dem klumpigen Strohsack.
Zwischen Mann und Frau gab es Intimitäten, die über Küsse und Umarmungen hinausgingen: sein Bett mit ihm teilen, bei ihm liegen, eins mit ihm werden.
›Ich bin die Freude meines Geliebten, und ihn verlangt nach mir.‹
Worte, heimlich geflüsterte Worte, die heiligen, feierlichen Worte der Schrift waren alles, was sie über die körperliche Liebe wußte. Sie war seine Frau, aber noch hatte es für sie kein ›Ehebett‹ gegeben.
Die Bahnfahrt von Boston nach Saint Louis hatten sie auf harten Holzbänken verbracht, Knie an Knie mit einer deutschen Einwandererfamilie. Wegen der schwankenden, stinkenden Petroleumlampe und des Geruchs nach fetter Wurst und Sauerkraut war Clementine die ganze Zeit übel.
In Saint Louis verbrachten sie dann eine Nacht im Hotel, allerdings in getrennten Zimmern, denn sie waren noch nicht Mann und Frau. Am nächsten Morgen wurden sie von einem Richter getraut. Vom Amtsgericht gingen sie sofort zur Anlegestelle und bestiegen den Raddampfer, der sie den Missouri aufwärts nach Fort Benton bringen sollte.
Es war die erste Fahrt des Dampfers in diesem Jahr. Dank des milden Winters begann der Schiffsbetrieb über einen Monat früher als gewöhnlich. Saint Louis lag erst einen Tag hinter ihnen, als der Kapitän den Rauch eines Konkurrenten entdeckte und die Fahrt zu einem Rennen wurde, um herauszufinden, wer im schwierigen Wasser schneller vorankam. Dabei galt es, den Eisschollen und den entwurzelten Bäumen auszuweichen, die in der reißenden Strömung trieben. Sie legten nur an, um Feuerholz aufzunehmen, und fuhren sogar nachts; dabei mußten sie die Fahrrinne im Schein von Laternen ausloten.
Clementine hatte eine riesige Büffelherde gesehen, die wie ein undeutlicher dunkler Fleck am Horizont aufgetaucht war. Einmal hatten feindliche Indianer auf sie geschossen. Gus sagte, es seien die Sioux, die erst drei Jahre zuvor General Custer am Little Big Horn niedergemetzelt hatten. Aber die Indianer waren zu weit weg, und Clementine konnte nicht einmal die Federn ihres Kopfschmucks sehen. Die Schüsse trafen ins Wasser und knallten wie harmlose Feuerwerkskörper.
In der Sicherheit des Flußdampfers fand Clementine das alles sehr aufregend. Es war, als erlebe sie ein Abenteuer aus einem von Shonas Romanen. Gus war dabei weniger ihr Ehemann als ihr Gefährte. Er war der erfahrene Kundschafter, sie die unermüdliche Entdeckerin.
Die Nächte verbrachten sie mit den Arbeitern in einem großen Raum, in dem Holz lagerte, oder auf Pritschen auf dem zweiten Deck unter einem luftigen Dach aus Segeltuchplanen – ihre Nächte waren niemals ungestört.
»Ich dachte, du wolltest dich frisch machen.«
Sie drehte sich erschrocken um, denn sie hatte nicht gehört, daß die Tür geöffnet wurde. Gus schloß sie mit dem Stiefelabsatz. Er kam zu ihr, bis sie nur noch eine Handbreit voneinander entfernt waren. Noch nie war sie sich seiner als Mann, seiner Größe und der harten männlichen Stärke deutlicher bewußt gewesen. Sie dachte an das Bett in der Ecke, ihr Ehebett. Sie versuchte vergeblich zu schlucken. Ihr Mund war so trocken wie die staubige Straße vor dem Fenster.
»Würdest du etwas für mich tun, Clem?«
Sie nickte stumm. Sie konnte nicht einmal atmen. Im Nebenzimmer räusperte sich ein Mann und spuckte aus. Ein anderer Mann fluchte schrecklich. Dann hörte man einen dumpfen Schlag, als sei ein Stiefel an eine Wand geworfen worden, und noch einen Fluch.
»Würdest du deine Haare für mich lösen?«
Ihre Hände zitterten, als sie die Arme hob, um die schlichte, schwarze Filzhaube abzunehmen, die keine Federn schmückten. Er nahm sie ihr ab und warf sie auf das Bett, ohne den Blick von ihr zu wenden. Sie zog eine Nadel nach der anderen heraus, und das Haar fiel ihr in dicken Locken auf die Schultern. Sie schüttelte den Kopf, und es legte sich weich bis über den Rücken. Es reichte ihr bis zur Taille.
Er fuhr mit den Fingern hindurch, hob es hoch, ließ es fallen und betrachtete es, während es durch seine Finger glitt. »Du hast Haare wie flüssiges Gold, Clementine, und sie sind auch genauso weich. Alles an dir ist so weich. So weich und fein.«
Er senkte den Kopf, und sie dachte: Er wird mich küssen.
Er hatte sie schon geküßt, doch sie wußte, dieser Kuß würde anders sein. Er würde zu etwas führen, das sie für immer verändern, das sie zeichnen würde wie ein Brandmal.
›Laß ihn mich küssen mit den trunkenen Lippen meines Mundes, denn seine Liebe ist süßer als Wein.‹
O ja, genau das wollte sie! Sie wollte ihn lieben.
»Clementine.«
Sie versuchte zu lächeln und das Zittern in den Beinen zu unterdrücken.
»Ja ...« Aber in ihrem Erfahrungsschatz gab es keine Worte, mit denen sie ihm hätte sagen können, was sie wollte.
Er bewegte die Hand nicht mehr, da er ihr Zittern und Schweigen als Widerstand deutete. »Du bist vor dem Gesetz meine Frau, Clem. Ich habe ein Recht darauf.«
»Ich weiß, ich weiß.« Sie schloß die Augen.
›Laß ihn mich küssen mit den trunkenen Lippen meines Mundes ... Laß ihn mich küssen ...‹
Einer der Männer nebenan benutzte den blechernen Nachttopf. Man hörte ein Klatschen und Spritzen, und dann ein unmanierliches anderes Geräusch, das nur auf der Toilette angebracht war. Clementine zuckte zusammen und wurde über und über rot, da die entsetzlichen Geräusche nicht aufhörten, die klangen wie das Nebelhorn in der Bucht von Boston.
»Ach du Schande«, stöhnte Gus, als es nebenan endlich still wurde. Er schenkte ihr ein strahlendes Gus-McQueen-Lächeln. Dann senkte er den Kopf, aber er rieb nur seine Nasenspitze an ihrer Nase.
»Ein Mann darf keine Dame heiraten und sie dann zum ersten Mal an einem solchen Ort lieben, wo man praktisch durch die Wand spucken kann. Ich will, daß es schön für dich ist und anständig, wie es zwischen Mann und Frau sein sollte.«
Er fuhr mit der Hand durch ihre Haare und hob sie an den Mund, als wollte er sie trinken. Ihr stockte der Atem, und sie begann zu zittern.
»Ich weiß, du hast Angst, Clem. Aber ein Mann erwartet nicht, daß eine so wohlerzogene Frau wie du das leichtnimmt, was im Schlafzimmer vor sich geht. Ich glaube, wenn ich mein ganzes Leben lang auf dich gewartet habe, kann ich auch noch eine Weile länger warten. Es wird mich nicht umbringen, wenn ich zuerst noch ein bißchen um dich werbe.«
Sein Atem ging so schnell wie der ihre, und er bebte innerlich genau wie sie.
Clementine dachte, er kann mich ebensogut im Bett umwerben, aber sie sagte es nicht. Sie war eine wohlerzogene Dame und ahnte nichts von dem, was im Schlafzimmer zwischen Mann und Frau vor sich geht.
»Mein Gott, Jeb!« sagte nebenan jemand mürrisch. »Jetzt stinkt es hier wie in einem Kuhstall.«
Sein Kopf fiel nach vorne und stieß beinahe mit ihrem Kopf zusammen. Er lachte. Sie liebte sein Lachen. »Ich glaube, hier sind mehr ›Elefanten‹, als du jemals gehofft oder geglaubt hast kennenzulernen«, sagte er und lachte so ungezwungen, daß sein Atem weich und warm ihren Hals streifte.
»Das macht mir nichts aus«, erwiderte sie leise. Sein Atem an ihrem Hals ließ sie erbeben, und etwas prickelte mehr und mehr, bis sie sich auf die Unterlippe beißen mußte, um nicht laut aufzustöhnen.
»Natürlich macht es dir etwas aus. Aber es wird besser, du wirst schon sehen. Es wird in Zukunft alles eher so sein, wie du es gewöhnt bist.« Seine Hand strich sanft, ach so sanft über ihren Nacken bis zu den Schultern. »In der ersten Nacht zu Hause werde ich dich erst richtig zu meiner Frau machen.«
»Leg ihm einen Nickel zwischen die Ohren!« befahl die Maultiertreiberin. »Und hör auf wie ein Esel zu grinsen, der einen Kaktus frißt.«
Gus McQueen preßte die Lippen zusammen, aber er hatte Lachfalten um die Augen, als er eine Fünfcentmünze aus der Westentasche zog. Er schlenderte zu dem Tier an der Spitze des Gespanns, beugte sich vor und legte dem Maultier die Münze zwischen die langen Ohren. Die sechzehn Maultiere standen grau und so bewegungslos, als seien sie ausgestopft, mitten in der Prärie von Montana.
Seine junge Frau sah zu. Sie saß neben der Maultiertreiberin auf dem Sitzbrett des Wagens. Wenn man nicht genau hinsah, konnte man nicht erkennen, daß eine Frau das Gespann kutschierte. Ihr Gesicht war so braun und verwittert wie Sattelleder. Sie trug Stiefel in Männergröße, und ihre Hose starrte vor Schmutz, Flecken und Fett. Auf ihren kurzgeschnittenen Haaren saß ein zerbeulter weicher Filzhut, dessen breite Krempe über der Stirn mit ein paar Dornen hochgesteckt war. Es war der schmierigste Hut, den Clementine je gesehen hatte.
Die Frau schlüpfte betont umständlich aus den Ärmeln ihres Öltuchmantels und schob ihn nach unten. Dann rollte sie die Ärmel ihres groben Leinenhemdes hoch. Ihr Arme waren so knotig wie Männerarme und dick wie Baumstämme. Sie streifte die Lederhandschuhe von den Händen und spuckte in die bärentatzengroßen Handteller. Langsam hob sie die geflochtene Lederpeitsche aus der Halterung.
Nickel Annie behauptete, sie sei etwas Besonderes, denn sie fuhr als einzige Frau in Montana ein Maultiergespann. Ihr Wagen war für schwere Ladungen und schwieriges Gelände gebaut. Jetzt war er vollbeladen mit Bergwerksgeräten, Möbeln, Fässern, einem Bündel säuerlich riechender Büffelhäute und einem Klavier. Das Klavier war für die einzige Spelunke in Rainbow Springs, die einzige Stadt im Regenbogenland, bestimmt. Annie nannte die acht Paar Maultiere ihre Babys. Aber sie kutschierte wie ein Mann unter lautem Fluchen und Peitschenknallen.
Nickel Annie umfaßte den bleigefüllten Peitschenstiel aus Hickoryholz mit beiden Händen. Sie schob den Priem von einer Backe in die andere und sah Clementine grinsend an. »Seid ihr beiden bereit?«
»Bereit?« sagte Gus McQueen. »Ich warte schon so lange, daß ich Moos angesetzt habe.«
Clementine preßte die Lippen zusammen, um nicht laut zu lachen. Ein Falke schwebte in der Luft, und das Summen des ewigen Winds füllte ihre Ohren. Plötzlich bewegte sich der Arm der Frau so schnell rückwärts und vorwärts, daß Clementine die Bewegung nur verschwommen wahrnahm. Siebeneinhalb Meter geflochtene Peitschenschnur entrollten sich und knallten wie ein Feuerwerkskörper am vierten Juli. Die Fünfcentmünze wirbelte hoch in die Luft, höher und höher, bis sie wie ein Regentropfen in der Sonne glänzte. Gus versuchte, sie aufzufangen, doch es gelang ihm nicht. Die Maultiere standen da, ohne sich zu rühren.
»Und deshalb«, sagte die Maultiertreiberin mit einem Grinsen, das ihr Gesicht in zwei Hälften teilte und die braunen Zähne enthüllte, »nennt man mich Nickel Annie.«
»Ach, und ich dachte die ganze Zeit, es käme daher, daß du so billig bist«, erwiderte Gus: Clementine legte die Hand auf den Mund, weil sie lächelte.
»Ein Nickelfuchser!«Annie warf den Kopf zurück und lachte laut. »Ein Nickelfuchser!« Wieder einmal spuckte sie braunen Tabaksaft, dann griff sie nach den Zügeln. Der Wagen setzte sich mit einem Ruck in Bewegung. Clementine hielt sich schnell am Sitz fest, um nicht kopfüber auf die Steine, in das hohe Eisenkraut und Präriegras zu fallen. Gus sprang wieder auf sein Pferd und ritt neben ihnen.
»Bring mir meinen Nickel wieder, Cowboy«, sagte Annie nach längerem Schweigen.
»Es ist mein Nickel.«
»Nein, nicht mehr. Den habe ich mir ehrlich verdient. Außerdem kommt es mir irgendwie nicht richtig vor, einen Nickel einfach mitten in der Prärie liegenzulassen, wo irgendein Unschuldiger darüber stolpern und sich das Bein brechen kann. Stell dir vor, ein Karnickel könnte ihn verschlucken, weil es ihn für eine Distel hält, und Bauchgrimmen davon bekommen. Ein Indianer könnte ihn finden und sich von dem Geld vollaufen lassen und wie ein Wilder alle möglichen Leute skalpieren, und am Ende wären wir alle tot wie General Custer. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich der Meinung, Cowboy, du bist es Mensch und Tier schuldig, mir meinen Nickel zu holen.«
Clementine blickte auf die Fahrspuren hinter ihnen, die als Straße galten. Der Wind trieb die Staubfahne auseinander, die der Wagen aufwirbelte. Nichts wies auf die Stelle hin, an der das Fünfcentstück gelandet war.
Gus wendete sein Pferd mit einem gespielten Seufzen. Er drückte sich den Hut in die Stirn, schob die Stiefel weit in die Steigbügel und verkürzte die Zügel. Scheinbar unvermittelt, sie hatte nicht gesehen, daß Gus etwas getan hätte, fiel das Pferd in Galopp.
Gus lehnte sich seitlich tief aus dem Sattel, und seine Hand fuhr durch das hohe Gras. Er hatte sich kaum wieder aufgerichtet, als er das Pferd so scharf wendete, daß es auf die Hinterhand stieg. Er galoppierte zurück, an ihnen vorbei und warf Nickel Annie die Münze zu, die sie in der Luft auffing. Sie biß darauf und stopfte sie in die Tasche ihrer Lederhose. Gus ritt weiter und verschwand hinter einem mit staubgrauem Salbei bewachsenen Hügel.
Clementine sah ihm sehnsüchtig nach. Er ritt mit Hilfe der Oberschenkel und der Spitzen der Sporen, und sie war sehr stolz auf ihn, auf ihren Mann, ihren Cowboy.
Sie war allerdings nicht ganz sicher, ob es ihr gefiel, daß er einfach davonritt und sie in Gesellschaft der vulgären Nickel Annie allein ließ. Sie hatte das Gefühl, die Maultiertreiberin stellte sie ständig auf die Probe. Bisher hatte sie jedesmal traurig versagt.
»Man braucht ein mutiges Herz, um in dieses Land zu kommen und sich ihm zu seinen Bedingungen zu stellen«, hatte Annie einmal gesagt und Clementine damit indirekt zu verstehen gegeben, ihr Herz sei bei weitem nicht mutig genug.
Normalerweise lenkte Annie das Gespann, indem sie auf dem hintersten linken Maultier ritt. An diesem Tag hatte sie sich dafür entschieden, zusammen mit Clementine auf dem Wagen zu fahren. Der Sitz war nichts als ein ungehobeltes Brett, das zwischen die hohen Seitenwände des Wagens genagelt worden war.
Clementine klammerte sich auf ihrem Platz hoch über dem Boden so fest an das rauhe Holz, daß die Knöchel an ihren Händen weiß hervortraten. Der Weg war holprig und von tiefen Fahrspuren durchzogen. Der Wagen schaukelte und schwankte wie ein Ruderboot bei hohem Seegang. Sie begriff inzwischen, warum man diese Wagen ›Rückgratbrecher‹ nannte. Sie spürte jede Meile in allen ihren Knochen.
Meilen ...
Sie hatten in der Woche seit ihrer Abfahrt aus Fort Benton endlos viele Meilen zurückgelegt: Flache Meilen durch olivgrünen Salbei und wogendes Gras. Aber jetzt lagen die steilen Berge, die bisher nur undeutliche Höcker in der Ferne gewesen waren, direkt vor ihnen. Die Ebene hob sich wie die Brandung am Meer zu spitzen und runden Kämmen, die mit Kiefern bewachsen waren, und sank zu tiefen, felsigen, von Gestrüpp überwucherten Tälern ab, in denen noch Schnee lag.
Ein heftiger Windstoß versetzte ihr einen Stoß und trieb ihr den Staub ins Gesicht, der wie tausend Nadeln stach. Es war kalt. Die Sonne versteckte sich hinter Wolken, die dick und wollig wie eine Pferdedecke waren. Am Tag zuvor hatte die Sonne heiß und grell geschienen. Clementine hatte noch nie im Leben so geschwitzt. Noch immer spürte sie die Reste vom Schweiß des Vortages klebrig und rauh auf der Haut. Sie vermutete, daß sie auch nach Schweiß roch, aber bei dem scharfen Gestank, der von den ungegerbten Büffelhäuten und von Nickel Annie ausging, die sich wahrscheinlich jahrelang nicht gewaschen hatte, konnte sie den eigenen Schweiß nicht riechen.
Auf der Ranch am Weg, wo sie die Nacht verbracht hatten, war kaum Gelegenheit gewesen, sich zu waschen. Das Haus war eigentlich nur ein Schuppen gewesen. Als sich Clementine vor dem Abendessen, das aus gekochten Kartoffeln und Dosenmais bestand, waschen wollte, fand sie im Waschtrog nur ein bißchen schaumige Brühe und in einer leeren Sardinendose einen Rest Seife von der Größe ihres Daumennagels. Das zerschlissene Handtuch war schwarz wie das Innere eines Kohlenkastens. Die Betten waren nicht weniger schrecklich – roh gezimmerte Pritschen mit Matratzen aus grobem Sackleinen und mit Präriegras gestopft, mit ›Montana-Daunen‹, wie Gus lachend gesagt hatte. Die Wand hinter den Betten war fleckig von zerquetschtem Ungeziefer.
Clementine schauderte es jetzt noch, wenn sie daran dachte. Ein Windstoß wirbelte eine neue Staubwolke auf und trieb sie in ihr Gesicht. Sie wischte sich Stirn und Wangen mit einem schmutzigen Taschentuch und leckte den Präriestaub von den Zähnen. Sie wußte bereits, daß sie Montana hassen würde, weil niemand und nichts hier sauber sein konnte. Aber sie war nicht enttäuscht, denn sie hatte den Cowboy ihrer Träume gefunden, und er war ihr Mann.
Ihr Mann ...
Sie sah ihn in der Ferne durch schlanke Pappeln reiten. Er saß groß und lässig im Sattel der hellbraunen Stute, die er in Fort Benton gekauft hatte. Wenn sie ihn ansah, stieg eine prickelnde Wärme in ihr auf. Er war ein besonderer Mann mit seinem Lächeln, seinem Lachen und seiner klangvollen dunklen Stimme. Mit dem sonnengebräunten Gesicht und den hellbraunen Haaren, die von der Sonne gebleicht waren, sah er aus, als sei er in Gold getaucht.
»Eine unendliche Weite aus Gras, Clementine«, hatte er ihr mit diesem leuchtenden Blick gesagt, den er immer bekam, wenn er von seinem Traum sprach: Er wollte seine ›Rocking R‹ zu einer Rinderranch ausbauen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hatte. »Montana ist eine unendliche Weite aus Gras, und man braucht es sich praktisch nur zu nehmen.« Wenn er vom Regenbogenland sprach, von seiner wilden Schönheit und der weiten offenen Prärie, spürte sie so etwas wie Musik in ihrem Blut.
›Eine unendliche Weite aus Gras ...‹
Sie hätte nie geglaubt, daß es so etwas gab, ohne es mit eigenen Augen gesehen zu haben. Montana war ein endloses Panorama von wogendem Gelb und Grün, durch das unablässig der Wind fuhr. Alles schien nach Salbei zu riechen. Sie hob den Blick zu den Bergen, die schwarz und grau vor ihnen aufragten und deren Gipfel schneegekrönt waren. Dieses Land hatte etwas Grenzenloses. Gus nannte es ›Ellbogenfreiheit für das Herz‹. Doch das ganze Land war wie der Himmel so wild und ungezähmt, daß sie es manchmal doch mit der Angst zu tun bekam.
Die Lederpeitsche zischte zweimal durch die Luft und knallte wie ein Gewehrschuß über dem Kopf eines Maultiers, das faul im Geschirr ging, und riß es aus seiner Apathie.
»Hüh, Annabell!« schrie Annie. »Hüh, du gottverdammtes Hurenvieh!«
Clementine mußte sich große Mühe geben, nicht zu lächeln, obwohl sie zu spüren glaubte, daß ihr die Ohren glühten. Die Maultiertreiberin war alles andere als kultiviert. Nickel Annie war stolz auf ihre dröhnende Stimme und ihr loses Mundwerk. Sie prahlte damit, daß sie die Maultiere mit ihren Flüchen wirkungsvoller antreiben könne als mit der Peitsche.
Annie zog eine Rolle Kautabak aus dem Stiefel und biß mit ihren maultierähnlichen Zähnen ein Stück ab. Sie kaute eine Weile darauf herum und spuckte dann aus. Clementine erstarrte, als der braune Saft an ihrem Gesicht vorbeischoß und klatschend auf der Wagendeichsel landete. Aber zum ersten Mal zuckte sie nicht zusammen.
»Du hast gestern gesagt«, begann Annie mit einer Stimme, die sanft genug war, um ein kleines Kind in den Schlaf zu wiegen, »daß dein Vater Pfarrer an irgendeinem Tempel in Boston ist.«
Ein trockener Busch der allgegenwärtigen Steppenhexe löste sich von einem Stein, rollte davon und erschreckte ein Steppenhuhn. Der Vogel flog mit einem eigenartig schwirrenden Geräusch auf, doch Clementines Blick folgte seinem Flug nicht. Sie wußte aus bitterer Erfahrung sehr wohl, Annie baute sie sozusagen wie die Zielscheibe auf einem Jahrmarkt auf, um sie mit einer Bemerkung zielsicher so zu treffen, daß Clementine über und über rot werden würde.
»Ja, am Tremont Tempel. Waren Sie vielleicht schon einmal dort?« fragte sie mit ihrem Beacon-Hill-Salon-Lächeln. Sie war entschlossen, sich gegen diese vulgäre Frau auf ihre Weise zu behaupten.
Annie zog die Lippen breit und entblößte ihre vom Tabak verfärbten Zähne. »Na ja, der Vater von Gus ist ja auch so einer, der Bibelsprüche klopft, aber wahrscheinlich weißt du das schon. Der alte Jack McQueen!« Sie lachte anzüglich. »Ein Wanderprediger ist er, der Vater von Gus. Nicht so einer wie deiner, der seine Predigten in einer richtigen Kirche hält. Sogar in einem Tempel ...« Sie lachte so laut, als sei es ein vortrefflicher Witz. Dann sagte sie schmunzelnd: »Also mir ist im Laufe der Jahre an Söhnen von Predigern etwas Komisches aufgefallen. Sie sind alle entweder Gauner oder haben sich in ihrer Rechtschaffenheit wie in einer Schlinge gefangen. Dazwischen gibt es nichts.«
Clementine blickte auf die Wagenspuren, die sich vor ihnen wie schmale Bänder durch die Prärie zogen. Gus hatte ihr nicht gesagt, daß sein Vater ein Pfarrer war. Eigenartig, daß er es nicht für nötig gehalten hatte, diese Gemeinsamkeit ihrer Väter zu erwähnen. »Mr. McQueen ist ein guter Mann«, sagte sie laut, wünschte aber sofort, sie hätte es nicht getan, denn es klang ganz danach, als wollte sie sich selbst davon überzeugen, daß Gus in keiner Hinsicht ihrem selbstgerechten Vater glich.
Annie lachte leise. »O ja, dein Mann, dein Gus ist ein wahrer Heiliger. So wie das Wort Gauner auf seinen Bruder zutrifft.«
Sie blickte mit einem selbstzufriedenen Grinsen auf Clementines vom Wind gerötetes Gesicht. »Gus hat dir doch sicher von seinem Bruder erzählt. Sie sind Partner auf der ›Rocking R‹. Jedem gehört die Hälfte, und jeder versucht, sie so zu führen, als gehöre ihm der ganze Laden. In Rainbow Springs sind schon Wetten darauf abgeschlossen worden, wie lange das noch gutgeht. Du kannst es mir glauben, es gibt keine zwei Schneeflocken, die verschiedener sind als Gus McQueen und Zach Rafferty.«
Kein Wort! Er hatte ihr kein Wort davon gesagt. Erst am Vortag hatte er ihr vorgeworfen, sie sei zugeknöpft, weil es ihr so schwerfiel, über ihre Gedanken und Gefühle zu sprechen. Dabei hatte er selbst Geheimnisse. Er hatte seine Ranch so oft in den herrlichsten Farben beschrieben – die saftigen Wiesen mit den Blumen inmitten von steilen Bergen und hohen bewaldeten Hügeln. Er hatte aber kein einziges Mal erwähnt, daß er die Ranch mit seinem Bruder teilte.
Sie fragte sich, ob dieser Bruder jünger oder älter war als Gus und warum sie nicht denselben Namen trugen. Aber es war Sache ihres Mannes, ihr diese Dinge zu sagen. Hinter seinem Rücken über ihn und seinen Bruder zu sprechen, wäre Verrat an ihm gewesen, häßlicher Klatsch, wie ihre Mutter gesagt hätte. Clementine beschloß, sich in Schweigen zu hüllen und Nickel Annie schmoren zu lassen.
Die große Wagenachse knarrte, die Eisenreifen der Räder knirschten auf dem steinigen Boden, und der Wind wimmerte. Clementine räusperte sich. »In welcher Hinsicht sind die Brüder verschieden?«
Nickel Annies Gesicht wurde ganz faltig, als sie grinste. Sie spuckte noch mehr Tabaksaft klatschend auf die Wagendeichsel und richtete sich auf eine lange Unterhaltung ein, indem sie die Schultern etwas nach vorne hängen ließ. »Es fängt schon damit an, daß Gus als Kind bei seiner Mama war und sich diesen gewissen Ostküstenschliff zugelegt hat, während Rafferty im Westen herumgezogen und so wild wie eine Wanderratte aufgewachsen ist. Man könnte vielleicht sagen, daß Gus zahm ist und Rafferty nicht.«
Annie lachte, und es klang boshaft, als sie sagte: »Und dann ist da Raffertys Lebenswandel, den Gus nicht ausstehen kann. Das Trinken, Kartenspielen und Huren – besonders das Huren. Na ja, es mag ja sein, daß Gus nur der Neid quält. Das erklärt vielleicht auch, warum er dich geheiratet hat. Trotz aller Rechtschaffenheit ist er schließlich auch nur ein Mann, und alle Männer denken mit dem Ding zwischen ihren Beinen. Eine echte Lady, wie du es bist, ist hier jedenfalls so selten wie eine Sonnenblume im Winter.«
Clementine vermutete, daß das ein Kompliment sein sollte – vielleicht auch nicht. Sie lernte allmählich, daß die Menschen hier einen seltsamen Stolz auf ihre ungeschliffenen Manieren hatten, mit denen sie prahlten wie mit Orden und Medaillen.
»Danke«, sagte sie etwas steif.
»Keine Ursache. Weißt du, hier in dieser Wildnis sind Frauen entweder Huren, oder sie sind wie ich und halten alle Männer für falsche Fünfziger. Ich frage dich, was für einen Sinn hat es, mit so einem ins Bett zu gehen? Aber du kannst dich darauf gefaßt machen, daß alle Cowboys, Schafhüter und Goldsucher, die Wölfe und die Maulwürfe, alles, was es hier so an Männern gibt – sie werden meilenweit reiten, um dich zu bestaunen. Schließlich bist du eine große Seltenheit. Es gibt keinen Mann hier, der nicht viel dafür geben würde, die Köchin, Haushälterin, Wäscherin und Sklavin für alles zu bekommen, die du für deinen Mann sein wirst. Jawohl, Kleines, Sklavin, Zuchtstute und Betthase! Man stelle sich das vor! Das alles in den gestärkten Klamotten einer richtigen Lady. Bei allen Heiligen, ein solches Wunder ist überhaupt nicht zu fassen.« Sie lachte laut. »Schätzchen, du bist nicht nur eine Seltenheit, du bist der Inbegriff aller Männerträume!« Annie machte eine Pause, und sofort hörte man wieder den Wind heulen.
Ein Maultier bewegte die langen Ohren und schnaubte. Clementine blieb stumm und bewegungslos.
Ich lasse mich von ihr nicht provozieren, schwor sie sich. Sie war charakterfest und würde es unter Beweis stellen, daß sie sich nicht aus der Fassung bringen lassen würde.
»Ach ja«, fuhr Annie mit einem übertriebenen Seufzen fort, »Zach Rafferty wird es bestimmt nicht gefallen, wenn er feststellt, daß sein Bruder eine Frau auf die Ranch bringt, die dort alles zivilisierter haben will. Aber die wirkliche Überraschung wartet auf Gus.«
»Was meinen Sie damit?« fragte Clementine gegen ihren Willen.
Nickel Annie beugte sich so weit vor, daß ihr stinkender Atem Clementines Gesicht traf. »Mrs. McQueen. Du bist die Überraschung! Weil du unter deinem ganzen tugendhaften, schüchternen und süßen Gehabe, das du nach außen zeigst, eine heißblütige Frau bist, die nur darauf wartet, so richtig loszulegen. Aber das sieht Gus nicht ... noch nicht.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden«, sagte Clementine und machte einen verkniffenen Mund, weil sie log. Nickel Annie hatte irgendwie die Wildheit, das Böse in ihr gesehen. So wie ihr Vater es gesehen hatte. So wie Gus es nicht gesehen hatte und nie sehen würde, wenn es nach ihr ging.
»Ich bin nicht so, wie Sie gesagt haben.« Sie strich den braunen Rock über den Knien glatt. Sie vergewisserte sich, daß die Haarnadeln und der dicke Haarknoten im Nacken noch richtig saßen. Sie fühlte sich irgendwie unsicher.
›... heißblütige.‹
»Und was Mr. Rafferty angeht, so wird er sich damit abfinden müssen, daß sein Bruder verheiratet ist.«
Nickel Annie lachte schallend. »Zum Teufel, bei Zach Rafferty gibt es so etwas wie ›Abfinden‹ nicht!«
Sie kampierten in dieser Nacht unter einer Esche am Wegrand, in die der Blitz eingeschlagen hatte. Nickel Annie machte zum Abendessen dicke Bohnen und Mais aus der Dose. Sie zeigte Clementine, wie man in einer Bratpfanne Brötchen backt. Clementine setzte sich zum Essen auf die Wagendeichsel in einigem Abstand von Annie und Gus und dem stinkenden Feuer aus Salbei und Büffelfladen. Sie ließ die Beine baumeln und sah zu, wie die Spitzen ihrer geknöpften schwarzen Ziegenlederstiefeletten wie Wagenräder parallele Spuren im hohen Präriegras hinterließen. Aber von diesen Spuren würde bestimmt bald nichts mehr zu sehen sein. Das Land war so leer und endlos, daß Hunderte junger Frauen wie sie darin verschwinden konnten, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Der Gedanke an diese Einsamkeit beunruhigte, ja erschreckte sie. Sie wollte sich aber keine Angst einjagen lassen. Nachdenklich stellte sie den leeren Teller ab, stand auf und streckte die Hände nach oben, wie um nach einem Stück Himmel zu greifen. Sie seufzte und versuchte bewußt, sich an den Gestank der brennenden Büffelfladen und verschwitzten Maultiere zu gewöhnen.
Als Clementine sich umdrehte, stellte sie fest, daß Gus sie beobachtete. Er saß auf einem Holzklotz und hielt den Kaffeebecher zwischen den Händen. Der Kaffee dampfte, und da die breite Hutkrempe einen Schatten über sein Gesicht warf, konnte sie nicht erkennen, was er dachte. Clementine hatte festgestellt, daß Gus manchmal ins Brüten geriet, wenn er nicht lächelte oder lachte und mit Worten seinen Träumen nachhing. Er hatte seit Stunden kein Wort gesagt, und Nickel Annie war nach dem morgendlichen Anfall von Redseligkeit ebenfalls verstummt.
Es war ohnehin die stille Zeit des Tages, wenn die Erde den Atem anzuhalten schien und geduldig auf den Übergang vom Licht zur Dunkelheit wartete. Schwarze Trauerränder säumten die dicken weißen Wolken, und sogar der Wind hatte sich gelegt.
Clementine setzte sich neben Gus auf den Holzklotz. In ihrem engen Rock mit den Schleifen und dem geschnürten Mieder mit dem festen Korsett, das eng um ihre Hüften lag, war das nicht so einfach. Sie wünschte, sie hätte mit der Kamera die verkohlten, knorrigen Äste des Baumes festhalten können, die sich dunkel in den fahlen Himmel reckten. Aber dazu hätte sie das kleine Zelt aufbauen müssen, um die Platte nach dem Belichten sofort zu entwickeln. Eigentlich könnte sie es tun, denn das Zelt befand sich im Gepäck. In Wirklichkeit hatte sie jedoch Angst davor, was Gus dazu sagen würde. Es war vermutlich klüger, ihn nach und nach an den Gedanken zu gewöhnen, daß seine Frau ein Steckenpferd hatte, das die meisten Leute für ungewöhnlich, bei einer Frau sogar für unschicklich halten würden.
»Ich bin keine Heilige!« sagte Nickel Annie unvermittelt und so laut, daß Clementine zusammenzuckte. »Verdammt, ich bin keine Heilige, und ich bin eine Frau, die ihre Schulden immer beglichen hat, aber auch weiß, wie sie auf ihre Kosten kommt.«
Annie sprang auf und stapfte zum Wagen. Sie stellte sich mit einem Bein auf die Radnabe und hob ein Fäßchen aus dem Wagen. Sie rollte es mit der Stiefelspitze ans Feuer, stellte es auf und kauerte sich davor.
Aus der tiefen Tasche ihres Mantels brachte sie einen Stichel und einen Nagel zum Vorschein. Mit dem Stichel verschob sie eines der Eisenbänder und bohrte mit dem Nagel ein kleines Loch in das Faß. Ein dünner Strahl einer braunen Flüssigkeit schoß hervor. Clementine stieg sofort der starke Geruch von Whiskey in die Nase. Annie griff nach dem Kaffeebecher, schüttete den Satz aus und stellte den Becher unter das Loch. Der Whiskey floß in den Blechbecher.
Annie warf einen vielsagenden Blick über die Schulter auf Clementine und Gus. »Wir im Frachtgeschäft nennen das ›Verdunsten‹.«
»Anständige Leute würden es Stehlen nennen«, erwiderte Gus spöttisch.
»Ich nehme an, du willst damit sagen, daß du nichts davon willst. Schließlich bist du einer von den Maßvollen und Ehrlichen ... Mrs. McQueen ist eine vornehme Dame und die Tochter eines Pfarrers. Sie wird ihre frommen Lippen bestimmt nicht mit dem Teufelszeug verunreinigen wollen.«
Annie sah Clementine höhnisch an. »Gus McQueen, du hast dir eine ziemlich zugeknöpfte Frau geangelt.« Der Whiskey erreichte den Becherrand und floß über. »Aber das ist ganz gut so«, sagte Annie, während sie das Loch mit einem abgebrochenen Streichholz verschloß und den Faßreifen geschickt zurück an seinen Platz klopfte. »Die Gesetze der Natur erlauben ohnehin nicht, daß zuviel von dem Zeug ›verdunstet‹.«
Sie trank einen ordentlichen Schluck, schüttelte sich und schmatzte genußvoll. Gus beobachtete das Spiel mit verkniffenem Mund, als wolle er etwas sagen. Aber die Worte schienen so unerfreulich zu sein, daß sie ihm nicht über die Lippen kamen. Clementine mußte unwillig Annie recht geben. Gus hatte sich in diesem Augenblick wirklich mit seiner Ehrbarkeit wie in der Schlinge eines Lassos gefangen. Er glich keineswegs dem Mann mit den lachenden Augen, der, von allen Regeln des Anstands befreit, vom Hochrad in ihr Leben geflogen war.
Es lag eine gewisse Gereiztheit in der Stille, die entstanden war. »Ich glaube, ich möchte doch etwas von dem Kaffee«, sagte Clementine, um das Schweigen zu beenden. Bis jetzt konnte sie dem Gebräu nichts abgewinnen, das nach dem Geschmack der Leute im Westen so stark sein mußte, daß, wie Gus sagte, ›ein Hufeisen darauf schwamm‹.
Gus legte ihr die Hand auf die Schulter und stand auf. »Ich mach das schon.«
Sie sah zu, wie er den Kaffee aus dem großen, vom Feuer geschwärzten Eisentopf goß. Als er ihr den Becher gab, berührten sich ihre Finger. Die Wärme vom Kaffee und die Berührung waren wohltuend. Sie lächelte ihn an. »Danke, Mr. McQueen.«
»Du könntest vielleicht versuchen, mich beim Vornamen zu nennen, Clementine.«
Ihr Lächeln erstarb. »Das werde ich bestimmt tun, ich verspreche es. Laß mir nur noch ein wenig Zeit.«
Er sagte nichts. Aber er griff nach einem Zweig und stieß ihn in die Flammen. Sie verstand ihre Halsstarrigkeit nicht. Sie sehnte sich nach der Intimität seiner Berührung. Trotzdem brachte sie selbst noch nicht einmal die Intimität auf, ihn beim Vornamen zu nennen. Warum war das so? Vielleicht sah sie darin eine Möglichkeit, einen kleinen Teil ihres neugefundenen Wesens als Frau noch eine Weile für sich und losgelöst von ihm zu behalten.
Sie drehte den Becher in der Hand und blickte in den Kaffee, der dunkel und ölig war. In ihrem Kopf hörte sie ihren Vater auf der Kanzel: »Frauen, dient euren Ehemännern, wie ihr dem Herrn, eurem Gott, dient.«
Sie hatte im Grunde ihr ganzes Leben gegen den Vater gekämpft. Aber jetzt wollte sie nicht auch noch gegen ihren Ehemann kämpfen. Trotzdem tat sie es bereits.
›In der ersten Nacht zu Hause werde ich dich erst richtig zu meiner Frau machen‹, hatte Gus gesagt. Das waren die Worte eines Mannes, der etwas in Besitz nehmen wollte.
Bald würden sie auf seiner Ranch sein, und dann wollte er ihren Körper zu der Art Vergnügen benutzen, wie es die ›Flittchen‹ gegen Geld taten. Beim Gedanken daran empfand sie einen seltsamen Schmerz. Das erinnerte sie an einen Regentag, als sie sich nach draußen geschlichen, Schuhe und Strümpfe ausgezogen und barfuß im Garten gespielt hatte. Während sie im nassen glitschigen Schlamm stand, der butterweich und glatt war, behaglich die Zehen krümmte und spürte, wie die feuchte Erde dazwischen hochquoll, überkam sie eine so beglückende Lust, daß sie verblüfft die Zähne zusammenbeißen mußte, um nicht laut zu stöhnen.
Clementine sah ihren Mann verstohlen an. Seine Unterarme lagen auf den Oberschenkeln. Er starrte ins Feuer. Sie fragte sich, ob er auch an die erste Nacht dachte. An die erste Nacht vom Rest ihres Lebens im Regenbogenland, an die erste Nacht, in der er sie ganz zu seiner Frau machen würde ...
Mit einem stummen Seufzen zog sie den Kragen ihres Mantels enger. Die Luft war still und schwer, und sie roch seltsam bedrohlich wie kaltes Metall.
Etwas traf ihr Handgelenk und dann ihre Wange. Winzige glitzernde Schneeflocken fielen mit sanftem Zischen in die Flammen. Sie hob den Kopf und blickte in einen Himmel voll Schnee. »Oh«, rief sie begeistert. »Es schneit!«
Gus streckte die Hand aus. »Diesen nassen Schnee nennen wir Cowboys ›Grasbringer‹.«
Nickel Annie rülpste und schwenkte ihren halbleeren Becher ›verdunsteten‹ Whiskey in Clementines Richtung. »Zum Teufel, es wird wahrscheinlich noch zwei oder drei Schneestürme geben, bevor es wirklich Frühling wird. Selbst dann muß der Winter noch nicht vorüber sein. Das ist Montana! Heute eine heiße Hölle, und morgen schneit es wie verrückt. Im letzten Jahr hatten wir sogar noch am vierten Juli Schnee. Montana ist ein gottverdammtes Land.«
Der Schnee fiel inzwischen immer dichter. Clementine streckte die Zunge heraus und lachte wie ein Kind, als ihr der kalte feuchte Schnee in den Mund fiel.
»Clementine ...« Sie drehte sich um und sah, daß Gus sie verwirrt ansah. Verlegen murmelte er: »Gehen wir schlafen.«
Gus hängte eine Laterne an die Wagendeichsel und entrollte die Soogans, dicke gewebte Steppdecken, die er in Fort Benton gekauft hatte.
Er kniete im Gras nieder und breitete die Soogans unter dem hohen Wagenkasten aus. Sie blickte auf seinen starken breiten Rücken. »Es war wunderbar, was du heute gemacht hast«, flüsterte sie ihm zu. »Wie du das Fünfcentstück vom Sattel aus aufgehoben hast, ohne daß dein Pferd dabei langsamer werden mußte.«
Er schwieg. Sein Ellbogen lag auf dem gebeugten Knie, und er blickte mit zusammengepreßten Lippen auf die Decken. Dann fuhr er sich mit einem Seufzer über das Gesicht. »Es war nicht derselbe Nickel. Es war ein anderer aus meiner Tasche.« Im trüben Licht der Laterne sah sie, daß er lächelte. Er stand auf und legte ihr die Hände um die Taille. »Wie hätte ich etwas so Kleines wie eine Münze zwischen dem hohen Gras und den Steinen finden sollen?«
Sie lehnte sich in seinen Armen an ihn und blickte zu ihm auf. »Wahrscheinlich glaube ich einfach, daß du alles kannst.«
Er drückte ihren Kopf an seine Brust. »Das darfst du nie ... niemals glauben.«
Clementine erschauerte. Seine Antwort hatte ihr nicht gefallen, und der Anflug von Besorgnis in seiner Stimme ebenfalls nicht. Gus war ihr Cowboy. Er sollte keine Zweifel haben. Seine Sicherheit sollte für sie beide reichen.
Gus blies die Laterne aus. Sie zogen Stiefel und Schuhe aus und krochen angekleidet unter die Decken. Dann nahm er sie in die Arme und drückte seinen starken Körper an sie. Ihre Haare bewegten sich unter seinem Atem, der heiß an ihren Hals drang. Seine Lippen streiften über ihre Wange und suchten ihren Mund. Sie glitten zuerst sanft, dann immer drängender auf ihren halb geöffneten Lippen hin und her. Sie spürte ein seltsames heißes Prickeln und schmiegte sich enger an ihn.
Er zog sanft ihren Kopf zurück. »Clementine, nicht hier ...«
Es klang gepreßt, und seine Arme schlossen sich enger um sie. Er drückte sie an seine Brust. Ihre Wange lag auf der rauhen Wolle seiner Jacke. Sie roch nach Präriestaub und Holzrauch. Clementine fühlte, wie sie seine Härte mit ihrer Weichheit durchdrang. Ein leichtes Beben erfaßte ihn.
Er ließ sie schwer atmend los und drehte sie in seinen Armen, so daß sie ihm den Rücken zuwendete. Er faßte nach ihren Händen und berührte vorsichtig mit dem Daumen die alten Narben.
»Wann wirst du mir endlich sagen, wie du dazu gekommen bist?« flüsterte er ihr ins Ohr.
Er hatte Clementine das mindestens schon ein dutzendmal gefragt, seit er die Narben zum ersten Mal gesehen hatte. Doch wenn sie ihm von der Strafe ihres Vaters erzählen würde, hätte sie ebensogut nackt vor ihn hintreten können. Und das hatte sie auch noch nicht getan.
Sie spürte sein Seufzen warm im Nacken. »Wie soll ich dich kennenlernen, Kleines, wenn du nicht mit mir reden willst?«
Sie wollte nicht, daß er sie kennenlernte, denn sie schien all ihre Schwächen und Fehler mit in die Ehe gebracht zu haben. Im Gegensatz zu ihr hatte Gus McQueen nie vorgegeben, etwas anderes zu sein als das, was er war: ein guter Mann, ein anständiger Mann, der für sie sorgen und der sie beschützen würde.
Er glaubt, eine junge Dame aus vornehmem Haus geheiratet zu haben, die immer eine tugendhafte, gehorsame Ehefrau sein wird. Er wünscht sich eine zurückhaltende, ordentliche Ehefrau. Eine echte Dame. Er hat keine Ahnung, wie ich wirklich bin.
»Clementine ...«
»Ich möchte jetzt schlafen, Mr. McQueen«, sagte sie und glaubte, er werde seine Arme zurückziehen. Aber das tat er nicht.
Hinter dem Feuerschein war die Dunkelheit undurchdringlich. Ein Kojote heulte. Es war ein hohes Jaulen, das einsam klang. Clementine fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und schmeckte ihn.
Sie lagen geschützt und warm unter den Decken. Er schlief. Sein Arm lag auf ihrer Hüfte, seine Hand ruhte auf ihrem Leib. Sie spürte ihn von den Füßen über die Knie bis zur Brust, die sich an ihren Rücken drückte.
Vor wenigen Augenblicken hatte sie über den Schnee gelacht. Jetzt empfand sie eine traurige Sehnsucht, eine enttäuschende Leere, die sie nicht verstand. In ihr begann eine Angst zu wachsen, die so unendlich und wild war wie der Himmel von Montana. Sie hatte Angst, daß sie die Einsamkeit aus dem Haus ihres Vaters mitgebracht hatte.