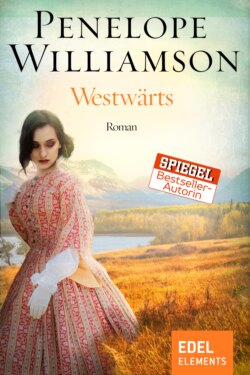Читать книгу Westwärts - Penelope Williamson - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel
ОглавлениеEr kommt nicht, o Gott, er kommt wohl doch nicht!
Clementine Kennicutt ging mit großen Schritten auf dem Teppich hin und her. Sie trat achtlos auf das flauschige mit peinlicher Sorgfalt gepflegte Muschelmuster. In ihrer Erregung stieß sie mit den Lackspitzen der Straßenschuhe gegen den langen Rock. Das gestärkte Musselin raschelte leise in der viel zu stillen Nacht. Oder verriet es flüsternd ihre Ängste?
Sie eilte durch das dunkle Zimmer zum schwarzen Nußbaumkleiderschrank, trat vor das Himmelbett mit den blütenweißen Chintzbehängen und der gestärkten Hohlsaumspitze und erreichte schließlich den Kamin. Auf dem grünen Marmorsims stand eine Leieruhr, deren Pendel geräuschlos hin- und herschwang. Sie mußte dicht an das Porzellanzifferblatt herangehen und sich vorbeugen, um zu sehen, wie spät es war.
Zehn Minuten nach Mitternacht. Er hatte sich schon zehn Minuten verspätet.
Er kommt nicht, er kommt wohl doch nicht ...
Clementine eilte zum Fenster zurück, durch das ein schwacher Lichtschein in das Zimmer drang. Sie schob die schweren Samtgardinen beiseite und spähte auf die Straße. Der Regen verschmierte die Scheibe, und die feuchte Luft zauberte Heiligenscheine über die Straßenlaterne. Mondstrahlen durchbohrten dunkle Sturmwolken. Das schmiedeeiserne Gitter um den Louisburg Square warf spitze Schatten auf das regenglatte Kopfsteinpflaster, das einsam und verlassen auf die Fußgänger wartete, die noch vor Sonnenaufgang hier vorbeikommen würden.
Da! Auf der anderen Seite des Platzes flackerte das Licht einer Kutsche durch die Äste der Ulmen. Sie drückte das Gesicht an die Scheibe, um besser zu sehen, doch unter ihrem Atem beschlug das Glas. Sie hob schnell den Riegel hoch und zog das Fenster auf.
Die Scharniere quietschten laut, und sie erstarrte. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Langsam und vorsichtig öffnete sie das Fenster weiter. Sie hörte den Wind, der ihren wenig damenhaften und fast schon keuchenden Atem übertönte.
Eine Böe blähte die dunkelgrünen Übergardinen und drückte sie gegen die Fensterflügel. Hinter ihr klirrten die Kristallanhänger der Lampen auf dem Kaminsims. Clementine beugte sich weit aus dem Fenster und spürte den kühlen Wind im Gesicht. Er roch nach Regen und Rauch. Die Straße glänzte vor Nässe; sie war immer noch leer.
Er kommt nicht ...
»Was machst du denn?«
Clementine zuckte zusammen, drehte sich schnell herum und wäre beinahe gestolpert. Das Licht der Kerze im Silberleuchter, den ihre Mutter in der Hand hielt, warf riesige Schatten auf die mit heller Seide bespannten Wände.
Clementines Herz hämmerte gegen die Faust, die sie verwirrt an die Brust gepreßt hatte. »Mama, du hast mich aber erschreckt.«
Die Flamme loderte und zuckte, als Julia Kennicutt den Leuchter hob und ihre Tochter fragend musterte. Sie sah den Wollmantel über dem schlichten kastanienbraunen Straßenkleid, die Lederhandschuhe, die schwarze Biberhaube und die prall gefüllte Reisetasche auf dem Boden neben ihr.
»Du willst weg«, sagte sie. Ihr Blick richtete sich auf die Kerze, die unangezündet auf der Fensterbank stand, und auf die Streichhölzer in dem Porzellanbehälter. »Da ist jemand, mit dem du wegwillst.«
»Mama, bitte verrate mich nicht ...«
Clementine warf einen schnellen Blick zur offenen Tür. Sie rechnete damit, im nächsten Augenblick ihren Vater dort stehen zu sehen.
Sie hatte Angst vor dem Vater. Er schien sich aufzublähen, wenn er zornig war, und die Luft um ihn herum begann zu zittern. Aber nicht nur davor hatte sie Angst.
»Ich räume alles wieder in den Schrank und lege mich ins Bett«, beteuerte sie. »Niemand außer dir und mir muß je etwas davon erfahren. Nur sag bitte nichts ...«
Ihre Mutter drehte sich wortlos um. Sie nahm die Kerze mit und schloß die Tür. Das Zimmer lag wieder im Dunkeln.
Clementine sank auf den roten Chintzhocker mit den Rüschen vor dem Toilettentisch. Die Angst, die sie so haßte, schnürte ihr die Kehle zu. Die grenzenlose Angst war so dick und sauer wie geronnenes ranziges Fett. Von draußen drang ein klatschendes Geräusch herein, und sie drehte schnell den Kopf. Aber es war nur der Wind, der einen Zweig gegen die Straßenlaterne an der Ecke schlug. Sie starrte sehnsüchtig auf das Fenster, obwohl sie wußte, es war alles vorbei. Wenn er jetzt kam, war es zu spät. Ihre Hoffnung schwand, und er würde ohnehin nicht kommen.
Die Tür wurde wieder geöffnet. Clementine stand langsam auf, zog die Schultern hoch und verkroch sich tief in sich selbst. Sie entfernte sich mit ihrer Willenskraft weit weg von dem Schmerz. Clementine wollte sich auf diese Weise gegen den Zorn ihres Vaters wappnen, und deshalb dauerte es einen Augenblick, bis sie sah, daß ihre Mutter ohne ihn zurückgekommen war.
Julia Kennicutt stellte den Kerzenhalter zwischen die Glasfläschchen und die Emailledöschen auf den Toilettentisch. Der Spiegel mit der schräg geschliffenen Kante warf gebrochenes Licht auf die beiden Frauen. Die Mutter wirkte in ihrem weißen Nachthemd und den langen hellen Haaren beinahe jünger als ihre Tochter.
»Clementine ...« Sie hob die Hand, als wollte sie die Wange ihrer Tochter berühren, tat es aber nicht. »Du mußt das mitnehmen.«
Sie nahm Clementines Handgelenk und drückte ihr etwas in die Hand. Es war erstaunlich schwer, und Clementine ließ es beinahe fallen. Es war ein herzförmiges Duftkissen, hübsch verziert mit gestickten Seidenblumen und Spitze. Es verströmte den Duft von Rosen, aber es war zu schwer und zu hart, um mit duftendem Puder oder Kräutern gefüllt zu sein. Clementine wog es in der Hand und hörte das Klimpern von Münzen.
»Es ist nicht viel«, flüsterte ihre Mutter tonlos. »Es sind nicht mehr als hundert Dollar. Aber es wäre immerhin ein Anfang für dich, wenn du eines Tages vor dem Mann davonlaufen müßtest, mit dem du jetzt durchbrennst.«
Clementine blickte auf den Beutel in ihrer Hand. Sie erinnerte sich schwach daran, ihn vor Jahren einmal zwischen der Unterwäsche ihrer Mutter gesehen zu haben. Ein gutes Versteck, denn es war unwahrscheinlich, daß ihr Vater dort herumstöbern würde, und selbst wenn, wäre ein herzförmiges Duftkissen dort nichts Ungewöhnliches.
Sie richtete den Blick wieder auf das weiße Gesicht ihrer Mutter. »Du wolltest das Geld für dich«, sagte Clementine. »Du hast all die Jahre nur auf eine Gelegenheit gewartet, um ...«
»Nein, nein«, die Mutter schüttelte heftig den Kopf, und die Haare drückten sich ihr an die Wangen. »Ich werde dieses Haus nicht verlassen. Ich habe nicht den Mut dazu.«
Clementine versuchte, ihrer Mutter das Duftkissen wieder in die Hand zu drücken. »Aber du kannst mitkommen ... Wir gehen nach Montana ...«
Die ältere Frau stieß einen leisen, erstickten Schrei aus. »Montana ... o mein Gott! Du warst schon immer ein seltsames, weltfremdes Kind.« Sie schüttelte langsam den Kopf und lächelte. »Mein Kind, was würde der junge Mann von einem Mädchen denken, das seine Mutter mitnimmt, wenn es durchbrennt? Und ausgerechnet in eine solche Wildnis. Was soll ich zwischen Büffelherden und Indianerhorden tun? Ach, mein Kind ...« Sie hob die Hand, und diesmal berührte sie die Wange ihrer Tochter. »Du bist so jung. Du glaubst, du wirst große Abenteuer erleben, und das wirst du auch. Obwohl ich vermute, daß es nicht die Abenteuer sein werden, wie du sie dir jetzt erträumst.«
»Aber Mama ...«
»Psst ..., hör mir ein einziges Mal zu. Schutz und Sicherheit haben etwas für sich, das kannst du mir glauben. Vor allem im Alter ist die Nähe zu dem Leben, das man immer gekannt hat, von großer Bedeutung. Also, nimm wenigstens das Geld, denn wahrscheinlich wirst du an dem Tag, an dem deine großartigen Abenteuer nicht mehr ganz so großartig sind, jeden Penny brauchen.« Sie zog die Hand zurück und seufzte. »Es ist das einzige, was ich dir geben kann, und selbst das habe ich ihm gestohlen.«
Clementine fühlte die harten Münzen durch die dünne Seide und spürte ihr Gewicht. Mit ihm hielt sie all die Worte in den Händen, die zwischen ihnen immer unausgesprochen geblieben waren. Sie stellte sich vor, wie sie sich die angesammelten Worte aus dem Herzen reißen würde, um sie dieser Frau, ihrer Mutter, anzubieten.
›Es ist das einzige, was ich dir geben kann. Wie Münzen in einem Seidenbeutel, der nach Rosen duftet.‹
»Clementine, dieser Mann, mit dem du davonläufst ...«
»Er ist nicht wie Vater.«
Sie steckte zögernd das Duftkissen in die Manteltasche und verstaute mit dem Geschenk auch die anderen Worte, von denen sie nicht wußte, wie sie solche Dinge aussprechen sollte.
»Ich bin sicher, er ist ein freundlicher Mann. Er lacht gerne, und er ist ein sanfter Mann.«
Doch Clementine war keineswegs sicher, ob diese Beurteilung der Wahrheit entsprach, denn sie kannte ihn kaum. Genaugenommen kannte sie ihn überhaupt nicht. Außerdem hatte sie das flaue Gefühl, das ihr wie ein Kloß im Magen lag, daß er ohnehin nicht kommen werde, um sie abzuholen. Clementine kniff die Augen zusammen und versuchte zu sehen, wie spät es war. »Du wirst es nicht glauben, Mama. Aber er ist ein Cowboy, ein richtiger Cowboy.«
»Gütiger Himmel ... ich glaube, weitere Einzelheiten ersparst du mir lieber.« Ihre Mutter versuchte zu lächeln, doch die Hand, die sie Clementine auf den Arm legte, zitterte. »Ganz gleich, was für ein Mann er deiner Meinung nach ist, versprich mir, daß du das Geld vor ihm geheimhältst. Sonst wird er glauben, es gehöre von Rechts wegen ihm und ...«
Bei dem Rattern von Rädern auf dem Kopfsteinpflaster sprang Clementine auf und rannte zum Fenster. »Schnell, Mama, mach dein Licht aus.«
Ein kleines schwarzes Gig rollte durch die Straße; es tauchte im Schatten unter und im Lichtkreis der Laternen wieder auf. Es war ein schäbiger, schlammbespritzter Wagen, dessen Dach fehlte, doch für Clementine war er wie eine goldene, von weißen Einhörnern gezogene Kutsche. Sie ließ in ihrer Aufregung ein Streichholz fallen und brach ein zweites ab, ehe es ihr gelang, die Kerze anzuzünden. Sie bewegte das Licht zweimal von einer Seite des Fensters zur anderen und löschte es dann.
Sie griff nach der Reisetasche, die schwer an ihrem Arm hing. Sie hatte soviel wie möglich hineingestopft, denn sie konnte sich überhaupt noch nicht vorstellen, was sie in einer Wildnis wie Montana alles brauchen würde. Beinahe hätte sie vor Freude und Erleichterung laut gelacht. Er war gekommen. Ihr Cowboy war doch noch gekommen, um sie mitzunehmen.
Clementine wandte sich vom Fenster ab. Die Schatten machten das Gesicht ihrer Mutter unsichtbar. Doch sie hörte, wie Julia tief Luft holte, als unterdrücke sie alle ihre mahnenden Worte. »Geh und freu dich am Leben, mein Kind«, sagte Julia leise. Sie nahm den Kopf ihrer Tochter zwischen die Hände und drückte ihn. »Geh und werde glücklich.«
Sie verharrten einen Augenblick in dieser unbeholfenen Umarmung, bevor Clementine sich losmachte. An der Tür drehte sie sich noch einmal um. »Leb wohl, Mama«, sagte sie mit klopfendem Herzen zu dieser Frau, die schweigend im Zimmer stand – ein Schatten unter Schatten.
Clementines Füße machten auf dem dicken Läufer des Flurs kein Geräusch. Sie drückte die Reisetasche fest an sich, um zu verhindern, daß sie an die Wandtäfelung schlug. Aber die Dienstbotentreppe war eng und gewunden, und plötzlich verfing sie sich mit der Schuhspitze im Rocksaum. Clementine stolperte und ließ die Tasche fallen, die polternd bis hinunter in die Küche fiel und dort aufging. Döschen und Kästchen, zusammengerollte Batiststrümpfe und ein Fälteleisen rollten unter den großen Küchentisch, hinter den Eiskasten und zwischen Schmalzkübel und Kohlekasten.
Clementine stockte der Atem. Sie hatte genug Lärm gemacht, um ganz Beacon Hill zu wecken, mit Sicherheit aber ihren Vater.
Der Vater ...
Sie stopfte alles, was sie finden konnte, wieder in die Tasche. In der Hast gelang es ihr nur, eine Schnalle zu schließen.
In den blank polierten Böden der Kupfertöpfe spiegelte sich ihr weißes Gesicht, als sie zur Tür rannte, die zu den Stallungen und den Nebengebäuden führte. Dorthin sollte ihr Cowboy kommen, nachdem er ihr Signal gesehen hatte. Ihre Absätze klapperten auf dem Ziegelsteinböden. Der Beutel mit den Münzen in ihrer Tasche schlug schwer gegen ihren Schenkel.
Der Riegel klemmte, und beim Versuch, ihn zu öffnen, schürfte sie sich die Knöchel auf. Die Tür quietschte und hallte dumpf, wie eine rostige Kette, die gegen eine Wand schlägt, als Clementine sie aufriß. Sie stolperte auf die Veranda und blieb atemlos vor einem großen Mann stehen, den sein hoher, breitkrempiger Hut noch größer machte.
»Mr. McQueen ...« Sie mußte tief Luft holen. »Hier bin ich!«
Sein Lachen klang jung und unbekümmert, und seine Zähne blitzten weiß unter den herabhängenden Enden des Schnurrbarts. »Ich habe Sie kommen hören, Miss Kennicutt – ich und ganz Boston.« Er nahm ihre Reisetasche, aus der ein Stück von einem Spitzenkorsett und einem Unterrock heraushing, und warf sie in den Wagen. Er reichte Clementine die Hand, um ihr beim Einsteigen behilflich zu sein.
»Warten Sie, da ist noch etwas«, sagte sie und deutete hinter sich. »Dort, hinter dem Abfallkübel, unter den alten Säcken.« Unter den Säcken stand ein großer Kalbslederkoffer mit Messingschlössern und Kupferbändern. Sie hatte alles, was sie unbedingt mitnehmen wollte, nach und nach in dieses Versteck gebracht.
»Was haben Sie denn da drin?« brummte er, während er sich bemühte, den Koffer in dem engen Raum zwischen dem Ledersitz und dem Schmutzbrett des kleinen Wagens zu verstauen, »Ziegel und Pflastersteine?«
»Das ist nur eine Kamera«, sagte sie schnell, weil sie fürchtete, er werde verlangen, daß die Kamera zurückblieb. Womöglich würde er sie vor die Wahl stellen zwischen dem neuen Leben und dem einzigen Teil des alten Lebens, der ihr etwas bedeutete. »Außerdem Glasplatten, Chemikalien und solche Sachen. Dafür ist doch Platz, oder nicht? Der Koffer ist doch nicht zu schwer, oder? Wissen Sie, ich muß unbedingt ...«
Er drehte sich um und umfaßte ihr Gesicht mit beiden Händen, wie ihre Mutter es getan hatte. Allerdings tat er es, um sie zu küssen. Es war der feste, fordernde Kuß eines Mannes. Dieser Kuß verschlug ihr den Atem. Er flüsterte dicht an ihrer glühenden Wange: »Ich wußte, daß Sie mit mir kommen würden. Ich wußte es einfach.«
Seine starken Hände legten sich um ihre Hüften, und er hob sie in den Wagen. Mit einem Satz war er neben ihr und schlug dem Pferd klatschend die Zügel auf die Hinterhand. Sie verließen mit knirschenden Rädern die Gasse hinter dem Haus, bogen ab und fuhren dann in Richtung Fluß.
Clementine Kennicutt blickte zurück auf das Haus ihrer Kindheit und zum Fenster des Zimmers, das ihr ganzes Leben lang ihr Zuhause gewesen war. Ein Licht flackerte kurz auf und erlosch. Ihre Mutter hob zum flüchtigen, einsamen Abschied die Kerze.
Sie hielt den Blick auf das Fenster gerichtet, bis die Schatten der Ulmen das Haus verschluckten. Dann drehte sie sich aufseufzend um, und vor ihr schwebte der runde volle Mond wie eine Orange über den Mansardendächern von Beacon Hill.
Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte leise zum Nachthimmel hinauf.
»Was ist?« fragte der junge Mann neben ihr. Er zog die Zügel an, und das Pferd trabte um die Ecke. Louisburg Square und das Haus ihres Vaters verschwanden für immer vor ihren Blicken, doch der Mond blieb bei ihr.
Sie lachte noch einmal und griff mit beiden Händen nach dem Mond. Aber er blieb gerade außerhalb ihrer Reichweite.
Wenn man das Leben wie die Geschichte eines Romans schreiben könnte, so hatte Clementine oft gedacht, dann wäre es ihr bestimmt gewesen, einen Cowboy zu heiraten.
Wann immer sie ihren Träumen nachhing, war sie es gewesen, die wilde Mustangs in der Prärie jagte, auf einen wild gewordenen Büffel zielte und sich am Ende eines langen Ritts in Dodge City vergnügte. Trotzdem, sogar sie mußte praktisch sein. Selbst in Tagträumen wurden aus kleinen Mädchen keine Cowboys. Aber sie wurden Ehefrauen, und wenn ... nun ja, angenommen, ein Cowboy würde ...
In ihren vernünftigsten Augenblicken wußte Clementine jedoch, daß selbst solche Träume zu weit gingen für ein Mädchen, dessen Vater am Tremont Temple in Boston, Massachusetts, auf der Kanzel stand und das Wort Gottes predigte. Ihr Leben unterschied sich vom Leben eines Cowboys etwa so sehr wie die Sonne vom Mond.
Ihre Eltern hatten aus Gründen der Vernunft und des Geldes geheiratet. Julia Patterson hatte ein Erbe von fünfzigtausend Dollar und ein Haus auf dem Beacon Hill mit in die Ehe und zum Altar gebracht. Reverend Theodore Kennicutt steuerte neben seiner gottesfürchtigen Person den guten alten Bostoner Namen seiner Familie bei. Clementine war ihr einziges Kind, und Reverend Kennicutt kannte seine Pflichten als Vater und Diener Gottes. Töchter waren schwache Geschöpfe, anfällig für Eitelkeit und Labilität. In einem hübschen Gesicht spiegelte sich nicht unbedingt eine reine Seele. Niemand durfte die kleine Clementine verwöhnen, liebkosen oder sich zu sehr mit ihr abgeben.
Manchmal, wenn sie eigentlich ihre Sünden bereuen sollte, wanderten ihre Gedanken weit, weit zurück, soweit sie konnte, sogar in die Zeit, bevor sie das mit den Cowboys gewußt hatte. Sie vermutete, daß sie vier Jahre alt gewesen sein mußte, als ihr Großvater sie eines Tages im Sommer in die Bleiche mitnahm. Dort entdeckte sie, wie das Leben aussehen konnte.
Großvater Patterson hatte ein freundliches Gesicht, das so rot war wie ein überreifer Apfel. Wenn er laut und dröhnend lachte, hüpfte sein Bauch. Er besaß mehrere Tuchverarbeitungsbetriebe. Eines Tages lud er Clementine und ihre Mutter zu einem Ausflug aufs Land ein, wo er die Bleiche hatte. Es war ein großes Ziegelsteingebäude mit einem rauchenden Schornstein. Im Innern stiegen aus großen brodelnden Kesseln dicke Dampfwolken auf. Unter der hohen Balkendecke liefen wie die Fäden eines Netzes unzählige Rohrleitungen kreuz und quer, von denen es auf Clementines Kopf tropfte. Beißende Dämpfe stiegen ihr in die Nase und trieben ihr Tränen in die Augen. Mama sagte, die Bleiche erinnere sie an die Kessel in der Hölle, und das gefiel Clementine. Der Lärm, der schreckliche Gestank, die Geschäftigkeit, das Leben, all das war wunderbar. Selbst wenn sie viele Jahre später über die Fülle nachdachte, die Leben bedeuten konnte, mußte sie immer an den Lärm und die Gerüche in der Bleiche denken. Es hatte ihr dort sehr gut gefallen, und sie wartete ungeduldig darauf, daß sie wieder einmal dorthin gehen würden. Aber das geschah leider nie mehr.
Doch dieser Sommer damals stand irgendwie unter einem besonderen Zauber, denn Mama lächelte viel, und ihr Bauch wurde allmählich so dick wie der von Großvater Patterson. Die Köchin sagte, ihre Mutter habe ein Kind im Leib, aber Clementine glaubte das erst, als Mama eines Tages ihre Hand nahm und sie fühlen durfte, wie das Kind mit dem Fuß gegen den straff gespannten Stoff des gelben Hauskleids ihrer Mutter trat.
Sie lachte erstaunt. »Wie kann denn ein Kind in dich hineinkommen?«
»Still!« sagte ihre Mutter mahnend. »Stell niemals solche ungezogenen Fragen.« Aber sie lachten beide, als das Kind noch einmal trat.
Bei dem Gedanken, wie sie und ihre Mutter gelacht hatten, mußte Clementine immer lächeln. Doch Gedanken haben es an sich, daß sie ineinander übergehen, und so geschah es denn, daß aus dem Lachen manchmal Schreie wurden, polternde Schritte auf dem Flur mitten in der Nacht und zwei Dienstmädchen, die vor der Tür des Kinderzimmers standen und flüsterten, die Frau Pfarrer werde bestimmt sterben, und die arme Clementine sei am Morgen ein mutterloses Kind.
Clementine hatte in jener Nacht wie erstarrt in ihrem Bett gelegen und auf die Schreie der Mutter gelauscht. Sie beobachtete, wie die Schatten verblaßten und das Sonnenlicht durch die gezahnten Blätter der Ulmen im Park drang. Sie hörte das Tschilpen der Spatzen und das Rattern und Klappern des Milchwagens.
Dann wurde ihr bewußt, daß die Schreie verstummten.
›Am Morgen‹, hatten die Dienstmädchen gesagt. ›Am Morgen wird ihre Mutter tot sein, und dann ist sie ein mutterloses Kind ...‹
Die Sonne war schon seit Stunden aufgegangen, als Reverend Kennicutt zu ihr kam. Der Vater machte ihr zwar manchmal angst, aber Clementine gefiel es, wie er aussah. Er war so groß, daß sein Kopf sicherlich den Himmel berühren mußte. Sein Bart war lang und dicht; er teilte sich, und die Spitzen bogen sich nach oben wie die beiden Henkel eines Milchkrugs. Der Bart war wie seine Haare so glänzend schwarz wie verschüttete Tinte. Auch die Augen des Vaters glänzten, besonders an den Abenden, wenn er ins Zimmer kam, um mit ihr zu beten. Mit seiner tiefen Stimme formte er Worte, und sie klangen wie die Lieder des Windes in den Bäumen. Clementine verstand nicht alle Worte, aber sie liebte ihren Klang. Er sagte ihr, daß Gott jeden Tag die Gerechten und die Sünder richte und er zornig über die Bösen sei. Clementine dachte, der Vater müsse Gott sein, denn er war so groß und ehrwürdig; und sie wollte nichts anderes, als sein Wohlgefallen erringen.
»Bitte, Vater«, sagte sie an diesem Tag und achtete darauf, die Augen demütig gesenkt zu halten, obwohl ihr die Brust schmerzte, weil sie kaum Luft bekam. Sie war nicht sicher, was ›sterben‹ bedeutete. »Bitte, Vater, sag mir, bin ich jetzt ein armes, mutterloses Kind?«
»Deine Mutter ist dem Tode nahe«, erwiderte er vorwurfsvoll. »Und du kannst nur an dich denken. Es ist etwas Sündhaftes in dir, Tochter. Soviel Wildheit und Eigensinn, daß ich manchmal um deine unsterbliche Seele fürchte. ›Wenn dein Auge böse ist, soll dein ganzer Leib voll Dunkelheit sein.‹«
Clementine hob den Kopf und ballte die Fäuste. »Aber ich war brav. Ich war brav!« Ihr Brustkorb spannte sich, als sie zu ihm aufblickte. »Und meine Augen waren auch brav, Vater. Wirklich.«
Er erwiderte mit einem tiefen, traurigen Seufzen: »Vergiß nicht, Clementine, der Herr sieht alles. Er sieht nicht nur alles, was wir tun, sondern auch das, was in unseren Gedanken und in unserem Herzen ist.
Komm, wir müssen jetzt beten.« Er führte sie in die Mitte des Zimmers und drückte sie auf die Knie. Er hob die große schwere Hand und legte sie auf die schlichte, rauhe Baumwollkappe, die immer Clementines Haare verbarg, um sie vor sündhafter Eitelkeit zu schützen. »Gütiger Gott, wenn du in deiner unendlichen Barmherzigkeit ...« Er verstummte. Seine Tochter hatte den Kopf nicht im Gebet gesenkt. Seine Finger verstärkten den Druck, aber er sagte sanft: »Deine kleine Schwester ist verschieden, Clementine. Sie ist in das himmlische Paradies eingegangen.«
Sie legte den Kopf unter seiner Hand schief und dachte über die Bedeutung dieser Worte nach. Sie hatte sich den Himmel nie richtig vorstellen können. Aber sie dachte daran, was Mama über die Bleiche und die Kessel der Hölle gesagt hatte, und sie lächelte. »Oh, hoffentlich nicht, Vater. Ich denke doch, daß sie statt dessen in der Hölle ist.«
Der Reverend zog die Hand vom Kopf seiner Tochter, als habe er sich verbrannt. »Was für ein Kind bist du eigentlich?«
»Ich bin Clementine«, sagte sie.
Clementine durfte das Kinderzimmer an diesem Tag nicht verlassen. In der Stunde vor dem Zubettgehen kam ihr Vater noch einmal, um ihr aus der Bibel etwas von einem See aus Feuer und Schwefel vorzulesen und von einem gerechten Zorn ohne Erbarmen, wenn sie starb. Selbst die Engel, die gesündigt hatten, so sagte der Reverend, waren nicht von Gottes Zorn verschont geblieben, sondern in die Hölle hinabgestürzt worden, wo sie bis in alle Ewigkeit litten.
In den folgenden beiden Tagen kam ihr Vater morgens, mittags und abends, um ihr mehr über die Hölle vorzulesen. Aber es war das Zimmermädchen, das Clementine schließlich sagte, daß ihre Mutter am Leben bleiben werde.
Am Morgen der Beerdigung waren alle Spiegel und Fenster des Hauses mit schwarzem Crêpe verhüllt. Blumen füllten den Eingang. Ihr Duft lag erdrückend schwer in der Luft. Ein Leichenwagen brachte den winzigen Sarg zum Friedhof an den alten Kornspeichern. Er wurde von Pferden gezogen, die mit großen schwarzen Federbüschen geschmückt waren. Der kalte schneidende Wind blies Clementine ins Gesicht und trieb totes Laub auf die Grabsteine. Sie wußte inzwischen alles über die Hölle, und die war überhaupt nicht wie Großvaters Bleiche.
Manchmal wanderten ihre Gedanken zu dem Ostertag, an dem Tante Etta und die Zwillinge zu Besuch gekommen waren. Die Vettern waren sieben Jahre älter als Clementine und gerade von einer Reise nach Paris zurück. Dort hatten sie eine kleine Guillotine gekauft. Clementine wollte dieses Wunder unbedingt sehen, denn sie durfte nur wenig eigenes Spielzeug haben, um nicht vom Lernen und Beten abgelenkt zu werden.
Die Vettern boten ihr an zu zeigen, wie die Guillotine funktioniert. Clementine freute sich so sehr über die Beachtung, die sie ihr schenkten, daß sie lächelte. Sie lächelte, bis die beiden die Guillotine auf den Tisch stellten, wo Clementine morgens ihre Grütze aß und Milch trank, und ihrer einzigen Puppe den Kopf abschnitten.
»Bitte hört auf«, sagte sie und bemühte sich, trotz ihrer Wut, höflich zu sein und nicht zu weinen, als sie sah, wie der Porzellankopf blutlos über die weiße Tischplatte rollte. »Ihr tut Matilda weh!« Die Vettern lachten nur, das Blechmesser sauste mit einem schrillen Pfeifen herab, und ein rosiger Arm mit Grübchen am Ellbogen und auf den Handrücken fiel zu Boden.
Clementine rannte nicht, denn das war verboten. Sie weinte nicht. Mit ihrer gestärkten Schürze und der Kappe ging sie auf die Suche nach jemandem, der die Metzelei beenden würde, geräuschlos durch das große Haus. Ihr kleiner Brustkorb zuckte, und ihre Augen waren groß und starr.
Fröhliches Gelächter drang durch die offenen Flügeltüren des Damenzimmers. Sie blieb auf der Schwelle stehen und war so verzaubert, daß sie die Ermordung ihrer Puppe vergaß. Mama und Tante Etta saßen in weißen Rattanlehnstühlen und hielten die Köpfe über ihre Teetassen gebeugt. Ihre Knie berührten sich beinahe. Tante Etta hatte weiße Lilien mitgebracht, und der schwere süße Duft mischte sich mit dem fröhlichen Lachen und angeregten Geplauder. Sonnenlicht fiel durch die hohen Fenster und vergoldete das Haar ihrer Mutter.
Julia beugte sich vor und faßte ihre Schwester am Arm. »Dann hat Dr. Osgood mit seiner tiefen freundlichen Stimme gesagt: ›Wenn Sie noch länger leben wollen, Madam, dürfen Sie nicht versuchen, noch mehr Kinder zu bekommen. Ich habe Mr. Kennicutt gesagt, wenn er Empfängnisverhütung nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dann muß er Abstinenz üben. Jedes andere Verhalten kommt einem Mord gleich, und auch das habe ich ihm gesagt.‹ O Etta, der gute Doktor hat das verkündet, als sei es eine Tragödie. Wie konnte er ahnen, welch ungeheure Erleichterung es für mich bedeutet?« Julia lachte, aber dann sank sie mit einem unterdrückten Schluchzen in sich zusammen. Tante Etta nahm sie in die Arme. »Welch ungeheure Erleichterung«, wiederholte die Mutter an Tante Ettas üppigem Busen. »Welch ungeheure, ungeheure Erleichterung ...«
»Schon gut, Julchen, schon gut. Zumindest bleibt dir ab jetzt sein Bett erspart.«
Clementine hatte nicht verstanden, was die beiden sagten. Aber sie wünschte so sehr, Tante Etta sein zu können. Sie wünschte sich leidenschaftlich, die Arme um ihre Mutter legen zu können und sie soweit zu bringen, daß sie lächelte. Sie wollte aber auch Mama sein, wollte gestreichelt, gehalten und getröstet werden, sich sicher und geliebt fühlen. Sie wollte, wollte, wollte ..., doch es fehlten ihr die Worte, um all die Dinge zu beschreiben, die sie wollte.
Wenn sich Clementine richtig erinnerte, war es damals das erste Mal gewesen, daß sie diese seltsamen Sehnsüchte empfand, die sie öfter überkamen, als sie älter wurde. Sie spürte gewisse Dinge und wollte sie, wußte aber nicht, was für Dinge es waren. Manchmal erstickte sie beinahe an dem Aufruhr der Gefühle und Wünsche, die sie nicht in Worte fassen konnte.
Clementine war neun, als sie zum ersten Mal etwas von Cowboys hörte.
Es geschah, als die Köchin ein neues Küchenmädchen einstellte. Sie hieß Shona MacDonald. Shona hatte Haare, die so rot waren wie ein Feuerwehrauto, und ein Lächeln, das in ihrem Gesicht strahlte wie die Sommersonne.
Als sie sich zum ersten Mal sahen, kniete sich Shona auf den Boden und drückte Clementine so fest an sich, daß sie keine Luft mehr bekam. Der Duft von Lavendelwasser stieg Clementine in die Nase, und sie mußte beinahe niesen. Rauhe, von der Arbeit aufgesprungene Hände streichelten ihre Schultern. Dann hob Shona sie hoch und richtete sich bewundernd auf. »Du meine Güte, was bist du für ein hübsches Mädchen«, sagte sie. »Ich habe noch nie Solche Augen gesehen. Sie sind wie ein Loch in der Dämmerung. Ganz stürmisch grün und dunkel, so voller Geheimnisse und Rätsel.«
Wie gebannt von den fröhlichen Worten und dem strahlenden Lächeln starrte Clementine sie an. Noch nie hatte sie jemand in die Arme genommen, und sie wünschte, Shona würde es noch einmal tun.
Sie lächelte ebenfalls und fragte: »Was ist ein Loch?«
»Ein Loch ist ... eine große Pfütze, weißt du?«
Shona lachte. Es war ein Ton wie Rosenblüten – süß und weich. Clementine starrte auf die glänzenden schwarzen Spitzen ihrer Schuhe. Sie fürchtete sich, Shona anzusehen; sie fürchtete sich beinahe zu fragen, aber dann tat sie es doch.
»Glaubst du, du könntest meine Freundin sein?« sagte sie.
Shona nahm sie noch einmal in die starken weichen Arme. »Ach, du armes kleines Ding. Natürlich bin ich deine Freundin.« Clementine wurde es beinahe schwindlig vor Glück bei diesen Worten.
Sonntag nachmittags hatte die Köchin frei. Es war ruhig im Haus zwischen den Gottesdiensten, und Clementine sollte die Stunden im Gebet verbringen. Statt dessen saß sie in der Küche bei ihrer Freundin.
›Meine Freundin.‹
Sie liebte den Klang dieser Worte. Clementine sagte sie sich vor, wenn sie die Dienstbotentreppe hinunterschlich.
›Meine Freundin, meine Freundin ... Ich gehe, meine Freundin besuchen.‹
Shona las mit Begeisterung billige Romane. Sie verwendete den größten Teil ihres kärglichen Lohns für den Kauf von wöchentlich erscheinenden Wildwestromanen der Reihe Spannung und Unterhaltung für fünf Cents. Die Romane waren eine Fundgrube von Träumen, und Shona war bereit, sie an diesen heimlichen Treffen an Sonntagnachmittagen mit Clementine zu teilen.
Clementine saß mit baumelnden Beinen auf dem Mehlkasten und las die Geschichten von Revolver schwingenden Cowboys und wilden Mustangs, von bösen Rinderdieben und skalpierenden Indianern laut vor.
Shona schrubbte die Kupfertöpfe mit einer Paste aus Zitronensaft und Salz. Hin und wieder unterbrach sie ihre Arbeit, betrachtete die Bilder und gab in ihrer kehligen schottischen Aussprache Kommentare dazu ab.
»Und wen interessiert es schon, ob man den Cowboy auf frischer Tat ertappt hat, als er Pferde stehlen wollte? Der Mann ist zu hübsch, um gehängt zu werden. Der braucht eine ordentliche Frau. Eine Frau, die ihn liebt und ihn vom Pfad der Sünde abbringt.«
»Ich glaube, wenn ich groß bin, würde ich gern einen Cowboy heiraten«, sagte Clementine. Bei dieser wunderbaren Vorstellung erschauerte sie.
»Ach, Miss Clementine, würden wir das nicht alle liebend gern? Aber Cowboys sind wie wilde Pferde, wie diese Mustangs. Sie lieben ihre Freiheit mehr als alles auf der Welt. Aber träumen kann man davon, sich so einen Mann mit dem Lasso einzufangen, träumen kann man ruhig davon ...«
Der Duft der Zitronenpaste mischte sich mit den anderen Küchengerüchen von Hefe und Kaffeebohnen und Stockfisch. Aber Clementines Nase befand sich nicht länger in Boston. Sie war in der Prärie und roch die würzigen Kräuter, die Büffelhäute und den Rauch der Holzfeuer, den der Wind aus dem Westen mit sich trug.
Eines Sonntags bekam Shona den ganzen Tag frei, um die Fähre über den Charles River zu nehmen und ihre Familie zu besuchen, die am anderen Ufer lebte. Clementine verbrachte die kostbaren Stunden, die normalerweise in Shonas Gesellschaft vergingen, allein in der Küche. Sie saß mit aufgestützten Ellbogen, das Gesicht zwischen den Fäusten, am Arbeitstisch mit den zahllosen Kerben und betrachtete Shonas Sammlung von Bildkarten berühmter Banditen und Cowboys. Und sie träumte.
Erst als ein Schatten auf die Holzplatte fiel, merkte sie, daß ihr Vater in die Küche gekommen war. Sie versuchte, die Karten unter einem Stapel frisch gewaschener Handtücher zu verstecken. Er deutete nur mit dem Zeigefinger und streckte stumm die Hand aus, bis sie ihm die Karten gab.
Sie starrte auf die Tischplatte, während sich ihr Vater langsam ein Bild von ihrer Sünde machte, indem er eine Karte nach der anderen betrachtete.
»Ich habe darauf vertraut, daß du betest, und statt dessen finde ich dich hier beim Betrachten dieser ... dieser ...« Seine Finger zerknüllten die Karten, und die starre Pappe brach und riß. »Woher hast du sie? Wer hat es gewagt, dir diesen ekelhaften Schund zu geben?«
Clementine hob den Kopf. »Niemand. Ich habe die Karten ... gefunden.«
Die Luft begann zu zittern, als sei ein heftiger Wind in die sonnige Küche gedrungen. »Spruch zwölf, Absatz dreizehn, Tochter.«
»›Der Gottlose verrät sich durch die Sünde seiner Lippen.‹«
»Spruch zwölf, Absatz zweiundzwanzig.«
»›Lügende Lippen sind dem Herrn ein Greuel.‹ Aber ich habe sie gefunden, Vater. Wirklich. Vor der Hintertür. Vielleicht hat sie der Lumpensammler dort liegenlassen. Er sieht sich immer so ekelhaften Schund an.«
Er sagte nichts mehr, sondern wies auf die Dienstbotentreppe. Clementine ging an seinem ausgestreckten Arm vorbei. »Ich habe sie gefunden«, wiederholte sie, und es war ihr gleichgültig, ob ihre Seele wegen dieser Lüge für immer in das Meer aus Feuer und Schwefel verdammt werden würde.
In ihrem Zimmer kniete sich Clementine auf die Bank in der Fensternische und beobachtete die Möwen, die zwischen den Ulmen und über den grauen Schieferdächern kreisten, herabstießen und aufstiegen. Langsam verblaßte der Sonnenschein. Ein Laternenanzünder ging mit seiner langen Stange durch die Straße. Hinter ihm leuchtete ein Lichtpunkt nach dem anderen auf wie eine Kette von Glühwürmchen. Von unten hörte sie das Geräusch einer Tür, die geöffnet und geschlossen wurde, und das Klappern von Absätzen auf den Granitstufen des Dienstboteneingangs. Über dem schmiedeeisernen Geländer tauchte ein schäbiger Strohhut auf, gefolgt von einem dicken roten Zopf, der auf einem verblaßten indischen Schultertuch tanzte. An einer rauhen, von der Arbeit geröteten Hand hing ein billiger Strohkoffer.
»Shona!«Clementine riß das Fenster auf und rief hinter dem grünen und blauen Schultertuch her, das in der Dämmerung verschwand. »Shona!« Sie beugte sich so weit aus dem Fenster, daß ihr die hölzerne Fensterbank in den Magen schnitt. »Ich habe es ihm nicht gesagt! Shona, warte doch, ich habe nichts gesagt!«
Shona wurde schneller; sie rannte beinahe, und der Strohkoffer schlug gegen ihre Beine. Obwohl Clementine immer wieder ihren Namen rief, warf sie keinen einzigen Blick zurück.
»Clementine.«
Sie drehte sich so schnell um, daß sie beinahe von der Bank gefallen wäre. Ihr Vater stand vor ihr. Er hatte den Stock bei sich. »Steh auf und streck die Hände aus, Tochter.«
Diese Strafe gab es für die schwersten Vergehen. Drei Hiebe mit dem Malakkarohr auf die Hände. Es tat schrecklich weh, aber sie hatte es schon öfter überstanden und glaubte, daß sie auch dieses Mal nicht weinen werde. Sie würde nicht weinen, weil es ihr dieses Mal nicht leid tat.
Sie streckte die Hände mit den Handflächen nach oben aus, und sie zitterten nur ganz wenig.
Der Rohrstock wurde gehoben und sauste nach unten. Er fuhr zischend durch die Luft und traf ihre Hand. Clementine schwankte und biß sich beinahe die Lippe blutig. Aber sie schrie nicht. Der peitschendünne Rohrstock hinterließ einen roten, brennenden Striemen.
›Meine Freundin‹, sagte sie bei jedem Schlag zu sich, ›meine Freundin, meine Freundin.‹
Die Worte stiegen in ihr auf wie eine Beschwörung oder wie ein Gebet.
Dann stieß er die Luft aus, die sich in seiner Brust gestaut hatte, und warf mit einer knappen Kopfbewegung die Haare über seinen Augen zurück. »Auf die Knie. Und bitte Gott um Vergebung.«
Ihre Hände brannten. Sie sah ihn stumm und mit großen Augen an.
»Clementine, Tochter ... Der Allmächtige wendet sich von dir ab, wenn du der Wildheit in deinem Herzen nachgibst.«
»Aber es tut mir nicht leid! Ich würde es wieder und wieder und wieder tun. Es tut mir nicht leid.«
Seine Finger umklammerten den Stock so heftig, daß er zitterte. »Dann streck die Hände aus, denn ich bin noch nicht fertig.«
Sie streckte die Hände aus.
Beim fünften Schlag, bisher hatte es immer nur drei gegeben, platzte die Haut. Sie zitterte am ganzen Körper. Aber sie gab keinen Laut von sich. Wieder und wieder traf der Stock ihre aufgerissenen Hände. Clementine wußte, sie mußte nur schreien oder sagen, daß es ihr leid tue. Doch sie würde nicht nachgeben, sie würde von jetzt ab niemals nachgeben. Und so hob sich der Stock und sauste herab, wieder und wieder und wieder.
»Theo, hör auf! O mein Gott, hör auf, hör auf!«
»Ich kann nicht aufhören. Um ihrer Seele willen darf ich nicht aufhören!«
»Sie ist nur ein Kind. Sieh nur, was du angerichtet hast ... Sie ist doch nur ein Kind.«
Clementine hörte das Geschrei durch ein lautes Rauschen in den Ohren. Krampfhafte Schauer durchzuckten ihren mageren Körper. Auf ihren Handflächen war die Haut in langen Streifen aufgerissen. Blut quoll daraus hervor und tropfte auf den Teppich mit dem flauschigen Muschelmuster. Sie glaubte, das süße und heiße Blut in ihrer Kehle zu schmecken.
Die Arme ihrer Mutter, der Rosenduft ... Sie wollte ihr Gesicht an diese nach Rosen duftende Brust pressen, aber es schien, als könne sie sich nicht mehr rühren. Ihr Vater hielt immer noch den Stock umklammert, aber die Tränen liefen ihm in den Bart. Seine Stimme zitterte. »›Du sollst dein Kind mit der Rute züchtigen, und du wirst eine Seele vor der Hölle erretten.‹ Was wäre ich für ein Vater, wenn ich ihr erlauben würde, die Pfade des Bösen einzuschlagen? Sie ist wild und voll Sünde ...«
»Aber Theo, du gehst zu weit.«
Ein Schluchzen entrang sich seiner Kehle. Der Rohrstock fiel zu Boden, und er sank auf die Knie. Seine Hände hoben sich zum Himmel. »Komm, Tochter, wir müssen beten. Die Hölle ist ein Feuermeer, das niemals gelöscht werden kann. Aber ich werde dir den Weg des Herrn zeigen ...«
»Es tut mir nicht leid! Es tut mir nicht leid!« schrie Clementine. Aber sie weinte nicht.
»Ich will nicht beten.« Beten wäre das Eingeständnis gewesen, daß es ihr leid tat.
Die Matratze knarrte, und der Gehrock ihres Vaters raschelte, als er das Gewicht verlagerte. Er saß neben ihr auf dem Bettrand. Sie lag mit den Händen über der Decke auf dem Rücken. Ihre Mutter hatte Salbe auf die Wunden getan und sie verbunden, doch selbst die Tränen ihrer Mutter hatten die Schmerzen nicht aufhören lassen. Clementine hatte nicht geweint. Sie hatte sich fest vorgenommen, nie mehr zu weinen.
Er verlagerte das Gewicht noch einmal und seufzte. »Kind, Kind ...« Er berührte sie nur selten. Jetzt legte er ihr die große Hand auf die Wange. »Was ich getan habe, was ich tue, geschieht aus Liebe. Damit du in den Augen des Herrn als eine reine Seele heranwächst.«
Clementine starrte in das Gesicht ihres Vaters. Sie glaubte ihm nicht, denn wie konnte er sie wirklich lieben, wenn sie böse und voller Wildheit blieb? Und wenn ihr das nicht einmal leid tat?
»Ich will nicht beten«, sagte sie noch einmal.
Er senkte den Kopf. Er schwieg so lange, daß sie dachte, er bete stumm.
Schließlich sagte er. »Dann gib mir einen Gutenachtkuß, Tochter.«
Er beugte sich über sie, und sein Gesicht war so dicht vor ihr, daß sie den Duft seiner Rasierseife und die Stärke an seinem Hemd roch. Sie hob den Kopf und berührte mit den Lippen die weichen schwarzen Barthaare auf seiner Wange. Sie legte sich in die Kissen zurück und rührte sich nicht, bis er das Zimmer verlassen hatte. Dann fuhr sie sich mit dem Handrücken so lange über den Mund, bis ihre Lippen brannten.
Sie zog eine geknickte und zerknüllte Bildkarte unter dem Kopfkissen hervor. Immer und immer wieder versuchte sie, die Karte mit den verbundenen Fingerspitzen glattzustreichen.
Ein Cowboy lächelte sie mit strahlenden blauen Augen an. Ein Cowboy mit einem Fransenhemd und einem riesigen Hut. Er schwang ein Lasso mit einer Schlinge über dem Kopf, die so groß war wie ein Heuhaufen.
Clementine sah ihn so lange und so eindringlich an, daß es ihr vorkam, als müsse sie sich nur etwas mehr anstrengen, um ihn lebendig und lachend hierher zu beschwören.
Die Tür ging auf, und er stand in ihrem Zimmer ...
»Du bist jetzt eine erwachsene Frau.«
Clementines Mutter sagte das an dem Tag zu ihrer Tochter, als sie sechzehn wurde. An diesem Morgen durfte Clementine die Haare zu einem dicken Knoten am Hinterkopf aufstecken.
›Du bist jetzt eine erwachsene Frau ...‹
Sie betrachtete aufmerksam das Gesicht im Spiegel des Toilettentischs. Aber sie sah nur sich selbst.
Ab nun gibt es keine Hauben mehr, dachte sie mit einem plötzlichen Lächeln. Sie rümpfte die Nase, nahm die Haube, die sie am Tag zuvor getragen hatte, und warf sie ins Feuer: Keine Hauben mehr, und sie war erwachsen. Sie drehte sich auf den Zehenspitzen und tanzte lachend durch das Zimmer.
Es war ihr Geburtstag, der Tag vor Weihnachten, und sie gingen in eine Photogalerie, um sich aufnehmen zu lassen. Sie machten einen Familienausflug daraus, und ihr Vater kutschierte den neuen schwarzen Brougham selbst. Die Dächer und Baumwipfel trugen alle weiße Häubchen. Die frostige Winterluft machte die Nase gefühllos und rötete die Wangen, und es roch nach den Festtagen – nach Holzfeuern, gerösteten Maronen und Zweigen aus Immergrün. Sie kamen am Stadtpark vorbei, wo Kinder auf vereisten Pfaden Schlitten fuhren. Ein Mädchen mußte gegen eine Baumwurzel gestoßen sein, denn der Schlitten hielt mit einem Ruck an, während sie einen Purzelbaum schlug und wie ein riesiger Schneeball, aus dem der blaue Rock und rote Strümpfe leuchteten, über den Boden rollte. Das helle, weithin hallende Lachen klang bis zum niedrigen Winterhimmel, und Clementine wünschte sich, dieses Mädchen zu sein. Sie wünschte es sich traurig und voll unerfüllter Sehnsucht. Sie war nie Schlitten gefahren, nie auf dem Jamaica Pond Schlittschuh gelaufen und hatte nie Schneebälle geworfen. Aber jetzt war sie zu alt, war eine erwachsene Frau. Clementine mußte in diesem Augenblick an all das denken, was sie im Leben bereits versäumt hatte, und an alles, was sie jetzt versäumte.
Ihr Vater wartete an einer Straßenkreuzung, um einem Bierwagen die Vorfahrt zu lassen. In dem Eckhaus stand eine Frau mit einem kleinen Jungen in einem großen verglasten Erker. Die Hand der Frau lag auf der Schulter des Jungen, und sie blickten auf die tanzenden Schneeflocken. Ein Mann erschien plötzlich hinter ihnen. Die Frau hob den Kopf und wandte ihm liebevoll das Gesicht zu. Clementine hielt den Atem an, denn sie glaubte, der Mann werde die Frau am Fenster und vor den Augen der ganzen Welt küssen.
»Clementine«, ermahnte sie die Mutter. »Starr nicht auf die Leute! Eine Dame tut so etwas nicht.«
Clementine lehnte sich schuldbewußt an das lederne Rückenpolster und seufzte. Ihre Seele war wund und aufgerieben von einem ruhelosen Sehnen. In ihrem Leben fehlte etwas. Etwas fehlte, fehlte, fehlte. Die Unruhe quälte sie Tag und Nacht. Sie wäre lieber tot, abgestorben und trocken wie ein Baum im Winter gewesen, der scheinbar nie mehr Blätter treibt, als von dieser ständigen Sehnsucht nach unbekannten, namenlosen Dingen gequält zu werden. Aber die Sehnsucht nach dem, was in ihrem Leben fehlte, ließ sie nicht zur Ruhe kommen.
Die Stanley Addison Photogalerie befand sich im obersten Stockwerk eines braunen Sandsteinhauses in der Milk Street. Mr. Addison war kein vornehmer Herr. Er trug eine gestreifte, geschmacklos grüne Weste und einen Papierkragen. Sein Schnurrbart war so dünn, daß es aussah, als sei er mit Tusche auf die Haut unter der Nase gemalt. Doch Clementine nahm kaum Notiz von ihm. Sie bestaunte die Beispiele seiner Kunst, die Photographien und Ferrotypien, die an den braunen Wänden der Galerie hingen.
Sie ging langsam durch den Raum und betrachtete aufmerksam jedes Porträt: Herren mit ernsten Mienen und in großspurigen Posen, Schauspielerinnen und Opernsängerinnen in phantasievollen Kostümen, Familienbilder mit Vater, Mutter und den Kindern wie Orgelpfeifen ...
Plötzlich blieb sie stehen und begann unwillkürlich, leise vor sich hin zu summen.
Da war ein Cowboy, aber ein richtiger, kein kostümierter wie auf den Bildkarten. Er trug silberbeschlagene Chaparejos, ein Fransenhemd aus Leder und um den Hals ein großes, geknotetes Taschentuch. Er saß breitbeinig auf einem Heuballen und hatte die Stiefel soweit auseinandergestellt, als sei er mehr daran gewöhnt, auf einem Pferd zu sitzen. Über einem Knie hing ein zusammengerolltes Lasso, und auf den Oberschenkeln lag ein Gewehr. Der Mann mußte stolz auf seine Waffen sein, denn er trug an einem breiten Ledergurt um die Hüfte zwei Revolver mit perlenbesetzten Griffen. Ein dichter langer Schnauzbart fiel bis über die Mundwinkel und verbarg die Lippen. Die breite Hutkrempe warf dunkle Schatten über die Augen. Er sah wild und jung aus, leidenschaftlich und edel. Er schien so ungezähmt zu sein wie das Land, über das er ritt.
Clementine bestürmte Mr. Addison mit Fragen. Sie wollte wissen, wie eine Photographie entstand. Sie wollte selbst eine Aufnahme machen. Sie achtete nicht auf das finstere Gesicht ihres Vaters, und ihr entging, daß Mr. Addison vor Verlegenheit rot wurde und stotterte, als er die Familie in seinen, wie er sagte, ›Kamera-Raum‹ bat, wo er ihre Porträts aufnehmen wollte.
Der Raum faszinierte Clementine noch mehr als die Galerie. Ein riesiges Fenster war in das Dach geschnitten worden und sorgte für ein gleichmäßiges helles Licht. Entlang der Wände standen bemalte Wandschirme, auf denen Gärten, überwachsene Spaliere und Terrassen mit Säulen dargestellt waren. Es gab sogar ein Bild mit ägyptischen Pyramiden. Zwischen den Wandschirmen standen Spiegel in unterschiedlichen Größen und eine große, mit Zinnfolie bespannte Tafel auf Rädern.
Die Kamera, ein großer Holzkasten mit einem akkordeonähnlichen Balg, war auf ein fahrbares Stativ montiert. Clementine ging um den Apparat herum und versuchte herauszufinden, wie er funktionierte. Sie lächelte Mr. Addison schüchtern an und fragte unsicher, ob sie einmal durch das große starre Auge der Kamera blicken dürfe.
Er errötete und stolperte beinahe über seine eigenen Füße, als er ihr zeigte, wie das gemacht wurde. Clementine drückte das Auge an eine Öffnung an der Oberseite des Kastens und sah Reverend Kennicutt und seine Ehefrau.
Der Wandschirm im Hintergrund zeigte ein vornehmes Wohnzimmer. Ihr Vater nahm auf einem fransenbesetzten Stuhl Platz, seine Frau Julia stellte sich hinter ihn. Sie legte ihm die Hand auf die Schulter, und er hielt sie mit seiner Hand fest, als fürchte er, sie werde aus dem Raum fliehen, wenn er sie nicht daran hinderte. Eine große Palme in einem Blumentopf sorgte für eine dekorative Wirkung, denn die Wedel wölbten sich wie ein großer grüner Schirm über die beiden Köpfe.
Als Clementine ihre Eltern durch die Linse der Kamera sah, erschien es ihr, als seien die beiden weit weg und nicht von dieser Welt. Oder aber ihre Eltern seien immer noch auf der Welt, sie selbst sei jedoch an einem anderen Ort. Ihr Vater bewegte ungeduldig die Füße, was seine Würde beeinträchtigte. Er fühlte sich sichtlich unbehaglich. Die Palmwedel warfen Schatten über das Gesicht ihrer Mutter. Sie war schön.
Clementine wußte, sie sah wie ihre Mutter aus. Sie hatten die gleichen hellblonden Haare und dunkelgrüne Augen. Sie erweckten beide den Eindruck, zerbrechlich wie Porzellan zu sein.
Eine junge Frau und eine erwachsene Frau.
Clementine versuchte, im Gesicht ihrer Mutter die Frau zu sehen, die sie einmal sein würde. Es gab so viele Fragen, die sie dieser Frau stellen wollte.
Warum hast du gelacht, als der Arzt sagte, du könntest keine Kinder mehr bekommen? Wolltest du nie am Fenster stehen und das Gesicht einem Mann zuwenden, damit er dich küßt? Gibt es leere Stellen in dir, Sehnsüchte, für die du keine Worte hast?
Clementine wollte Photographien vom Gesicht ihrer Mutter machen und sie dann lange betrachten, um Antworten auf diese Fragen zu finden.
»Miss Kennicutt, ich glaube, Ihr Vater wird ungeduldig.«
Clementine verließ den Platz hinter der Kamera und stellte sich zu ihren Eltern neben die Palme. Sie war sich der Kamera bewußt, sah mit ihrem Auge und hielt Abstand zu den Eltern. Selbst als Mr. Addison sie bat, näher heranzurücken, achtete sie darauf, daß nichts von ihr, nicht einmal der Ärmel oder der Saum ihres Kleides den Mann und die Frau berührte, die ihr das Leben geschenkt hatten.
Mr. Addison befestigte Stützen hinter ihren Köpfen, um ihnen das Stillhalten zu erleichtern. Dann verschwand er in einer Art Schrank, und ein scharfer, beißender Geruch, der an medizinischen Alkohol erinnerte, erfüllte den Raum. Wenige Augenblicke später tauchte er wieder auf. Er bewegte sich fahrig und sprunghaft wie ein Kaninchen. Er trug ein rechteckiges flaches Holzkästchen, das er in eine Öffnung der Kamera schob. »Heben Sie bitte das Kinn, Mrs. Kennicutt. Äh, Reverend, wenn Sie bitte an Ihrer Weste zupfen könnten. Jetzt atmen Sie alle tief ein und halten den Atem an ... anhalten, anhalten ... Miss Kennicutt, wenn ich Ihnen ein Lächeln entlocken könnte?«
Clementine lächelte nicht. Sie wollte sich alles genau merken, was er tat, um es zu verstehen. Ihr eindringlicher Blick glitt von dem wundersamen Holzkasten zu den Dekorationen aus Pappmaché und den bemalten Wandschirmen. Eine wachsende Erregung erfüllte sie, bis sie glaubte zu summen wie die neuen Telefone in der Halle des Tremont House Hotels.
Sie begann in diesem Augenblick zu ahnen, zu begreifen und zu wissen, was sie vom Leben wollte. Und so kam es, daß Clementine Kennicutt ein Jahr später, als sie ein Cowboy aus Montana auf einem Hochrad anfuhr, bereit für ihn war.
Es wäre nie zu dem Zusammenstoß gekommen, wenn sich nicht ein Rad am schwarzen Brougham ihres Vaters gelockert hätte. Das Rad begann zu wackeln, als sie in die Tremont Street einbogen, und bald schwankte das ganze Gefährt bedrohlich. Ihr Vater fuhr an den Straßenrand, um Clementine aussteigen zu lassen. Sie befanden sich bereits ganz in der Nähe vom Tremont House Hotel, wo Clementine ihre Mutter und Tante Etta zum Tee treffen sollte. Deshalb erlaubte der Vater, daß sie sich ohne seine Begleitung zu Fuß auf den Weg machte.
Clementine ging langsam und genoß den schönen Tag. Die Markisen der Geschäfte schützten die Fußgänger vor der ungewöhnlich heißen Februarsonne. Aber die Wärme des vielversprechenden Frühlings lag auch in der leichten Brise und fühlte sich auf Clementines Haut so samtig und weich wie Milch an. Eine Walzermelodie drang klimpernd durch die offenen Türen eines Klaviergeschäfts. Clementine mußte sich zusammennehmen, um nicht dem fröhlichen Drang nachzugeben, auf dem Gehweg zu tanzen.
Vor dem Schaufenster einer Putzmacherin blieb sie stehen und blickte sehnsüchtig auf ein Frühlingshäubchen aus weißem Reisstroh. Eine lange leuchtend rote Feder zog den Blick auf sich und wurde seitlich von einer Spange gehalten. Clementine wußte, eine Dame hätte die Feder vulgär gefunden, aber ihr gefiel sie. Der Hut war auffällig und schillerte so bunt wie ein Pfau. Er schien der ganzen Welt zu verkünden: »Seht her, ich bin schön!«
Aus einem anderen Geschäft drang der köstliche Duft von Schokolade und Süßigkeiten. Clementine folgte dem Duft, bis sie vor einer Pralinenpyramide stand. Seufzend drückte sie die Nase an das Schaufenster. Sie bekam nie Geld, das sie für sich ausgeben konnte, sonst wäre sie in den Laden gegangen und hätte sich ein Dutzend dieser Köstlichkeiten gekauft. Sie hätte langsam eine Praline nach der anderen gegessen und zuerst den Schokoladenüberzug abgeleckt, bevor sie auf die weiche süße Füllung biß.
Plötzlich hörte sie das aufgeregte Bimmeln der Pferdebahn, es folgte ein Schrei und wütendes Schimpfen. Aus den Augenwinkeln sah sie etwas Helles blitzen. Es waren die Speichen eines riesigen Zweirades, das sich einen Weg durch den dichten Verkehr auf der Straße suchte.
Sie hatte einmal in der Zeitung so ein Wunderding gesehen. Es war ein Hochrad oder ein Fahrrad, wie man es inzwischen nannte. Die Hersteller behaupteten, man könne damit an einem Tag eine größere Entfernung zurücklegen als auf dem besten Pferd. Als Clementine das Hochrad jetzt sah, fragte sie sich staunend, wie es jemandem überhaupt gelang, im Sattel zu bleiben.
Das riesige Vorderrad war etwa mannshoch. Durch ein gebogenes Metallrohr war damit ein kleineres, etwa tellergroßes Rad verbunden. Der Radfahrer saß auf einem winzigen Ledersattel über dem großen Rad und trat heftig in die Pedale. Den Mund unter dem Schnauzbart hatte er weit geöffnet. Bei dem Tumult, den er auf seinem tollkühnen Gefährt hervorrief, konnte Clementine nicht sagen, ob er einen Entsetzensschrei ausstieß oder ob er lachte. Alles wich bei seinem Anblick vor ihm aus. Fahrzeuge und Fußgänger machten ihm eilig den Weg frei.
Er schnitt einer Pferdebahn den Weg ab. Die Pferde scheuten und wieherten. Der Kutscher läutete noch immer stürmisch die Glocke, als der Fahrradfahrer schon längst an ihm vorbeigefahren war. Es kam fast zu einem Zusammenstoß mit einem leichten Zweispänner, in dem eine elegante Dame saß, und dann rammte er einen Wagen der Straßenreinigung. Durch den Aufprall geriet der Wagen auf den Gehweg; die Sprinkler beschrieben einen nicht beabsichtigten Halbkreis und besprühten die Passanten vor Harrisons Textilwaren.
Wie durch ein Wunder war das Hochrad nicht umgefallen, obwohl der Mann auf dem Sattel inzwischen wie ein betrunkener Matrose schwankte. Es fuhr gegen einen hochstehenden Pflasterstein, rollte weiter, geriet aber aus der Bahn und landete schließlich auf dem Gehweg. Der Fahrradfahrer verfehlte um Haaresbreite den Stand eines Peitschenverkäufers, streifte das hintere Ende eines Karrens, auf dem Maronen geröstet wurden, und kam geradewegs auf Clementine Kennicutt zu.
Sie wollte davonlaufen, aber ihre Beine gehorchten ihr nicht. Es kam ihr nicht in den Sinn zu schreien, denn sie hatte gelernt, unter allen Umständen ihre Würde zu wahren. Deshalb stand sie einfach da und starrte auf das riesige Rad, das geradewegs auf sie zurollte, als hätte es jemand gezielt auf sie losgelassen.
Der Mann sah die junge hübsche Dame und versuchte ihr auszuweichen, indem er das Rad im letzten Augenblick herumriß. Die Reifen rutschten quietschend über die Granitplatten. Clementine roch den erhitzten Gummi, bevor der Fahrer über die Lenkstange schoß und auf sie flog. Er warf sie auf den Rücken, und sie bekam keine Luft mehr.
Ihr Brustkorb schmerzte, als sie erschrocken versuchte zu atmen. Sie starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die Unterseite der Markise des Süßwarengeschäfts. Die grünweiß gestreifte Leinwand blähte sich verschwommen über ihr.
»Ach du liebe Zeit!«
Das Gesicht eines Mannes nahm ihr die Sicht auf die Markise und warf einen Schatten über sie. Es war ein hübsches Gesicht mit lachenden Lippen, die ein dichter langer Schnauzbart umrahmte, der so braun war wie Ahornsirup.
»Ach du liebe Zeit«, rief er noch einmal. Er schob sich den großen, weichen grauen Hut aus der Stirn, und Clementine sah seine hellbraunen Haare, deren Spitzen von der Sonne blond gebleicht waren. Er wirkte wie ein kleiner Junge, der geschlafen hat und beim Aufwachen nicht sofort weiß, wo er ist. Clementine hatte den merkwürdigen Wunsch, ihm die Wange zu tätscheln, um ihn zu trösten.
Dabei war alles seine Schuld; schließlich war er über das Vorderrad des Hochrads gesegelt und auf sie gefallen.
Sie richtete sich auf und stützte sich dabei auf den Ellbogen. Er faßte sie am Arm. »Langsam ... Seien Sie vorsichtig«, sagte er, aber im nächsten Augenblick stand sie wieder auf den Beinen, denn er hob sie hoch. Sie spürte die Kraft seiner starken Hände, und ein Schauer lief ihr über den Rücken.
»Danke für Ihre Hilfe, Sir.« Der schlichte schwarze Strohhut war über ihr rechtes Auge gerutscht. Er rückte ihn zurecht. Sie wollte sich auch dafür bedanken, vergaß es jedoch, als sie in seine Augen blickte. Sie waren so blau wie der Sommerhimmel und strahlten sie an.
»Es tut mir leid, daß ich Sie umgeworfen habe«, sagte er.
»Wie? O nein, bitte ... Es ist nichts passiert.«
Sein Mund verzog sich zu einem Lächeln, das sein Gesicht jungenhaft und übermütig machte. »Ihnen vielleicht nicht ... und mir auch nicht. Aber sehen Sie sich mein armes Fahrrad an.«
Die Speichen des großen Rades waren verbogen, und der rote Gummireifen lag im Rinnstein. Doch Clementine würdigte das Hochrad kaum eines Blickes.
Ich träume, dachte sie. Bestimmt träume ich, denn wie soll ein Cowboy den Weg nach Boston, Massachusetts, finden?
Seine Hose hatte Nieten. Er trug Lederstiefel mit aufgeprägten Mustern und hohen Absätzen. Das blaue Flanellhemd stand am Kragen offen, und um den kräftigen, sonnengebräunten Hals hatte er ein rotes Taschentuch geschlungen. Es fehlten nur die silbernen Sporen, zwei Revolver mit perlenbesetzten Griffen und das Lasso, und es wäre der Cowboy auf Shonas Bildkarte gewesen.
Er trat mit der Stiefelspitze gegen den Reifen und schüttelte den Kopf, obwohl er immer noch lächelte. »Die Dinger sind bockiger als ein Mustang aus Montana.«
»Montana ...«
Vor Staunen verschlug es ihr den Atem. Er sprach seltsam gedehnt und schleppend. Seine dunkle Stimme ging ihr durch und durch wie die Orgel in der Kirche ihres Vaters. »Was ist ein Mustang?«
»Ein wildes Pferd, das den ganzen Tag über die Prärie galoppiert, auf der Stelle wenden kann und ganz wild ist.«
Seine Art zu lächeln, dachte sie, paßt gut zu seinen Augen. Sie blickte in die lächelnden Augen, während er mit langen geschickten Fingern das Tuch um den Hals aufknotete. Er nahm das Tuch ab und beugte sich vor. Mit einer Ecke des weichen Baumwolltuchs entfernte er etwas von ihrem Gesicht. Die Berührung war so sanft wie das Gefühl einer Feder auf Seide.
»Schmierfett«, sagte er.
»Oh!« Sie schluckte so heftig, daß dabei ein seltsames Geräusch in der Kehle entstand. »Sind Sie wirklich ...?«
»Als ich mich das letzte Mal gezwickt habe, hat es weh getan. Also nehme ich an, daß ich wirklich bin.«
»Ich meine, ob Sie wirklich ein Cowboy sind«, sagte sie und lächelte.
Clementine hatte keine Ahnung, was mit ihrem Mund geschah, wenn sie lächelte. Der Mann starrte sie wie erstarrt und mit angehaltenem Atem an, als hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen. »Ich, äh ... ich bin ... ach du liebe Zeit.«
»Wenn Sie ein Cowboy sind, wo haben Sie dann die silbernen Sporen, die Chaparejos, das Lederhemd mit den Fransen und die zwei Revolver mit den perlenbesetzten Griffen?«
Er legte den Kopf zurück und lachte laut und fröhlich. »Ich habe mit meinem Onkel gewettet, daß ein Viehtreiber wie ich in Boston ein Fahrrad fahren kann, ohne aus dem Sattel zu fallen. Wenn ich den ganzen Kram angezogen hätte, würde ich wie ein Greenhorn beim ersten Viehtrieb aussehen.«
»Sie bringen mich zum Lachen, wenn ich Sie so reden höre.« Sie lachte allerdings nicht, sondern sah ihn verträumt an.
Er wurde ernst und blickte sie drei langsame, laut klopfende Herzschläge lang an. Es überraschte sie, daß er das Pochen ihres Herzens nicht hören konnte.
Dann legte er den Finger auf die Stelle, wo das Fett gewesen war. »Dieser Onkel von mir, er hat eine ganze Fabrik voller Fahrräder. Er veranstaltet morgen eine Vorführung, ein Rennen. Irgendwie habe ich mich überreden lassen, da mitzumachen. Warum kommen Sie nicht mit und sehen sich an, wie ich mich noch mehr lächerlich mache?«
Sie hatte noch nie irgendein Rennen gesehen, und sie dachte, Rennen müßten etwas Wunderbares sein. Ihr Vater würde ihr selbstverständlich niemals erlauben, eine so vulgäre Veranstaltung zu besuchen, erst recht nicht mit einem Mann, der für die Familie Kennicutt ein Fremder war.
»Wir kennen uns überhaupt nicht.«
»Gus McQueen.« Er zog schwungvoll den großen Westernhut und machte eine tiefe, übertrieben höfliche Verbeugung, die für einen Mann seiner Größe trotzdem seltsam anmutig wirkte. »Ich besitze eine Ranch mit ein paar hundert mageren Kühen mitten im Regenbogenland. Außerdem habe ich einen zwanzigprozentigen Anteil an einer Silbermine, die außer Dreck und Schlamm bisher nichts gebracht hat. Ich glaube, man könnte also sagen, daß meine Aussichten von der vielversprechenden Art sind, und meine Herkunft ist ... na ja, nicht unbedingt respektabel, aber soweit ich weiß, sitzt zumindest niemand aus meiner Familie gerade im Gefängnis.«
Er senkte den Blick und betrachtete den Hut in seinen Händen. Er drehte die weiche Krempe zwischen den Fingern. »Was mich angeht, so behaupte ich nicht, ein Heiliger zu sein. Aber ich lüge nicht und betrüge nicht beim Kartenspielen, ich trinke keinen Whiskey und bin nicht hinter lockeren Frauen her. Ich habe nie mein Brandzeichen dem Kalb eines andern aufgedrückt, und wenn ich mein Wort gebe, dann halte ich es. Und ich ...« Seine Finger legten sich fest um die Hutkrempe, als suche er nach Worten, um ihr klarzumachen, daß in ihm mehr steckte als der Cowboy, den sie sah. Er konnte nicht wissen, daß sie das, was sie sah, wundervoll fand.
Aber als er sie anblickte, lag das Lachen wieder in seinen Augen. »Im allgemeinen bin ich keiner dieser derben Kerle, die in Anwesenheit einer Dame fluchen, selbst wenn Sie es geschafft haben, mir in drei Minuten ebenso viele Flüche zu entlocken.«
Sie versuchte, entrüstet zu wirken, während sie vor Entzücken am liebsten in die Hände geklatscht und Luftsprünge gemacht hätte. »Sie sind ungerecht, Sir, mir die Schuld an Ihren Sünden zuzuschieben.«
»Aber es ist alles Ihre Schuld, Miss, absolut. Denn mir ist im ganzen Leben noch kein hübscheres Mädchen als Sie begegnet. Und wenn Sie lächeln ... wenn Sie lächeln, du meine Güte, dann sind Sie wirklich bezaubernd.«
Er war das Wunder! So wie er redete, und sein Lachen, das wie ein inneres Leuchten sein Gesicht strahlen ließ, und so wie er einfach war: groß, breitschultrig und stark, stand er als der Cowboy ihrer Träume vor ihr.
»Jetzt wissen Sie, wie ich heiße«, sagte er. »Warum lassen Sie nicht Gerechtigkeit walten und sagen mir Ihren Namen?«
»Wie? Ach so, Clementine ... Clementine Kennicutt.«
»Werden Sie morgen mitkommen und mir beim Rennen Zusehen, Miss Clementine Kennicutt?«
»O nein, nein ... ich könnte niemals ...«
»Natürlich können Sie.«
Eine seltsame, prickelnde Erregung stieg in ihr auf. Sie lächelte ihn nicht noch einmal an, sie wollte es nur.
»Um welche Zeit findet denn das Rennen statt, Mr. McQueen?«hörte sie sich fragen.
»Genau um die Mittagszeit.«
»Wissen Sie, wo die Kirche in der Park Street ist, von hier gerade eine Straße weiter?« Ihre Tollkühnheit machte sie ganz benommen. Clementine fühlte sich leichter als Luft und glaubte zu schweben. »Ich treffe Sie morgen um elf an den Ulmen vor der Kirche in der Park Street.«
Er setzte den Hut wieder auf und sah sie unter der Krempe hervor an. »Also ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist«, sagte er. »Ich meine, daß ich nicht Ihren Vater kennenlerne und ihn um Erlaubnis bitte, Ihnen richtig den Hof machen zu dürfen.«
»Er würde Ihnen die Erlaubnis dazu niemals geben, Mr. McQueen.« Sie unterstrich ihre Worte durch energisches Kopfschütteln. Die Enttäuschung schnürte ihr die Kehle zu, und sie konnte kaum atmen. »Niemals. Niemals.«
Er musterte sie nachdenklich und strich sich mit dem Daumen über den Schnauzbart. Sie wartete und blickte mit großen, ruhigen Augen zu ihm auf. Clementine wollte dieses Rennen sehen, und sie wollte noch andere Dinge, die mit ihm zu tun hatten. Bereits beim Gedanken daran krampfte sich ihr vor Aufregung der Magen zusammen. Sie wollte ihn Wiedersehen, mit ihm reden und ihn zum Lachen bringen.
»Ich nehme an«, sagte er schließlich, »wir werden es so machen müssen, wie Sie es wollen.«
Er streckte die Hand aus, und sie drückte sie. Seine Hand war groß und rauh, und ihre verschwand darin. Er rieb mit dem Daumen über ihre Handfläche, als wisse er von den Narben, die ihr Handschuh verbarg, und versuche, sie auszulöschen. »Nur noch eins ... Werden Sie mich heiraten, Miss Clementine Kennicutt?«
Sie zuckte zurück und entzog ihm die Hand. Etwas Unsichtbares traf sie an der Brust. Es bohrte sich wie ein Pfeil in ihr Herz. Es schmerzte und hinterließ eine bedrohliche Leere.
»Sie machen sich über mich lustig.«
»O nein, das niemals. Es ist nicht so, daß ich keinen Spaß an einem guten Scherz hätte. Im Leben gibt es zuviel Schmerz und Trauer, als daß man nicht hin und wieder Witze darüber machen müßte. Aber wenn es wirklich schlimm kommt ...« Er lächelte plötzlich. »Sagen wir, wenn ich die Rinder durch einen kalten Nordsturm treibe und der Schnee mir wie mit Nadeln ins Gesicht sticht, oder wenn der Wind über die Prärie heult wie eine verlorene Seele in der Hölle, dann überstehe ich das alles nur dank der Träume, die ich im Kopf habe. Etwa der Traum von jemandem, der zu Hause auf mich wartet, während das Feuer brennt, und auf dem Herd etwas kocht, das appetitlich duftet. Sagen wir, ein Mädchen mit hellblonden Haaren und großen grünen Augen ...« Er verstummte, als er sie ansah, und obwohl sie errötete, konnte sie den Blick nicht von ihm wenden.
Er schüttelte staunend den Kopf. Seine Augen lächelten sie immer noch an. »Glauben Sie mir, wenn es um meine Träume geht, Miss Clementine Kennicutt, bin ich ein sehr, sehr ernster und zuverlässiger Mensch.«
»Träume ...?« wiederholte sie und bewegte kaum die Lippen.
Er zog den Hut. »Bis morgen, Miss Kennicutt.«
Mr. McQueen hob so mühelos das zerbeulte Rad aus dem Rinnstein, als wiege es nicht mehr als ein Federkissen. Sie sah ihm nach, während er davonging. Sie beobachtete, wie die Leute ihm den Weg freimachten, sie stellte glücklich lächelnd fest, daß sein grauer Westernhut über schwarzen Zylindern und Melonen schaukelte, und wartete, bis nichts mehr von ihm zu sehen war.
Clementine ging wie betäubt die breiten Granitstufen des Tremont House hinauf und betrat durch das Säulenportal das Hotel. Kein Gentleman fragt ein Mädchen, das er kaum kennt, das er überhaupt nicht kennt, ob sie seine Frau werden will. Ein Gentleman kennt eine junge Dame schon immer, und seine Eltern kennen die Eltern der fraglichen Dame schon immer. Ein Gentleman trägt einen Gehrock und einen Zylinder, und er fährt nicht auf einem verrückten Fahrrad durch die Straßen. Ein Gentleman ...
Die Stimme ihrer Mutter war zwar niemals laut, aber sie drang durch das kultivierte Flüstern und das Rascheln der Seide in der Hotelhalle an ihr Ohr. »Clementine, was um alles in der Welt ist denn mit dir los? Dein Hut sitzt schief, dein Gesicht ist schmutzig, und sieh dir das an, der Ärmel deiner neuen Jacke hat einen Riß.«
Clementine blinzelte und sah, daß ihre Mutter und Tante Etta vor ihr standen. »Ich bin von einem Fahrrad angefahren worden.«
»Gütiger Himmel!« Julia Kennicutt stieß die Luft aus, und Tante Etta atmete hörbar ein. »Diese Teufelsdinger sind noch der Tod von uns allen«, murmelte Julia, und ihre Schwester stimmte ihr zu. »Sie sollten verboten werden. Nur ein Verrückter kann auch nur daran denken, sich auf ein ... ein Fahrrad zu setzen.«
Solche vulgären Ausdrücke aus dem Mund ihrer Mutter! Clementine war so schockiert, daß sie beinahe lächeln mußte. »Er ist kein Verrückter«, sagte sie und lachte schließlich doch. Ihr Lachen war laut und sehr unschicklich. Es war außerdem schockierend, denn es kam von einem Mädchen, das kaum einmal lachte. »Er ist ein Cowboy.«
Der große Zeiger der Uhr am eckigen weißen Turm der Kirche in der Park Street zeigte, daß es noch fünf Minuten bis elf war. Clementine zog den Mantelkragen enger um sich. Es war kälter als am Vortag. Die großen Ulmen warfen dunkle Schatten auf den Gehweg, und von der Bucht wehte eine steife Brise.
Sie ging an dem schmiedeeisernen Zaun entlang, der die Straße vom Friedhof trennte. Sie warf noch einmal einen Blick auf die Turmuhr. Eine lange, qualvoll lange Minute war vergangen.
Sie beschloß, ein kleines Spiel zu versuchen. Sie würde am Zaun bis zum Friedhofseingang starr und hoch aufgerichtet wie eine Ägypterin gehen, und wenn sie sich umdrehte, würde er da sein ...
»Miss Kennicutt!«
Ein klappriger, offener zweirädriger Wagen hielt mit einem lauten Quietschen der Räder neben ihr an, und sie blickte in das sonnengebräunte, lächelnde Gesicht eines Mannes unter dem breiten Rand eines großen grauen Hutes.
»Sie sind da«, sagte er. »Ich war unsicher, ob Sie kommen würden.«
»Ich war auch nicht sicher, daß Sie kommen würden.«
Lachend sprang er vom Wagen und half ihr beim Einsteigen. »Verzeihen Sie bitte das schäbige Fahrzeug«, sagte er, als er auf den Sitz neben ihr kletterte. »Mein Onkel hat fünf Söhne, und es sind nie genug Wagen für alle da. Na los, du alter Klepper!« trieb er das Pferd an, und der Wagen setzte sich so schnell in Bewegung, daß sie instinktiv ihren Hut festhielt. Der Ruck brachte sie aus dem Gleichgewicht, und sie fiel gegen ihn. Er war kräftig und überraschend warm. Sie erstarrte und rückte schnell, so weit sie konnte, von ihm ab, bis sie mit dem Arm und der Hüfte die Eisenstange um den Sitz spürte.
Seine Augen strahlten sie an. »Wahrscheinlich will ich das überhaupt nicht wissen, aber wie alt sind Sie eigentlich, Miss Kennicutt?«
Clementine blickte verwirrt auf die behandschuhten Hände, die sie im Schoß verkrampft hatte. Sie dachte daran zu lügen, aber er hatte gesagt, er sei ein ehrlicher Mann, und sie wollte sich seiner Achtung würdig erweisen.
»Siebzehn ... aber sagen Sie«, Clementine drehte den Kopf dorthin, wo das gefaltete Dach des Wagens gewesen wäre, wenn er eins gehabt hätte, »wo ist denn Ihr Fahrrad?«
»Ich habe es meinem Onkel überlassen, mir ein Fahrrad einzufangen und zu satteln. Ich sage mir, wenn er will, daß ich bei dem Rennen mitmache, dann kann er auch den ›Gaul‹ stellen.«
»Sie bringen mich zum Lachen, Sir ... so wie Sie reden.«
»Na ja, bisher habe ich es nur geschafft, daß Sie zweimal gelächelt haben. Aber ich werde es weiter versuchen, bis ...« Er blickte so nachdrücklich auf ihren Mund, daß sie sich auf die Unterlippe beißen mußte, damit er nicht sah, wie sie zitterte. »Bis ich es schaffe, daß Sie mich wieder anlächeln.«
Sie zwang sich, den Blick von ihm zu wenden, aber versuchte unauffällig, ihn aus den Augenwinkeln zu beobachten.
Er trug diesmal Sachen, die sich besser für das Radfahren eigneten: eine blaue Kniebundhose, gelbe Gamaschen und eine kurze, braune zweireihige Jacke. Unter der dünnen Samthose zeichneten sich deutlich die starken und muskulösen Oberschenkel ab. Wahrscheinlich war für einen solchen Mann Fahrradfahren eine harmlose Sache.
Sie wollte ihm so vieles sagen, und ihr lagen so viele Fragen auf der Zunge. Aber die Frage, die ihr dann über die Lippen kam, war so dumm, daß sie errötete. »Ist es wahr, was man über Montana sagt? Kann man wirklich von einem Ende zum anderen reiten, ohne auf einen Zaun zu stoßen?«
Er lachte, wie sie es nicht anders erwartet hatte. Aber es störte sie nicht, denn sie mochte sein Lachen. »Ich nehme an, hier und da stößt man auf einen Viehzaun. Und es gibt sehr hohe Berge, die einen zum Anhalten zwingen.«
Sie hatte von solchen Bergen gelesen, doch es war ihr nie gelungen, sie sich vorzustellen. Clementine kannte nur die steilen Felsen und die niedrigen Moränenhügel, die sich um die Salzsümpfe in der Umgebung von Boston erhoben.
Sie erreichten eine sehr befahrene Durchgangsstraße. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf den Verkehr, und so konnte sie ihn ungestört etwas genauer betrachten. Er war so groß, daß er den ganzen Sitz des Wagens auszufüllen schien. Eine Art fröhliches Glänzen ging von ihm aus wie bei einem brandneuen Kupferpenny. »Was führt Sie den weiten Weg hierher nach Boston, Mr. McQueen?«
Er drehte den Kopf, und ihre Blicke trafen sich. Sie hatte vergessen, daß seine Augen so blau und klar waren.
So blau wird auch der Himmel von Montana sein, dachte Clementine.
»Meine Mutter lag lange im Sterben«, erwiderte er. »Sie wollte mich vor ihrem Tod noch einmal sehen, also bin ich gekommen. Aber am Ende der Woche werde ich wieder gehen.«
»Das tut mir leid«, sagte sie und fügte hastig hinzu, damit er sie nicht falsch verstand, »ich meine, das mit dem Tod Ihrer Mutter tut mir leid.«
Ein Schatten zog über sein Gesicht wie Wolken über die Sonne. »Ich habe sie und Boston verlassen, als ich siebzehn war, so alt, wie Sie jetzt sind, und ich war noch nie gut im Schreiben.«
»Sind Sie durchgebrannt?«
Er warf ihr einen Blick zu und schnalzte mit der Zunge, um das Pferd um einen Eiswagen herumzulenken, der ihren Weg kreuzte. »Ich glaube, so könnte man sagen. Ich wollte Elefanten sehen.« Als sie ihn verständnislos anblickte, lachte er. »Ich wollte die Wunder des großen Wilden Westens sehen, Indianer und Büffel, Grizzlybären und die Goldflüsse.«
Auch sie sehnte sich nach solchen Wundern! Doch es schien alles außer ihrer Reichweite zu liegen, und daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern. »Und waren sie so wunderbar, wie Sie geglaubt hatten, ich meine, die Elefanten?«
Sie beobachtete ihn, während er einen Augenblick nachdachte. Er hatte etwas Aufregendes an sich und besaß ein strahlendes Licht, das tief in ihrem Innern etwas in Bewegung setzte.
»Montana ist von einer Größe, die vielen Menschen angst macht. Aber es ist nicht so groß, daß man nicht findet, was man sucht, wenn man weiß, wonach man sucht.« Ihre Blicke trafen sich wieder, und die Bewegung in ihrem Innern wurde stärker. »Manchmal, Miss Kennicutt, braucht ein Mensch nur einen Ort, zu dem er sich flüchten kann.« Clementine wußte nicht, wonach sie suchte. Vermutlich nach den fehlenden Dingen, aber die hätte sie selbst vor sich nicht in Worte fassen können. Sie wußte nur, daß sie sich in diesem Augenblick lebendig fühlte. Der Wind hatte eine salzige Schärfe, die Spätwintersonne sprenkelte die Markisen und ließ die Schaufenster schimmern, und sie würde in Begleitung eines Mannes, eines richtigen Cowboys, ein Radrennen sehen.
Er hielt das Pferd mitten auf der Straße an, ohne auf die Rufe und Schreie zu achten, die von den Wagen und Karren hinter ihnen kamen, die nicht weiterfahren konnten. Er wandte sich ihr zu. Um seine Augen lagen immer noch die Lachfältchen, aber sein Mund war ernst. »Gestern habe ich Ihnen einen meiner Träume erzählt. Wie wäre es, wenn Sie mir jetzt einen von Ihren erzählen. Wovon träumen Sie, Miss Kennicutt?«
Sie war plötzlich atemlos, als sei sie gerade auf den Gipfel eines seiner hohen Berge in Montana geklettert. »Ich weiß nicht«, sagte sie. Aber natürlich wußte sie es. Sie träumte von ihm. Sie hatte ihr ganzes Leben lang von ihm geträumt.
»Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt«, sagte er und blickte ihr forschend in die Augen. »Und ich bin zu meiner Zeit ziemlich weit herumgekommen. Wenn ein Mann soviel von der Welt gesehen hat wie ich, dann weiß er sofort, was er will, wenn es ihm über den Weg läuft.« Er strich mit dem Daumen über ihre Wange. Sein Lächeln machte sie noch atemloser, als sie es schon war. »Oder je nachdem, wenn er es überfährt. Ich finde, Sie und ich, wir passen zusammen. Ich könnte mir die Zeit nehmen, um Sie zu werben und Ihnen zu zeigen, daß wir zusammengehören. Aber entweder sehen Sie es jetzt, ich meine, daß das mit uns richtig ist, oder Sie sehen es nicht. Glauben Sie mir, keine Blumensträuße und Ständchen werden etwas an der Wahrheit ändern.«
Sie staunte darüber, daß er von Träumen sprechen konnte und im selben Atemzug alle Zweifel zur Seite schob. Sie hatte noch nie im Leben auf einem Pferd gesessen, doch in diesem Augenblick hatte sie das Gefühl, einen dieser Mustangs zu reiten, die den ganzen Tag galoppieren und auf der Stelle wenden konnten und ganz wild waren.
Sie drehte den Kopf weg, und ihr Herz pochte so laut, daß sie sich fragte, ob er es höre. »Daran kann ich noch nicht denken«, sagte sie.
Der salzige Wind trug ihr seine Worte zu. »Sie denken bereits daran, Miss Kennicutt. Ich weiß es, Sie sind bereits auf halbem Weg nach Montana.«