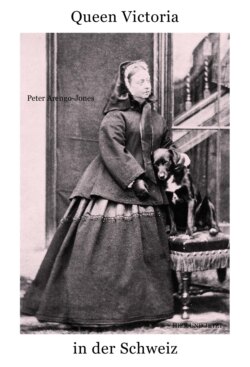Читать книгу Queen Victoria in der Schweiz - Peter Arengo-Jones - Страница 10
1837–1861 THRONBESTEIGUNG, EHE, MUTTERSCHAFT UND INTENSIVES FAMILIENLEBEN
ОглавлениеDas Jahr 1837 brachte einen der drei Wendepunkte im Leben Victorias. Im Juni, weniger als einen Monat nach ihrem 18. Geburtstag, starb König William IV., und von einer Minute zur nächsten wurde sie Königin von England.1
Sie war jedoch keineswegs entsetzt über die Aussicht, von nun an in schwierigen Zeiten über ein grosses Land zu herrschen. Vielmehr kam ihr natürlicher Überschwang zum Vorschein, und sie freute sich unverhohlen über ihre neu gewonnene Freiheit. Sie feierte das Ende ihrer Beinahe-Gefangenschaft im Kensington-Palast, indem sie unverzüglich aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter auszog, das sie mit dieser hatte teilen müssen, und sie begann sich auch auf andere Weise Geltung zu verschaffen.
Bei ihren ersten Schritten als Monarchin stand ihr glücklicherweise der damalige Premierminister Lord Melbourne als politischer Führer zur Seite, der schon bald einer von mehreren Ratgebern wurde, nach denen sie sich ihr Leben lang sehnen sollte.
1839 kam der zweite Wendepunkt in Form der sorgfältig vorbereiteten Ankunft eines Freiers. Sie hatte gewisse Bedenken gehabt, wen man für sie auswählen würde, und war entschlossen, einen ihr nicht genehmen Bewerber abzuweisen, auch wenn sie diesen nur einmal kurz gesehen hätte. Doch diesmal: ein Blick und sie war hingerissen – er war es! «Er war schön!», wie sie ihrem Tagebuch am 22. Oktober dieses Jahres anvertraute. Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha war ein Vetter ersten Grades. Es war an der Königin, den Hochzeitsantrag zu stellen. Sie benötigte ganze fünf Tage Bedenkzeit. Und der Antrag wurde angenommen.
Die Hochzeit fand 1840 statt, und dann begann eine Lebensphase, in der sie ihrem geliebten Albert in rascher Folge neun Kinder gebar. Obwohl sie diese ebenfalls liebte, hätte sie auf die damit verbundenen Schwangerschaften gern verzichtet, fügte sich aber in ihr Los. Beide genossen das eheliche Glück, auch wenn ihre Verbindung mitunter stürmische Zeiten erlebte, da beide einen starken Willen und eigene Ideen hatten. Die Erstgeborene war Victoria (Vicky), gefolgt von Albert Edward (Prinz von Wales, genannt Bertie), Alice, Alfred (Affie), Helena, Louise, Arthur, Leopold, Beatrice (Baby).
Mit der grösser werdenden Familie ging das Bedürfnis nach mehr offenem Raum einher. Albert entwarf ihr neues Landhaus, die vom italienischen Stil beeinflusste Villa Osborne auf der Isle of Wight in Südengland, und sie richteten sie gemeinsam ein (Schloss Balmoral in Schottland kam erst später hinzu). Im Garten baute man zur Erinnerung an Prinz Alberts Schweizreise im Jahr 1837 ein Chalet nach Schweizer Vorbild. An einem typischen Abend in Osborne mochte Albert, mit einem Kind auf jedem Knie, an der Orgel gesessen und fromme Musik gespielt haben, während Victoria, eine der Töchter im Schoss, sich der Lektüre widmete.
Die Monarchie als ein zentrales, einigendes Element im Leben der Nation hatte während der Regentschaft der drei Vorgänger von Königin Victoria, der Könige George III., George IV. und William IV., erheblich an Ansehen und Autorität verloren. Laut Sidney Lee sassen nacheinander «ein Schwachkopf, ein Liederjan und ein Hanswurst auf dem Thron».2
Ein wesentlicher Faktor dafür, dass das Ansehen der Monarchie anschliessend wieder stieg und sich dieser positive Ruf auch festigte, war das untadelige Verhalten der Königin und des Prinzen und das von ihnen dargebotene Beispiel eines tugendsamen Familienlebens, mit dem sie der Nation als Vorbild dienten.
Als Staatsoberhaupt gehörte es zu den Aufgaben der Königin, den Premierminister und andere staatliche Amtsträger zu ernennen. Ausserdem war sie Supreme Governor, also das Oberhaupt der Church of England. Da Grossbritannien damals bereits eine konstitutionelle Monarchie war, kam der Königin eine Beraterrolle zu, sprich, sie regierte nicht direkt, sondern vermittels der Regierung. In der Praxis jedoch griff Königin Victoria dank ihrer starken Persönlichkeit oder ihres Drangs dennoch häufig in die Regierungsgeschäfte ein. Erst ab 1901, als ihr Sohn, der Prinz von Wales, ihr auf dem Thron nachfolgte, übte der Souverän keine unmittelbare Macht mehr aus.
Prinz Albert, Szene aus Shakespeares «Henry IV», Radierung, 1840, Woburn Abbey. Prinz Albert war hochgebildet, künstlerisch begabt und mit Shakespeares Werken bestens vertraut. Die Illustration zu einer Szene aus «Heinrich IV.» trägt autobiografische Züge, sie zeigt eine Zurechtweisung des jungen späteren Königs Heinrich V. durch einen Vertreter des Vaters, Heinrich IV. Wie dieser hegte Albert als Vater des zukünftigen britischen Thronfolgers grosse Hoffnungen für seinen (noch ungeborenen) Nachwuchs und wollte es Heinrich IV. als Erzieher gleichtun. Heinrich V. hatte anfangs wegen Ausschweifungen noch Anlass zur Sorge gegeben, war aber dann Shakespeare zufolge zu Englands «Model King» avanciert.
Was Queen Victorias politische Verpflichtungen betraf, so ging ihr mit dem Rücktritt Melbournes dessen Unterstützung verloren, und es dauerte einige Zeit, bis Prinz Albert sich genügend Ansehen verschafft hatte und man ihm mehr zugestand, als die Tinte der Unterschriften unter den Staatspapieren löschen zu dürfen. Als Deutscher wurde er lange mit ziemlichem Argwohn betrachtet und erst als vollwertiges Mitglied der Königsfamilie akzeptiert, nachdem er seine staatsmännischen Eigenschaften als weiser und innovativer Berater unter Beweis gestellt hatte. Der Fortschritt und das Wohlergehen der Nation – eigentlich ganz Europas und der Welt – lagen ihm am Herzen. Als Prinzgemahl ergriff er im Namen der Königin zahlreiche Initiativen, um seine Wertvorstellungen zu verwirklichen. Zu seinen vielfältigen Talenten zählten das Komponieren, Zeichnen und Skizzieren, aber er entwickelte sich auch zu einem tatkräftigen Förderer der Künste, der Naturwissenschaft und der Industrie und regte viele Massnahmen der Königin an. Dabei machte er unter anderem einen Vorschlag, durch den ein heftiger Streit mit den Vereinigten Staaten entschärft wurde.
Während der bewegten 1840er-Jahre gelang es Grossbritannien, die politischen Stürme auf dem Kontinent zu überstehen. Nachdem das wichtige Reformgesetz (Reform Bill) 1832 mehr Demokratie gebracht hatte, machte die Aufhebung der Getreidezollgesetze 1846 den Import von billigerem Getreide für die Unterprivilegierten möglich. Die Landeigentümer verloren damit an Macht. Obwohl auf dem Kontinent die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Unruhen zunahmen und sich schliesslich 1848 in offenen Revolutionen entluden, trugen derartige britische Eingriffe, so bescheiden sie sein mochten, doch dazu bei, die Unzufriedenheit in Britannien einzudämmen und zu verhindern, dass die Revolutionswelle auf das Vereinigte Königreich überschwappte. Der Eckpfeiler der britischen Europapolitik war das Gleichgewicht der Mächte, das heisst, es gab keine direkte Beteiligung an inneren Auseinandersetzungen, sondern die aktive Unterstützung von Massnahmen, die der Aufrechterhaltung des Friedens auf dem Kontinent dienten, und der kontinuierliche Versuch zu vermeiden, dass die Macht irgendeines Landes überhandnahm. Die kleine und strategisch wichtig in der Mitte Europas gelegene Schweiz war für politischen Druck und entsprechende Pressionen anfällig. Ihre Unabhängigkeit und ihr neu gewonnener Status der Neutralität wurden Anfang des 19. Jahrhunderts von der britischen Regierung und auch später durch Queen Victorias beherztes Eingreifen energisch verteidigt.
1847 bereitete sich die Schweiz auf die Gründung des Bundesstaats mit einer eidgenössischen Verfassung vor und wurde wegen ihrer liberalen Tendenz von Europas Grossmächten bedroht. Am 25. November desselben Jahres schrieb König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen an die Königin und drängte sie, das Gewicht Grossbritanniens in die Waagschale zu werfen und sich den Bemühungen Preussens und anderer europäischer Mächte anzuschliessen, «die gottlosen und rechtlosen Liberalen» in der Schweiz einzudämmen, da es fatale Folgen für den Kontinent haben werde, falls diese weiterhin ihren Willen durchsetzen würden. Victorias Weigerung war diplomatisch formuliert, doch unmissverständlich, und die Drohung wurde zurückgenommen.
1856/57 hatte Victoria dann nochmals eine Gelegenheit, ihre Regierung persönlich zu unterstützen, indem sie dem preussischen König in einer weiteren Schweizer Angelegenheit entschieden widersprach. Das preussische Fürstentum Neuchâtel (Neuenburg) war ein Kanton der neuen Schweizerischen Eidgenossenschaft geworden, doch König Friedrich Wilhelm IV. weigerte sich, dies anzuerkennen, und klammerte sich aus sentimentalen Gründen weiter an sein Recht auf Neuenburg und seine «geliebten Untertanen» – obwohl diese ehemaligen Untertanen nun Bürger eines Schweizer Kantons waren und sogar einige Monarchisten inhaftiert hatten, die einen propreussischen Putschversuch unternommen hatten. Als der König deren Freilassung forderte und die Schweizer dies ablehnten, drohte er ihnen mit Krieg und bat um Unterstützung bei der Verteidigung seiner ihm durch Gottesgnadentum verliehenen Rechte als König «gegen diese Eidgenossenschaft von Emporkömmlingen». Er erklärte, er schreibe diesen Aufruf mit seinem «Herzensblut», und sandte ihn an mehrere gekrönte europäische Häupter, unter ihnen auch Königin Victoria. Diese versuchte, ihm seine Pläne auf diplomatischem Wege auszureden, indem sie ihm schrieb, selbst wenn die inhaftierten Monarchisten keine ganz makellose Weste hätten, befürchte sie die Folgen einer gewaltsamen Befreiung derselben: «Dies würde europäische Fragen von dem schwersten Belange implicieren.» Daraufhin wandte sich der König an Albert, der bald Prinzgemahl sein würde, und bat ihn, die Königin von der Notwendigkeit zu überzeugen, «dass die Grossmächte mit der Schweiz ein ernstes Wort von der Gattung, die kein nein zulässt, sprechen». Die Königin wiederholte, dass dies für ganz Europa gravierende Folgen hätte.
Doch Preussen mobilisierte seine Truppen und bereitete sich darauf vor, in die Schweiz einzumarschieren. Diese machte unter General Dufour ebenfalls mobil und rüstete sich, den Preussen zu den Klängen von Roulez tambours entgegenzutreten. Schliesslich aber, als die Queen der britischen Regierung daraufhin versicherte, sie billige ihre uneingeschränkte Unterstützung der Schweizer Position vollauf, gab der preussische König Neuenburg auf und soll danach, einem seiner Generäle zufolge, nie mehr gelächelt haben.
Das Leitmotiv des Zeitalters lautete Improvement (Verbesserung), und Prinz Alfreds Beitrag hierzu wurde immer bedeutender. Er war die treibende Kraft hinter dem wichtigsten Ereignis dieser Jahrhundertmitte, der Great Exhibition von 1851: Auf dieser Londoner Industrieausstellung und erster Weltausstellung wurden die erstaunlichen Fortschritte demonstriert, die Grossbritannien mit seinen mutigen, zukunftsweisenden wissenschaftlichen und architektonischen Neuerungen gemacht hatte. Jedermann konnte sehen, dass Grossbritannien inzwischen der «workshop of the world» war.
Die Fortschritte waren tatsächlich einschneidend. Zum Beispiel: Die landwirtschaftlich geprägte Welt des frühen 19. Jahrhunderts, in der sich noch Kutschen im behäbigen Tempo von 10 Meilen pro Stunde fortbewegten, wurde 1829 mit George Stephensons «Rocket», der Lokomotive, die es auf 28 Meilen pro Stunde (45 km/h) brachte, hinweggefegt. Dieses Fahrzeug war schneller als jedes andere Transportmittel zuvor in der Menschheitsgeschichte.
Doch der Fortschritt hatte seinen Preis – für die Menschen und für die Umwelt. Die Königin war schockiert von den Bedingungen, unter denen Menschen, selbst Kinder, in den berühmt-berüchtigten «finsteren satanischen Mühlen» schuften mussten, und die Landschaft wurde durch die, so Dickens, lilafarbenen Flüsse aus übelriechenden Färbemitteln massiv in Mitleidenschaft gezogen. London wuchs und wuchs und wurde zu dem, was John Ruskin die «grosse stinkende Stadt London» nannte, in der sich aufgrund der unzureichenden Abwasserbeseitigung Seuchen ausbreiteten. Doch der auf die Zukunft gerichtete Erfindungsgeist des Zeitalters zeigte sich der Herausforderung gewachsen. Ab der Jahrhundertmitte wurden in der rasch wachsenden Stadt auf einer Strecke von über 100 Kilometern Kanalisationsröhren verlegt (die bis heute teilweise noch in Betrieb sind).
Der Krimkrieg Mitte der 1850er-Jahre brachte die mitfühlende Seite der Queen zum Vorschein, denn sie unterstützte Florence Nightingale und ihre Bemühungen, das Leiden der im Krieg Verwundeten zu lindern. Die Königin schrieb ihr: «Wie sehr ich Ihren Einsatz bewundere, der völlig demjenigen meiner lieben und tapferen Soldaten entspricht, deren Leiden zu lindern Sie auf derart barmherzige Weise das Privileg hatten.» Spürt man hier einen Hauch von Protofeminismus? Auch bei vielen anderen Gelegenheiten, in denen sie sich für die Unterprivilegierten, ob Mensch oder Tier einsetzte, stellte die Königin ihr Mitleid unter Beweis. Sie brachte ihre Ablehnung von Tierversuchen unmissverständlich zum Ausdruck und war besonders beunruhigt davon, dass man «Studenten ermutigte, mit stummen Geschöpfen zu experimentieren».