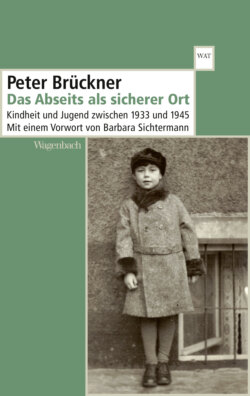Читать книгу Das Abseits als sicherer Ort - Peter Brückner - Страница 11
Freiheit und Realismus
ОглавлениеKindheit unter dem Faschismus: das umschloß auf der Seite der Gegner und Geschädigten die Chance vertrauensvoller Beziehungen auch von Vater und Sohn. Es war ein Vertrauen in den Wirklichkeitssinn des anderen, das freilich Zeit brauchte, sich zu entwickeln.
Da ich nun einmal seit 1935 bei Jugendamt und Polizei als verwahrlosungsgefährdet registriert war, mußte mein Vater Vertrauen in meinen Realismus setzen, also auf ausreichende Vorsicht und Geschicklichkeit, neue Zusammenstöße dieser Art in Dresden zu umgehen. Ein »Zusammenstoß« wäre es schon gewesen, wenn die Polizeiwache in der Nähe der elterlichen Wohnung oder ein unfreundlicher Nachbar bemerkt hätten, daß da ein Fünfzehnjähriger sich allein in der Großstadt aufhielt, ergo: sich »herumtrieb«, auch noch nachts. Die kontrollierende Einrichtung, die Jugendlichen einen solchen Realismus erspart, das Netz der Familie, bestand in meinem Falle nicht mehr. Umgekehrt mußte ich darauf vertrauen, daß mein Vater realistisch genug war, um einzusehen, daß eine disziplinierende Haltung von seiner Seite (oder gar ein Verbot) nur ein leerer Gestus sein konnte: die objektiven Bedingungen dafür fehlten uns. Er mußte zu seinem Job zurück, in ein kleines Zimmer, und etwas Geld hätte er mir auf jeden Fall geben müssen, und sei es für die Rückreise ins Internat.
Unsere Zuneigung füreinander wäre ohne diesen aufgeklärten Realismus nur ein Klebemittel für Risse in den gegenseitigen Beziehungen gewesen. Wenn ich ihn besuchte, nahm er mich mit ins Café, dort redeten wir oder lasen Zeitungen, mit Kommentar (in späteren Jahren das Reich oder das Schwarze Corps – als unsere kleine kritische »Hochschule für Politik«12). Abends machten wir uns das Essen selbst zurecht, oder, falls die Wirte keine Küchenbenutzung gestatteten, aßen wir im Zimmer meines Vaters Brot, Käse und Wurst.
Ein Problem hatte er mit mir, das ihn bedrückte: Ich schrieb ihm kaum. Doch ich lebte in meiner Gegenwart nach einem Drehtürprinzip: War ich mit meinem Vater zusammen, so existierte das Internat für mich nicht, dort aber war er mir ganz fern. Ähnliches galt für meine Mutter. Obwohl sie einmal anrief (1937) und mir zwei- oder dreimal eine Pfundnote und ein Päckchen schickte, habe ich ihr – bis zum Jahr 1947 – nur ein einziges Mal, und widerwillig, geschrieben. Nach der Anschrift Franks habe ich mich nicht einmal erkundigt. Natürlich hatte ich beide nicht »vergessen«, am wenigsten die Trauer über unsere Trennungen; das alte Leben aber war vernichtet. Es gab nur Gegenwärtigkeit und in ihr die ersten eigenen Traditionen. In denen kamen Mutter und Brüder nicht vor, kaum der erreichbare Vater.
Es gab zwischen ihm und mir übrigens auch sentimentale Phasen: Eines Tages schenkte er mir Hauptmann Sorrell und sein Sohn von Warwick Deeping, ein Buch, das damals mehrere deutsche Leser zu Tränen gerührt hat. Es war einigermaßen verbreitet, und das wirft ein Licht auf die Paradoxie unserer damaligen Situation. Ein Verhältnis wie das unsere: mit Vertrauen zwischen Vater und Sohn, mit »Kameradschaft«, wie man damals solidarische Beziehungen mißverstand, mit einigen sentimentalen und moralischen Akzenten, mißfiel dem Nationalsozialismus ja nicht nur. Er hat das Grauen und das Idyll immer in einem Schritt produziert. Nun trennte uns von der Vater-Sohn-Ideologie des NS-Staats vieles; wie ja auch seine Wirklichkeit vom ideologischen Versatzstück abwich. Nur in der Ideologie trug er der Bewunderung des Mittelstands für den Offizier und Soldaten Rechnung, der, wie Hauptmann Sorrell, im privaten Leben »tapfer durchhält«.
Realismus und Freiheit, die ich da – außerhalb von Schule und Internat – genoß, waren die Folge der vom Nationalsozialismus produzierten Zerstörung unserer Familie: 1937 nicht anders als drei Jahre vorher. Eine Auflösung der Familie bloß durch Scheidung oder Tod eines Elternteils vor dem Faschismus hätte diese Konsequenz wahrscheinlich nicht gehabt. So gewiß es auch ist, daß der NS-Staat diese Konsequenz nicht gewollt hat – Realismus und Freiheit, so fanden wir sie doch nicht nur gegen ihn. Denn die Freisetzung der Heranwachsenden von »sozialen Gewohnheiten« der frühen Kindheit, die Zerstörung auch des Mikrokosmos der bürgerlichen Familie, die hat er gewollt, weil er Kinder wie Erwachsene unmittelbar der Partei, der Ideologie, den Normen des Staats subsumieren wollte. (Das erste ließ sich für uns nutzen, das zweite konnten wir vermeiden.) Natürlich sollte die deutsche Kleinfamilie andererseits auch gefestigt werden, als staatlich unerläßliche Form der »Parzelle« und als indirekt kontrollierter Ort der Reproduktion; das war schon objektiv bei uns nicht mehr möglich.
In der Zerstörung des Mikrokosmos der bürgerlichen Familie war der Nationalsozialismus Agent einer ihn weit übergreifenden Tendenz, die letztlich aus dem Produktionsverhältnis und dem Verfall der bürgerlichen Herrschaft entspringt. Mein Vater und ich fanden in den Jahren nach 1933 wohl nur darum eine »alternative« Form für unsere Beziehung, weil sie in Vertrauen, Sentiment und Unbürgerlichkeit nahe genug an den ideologischen Versatzstücken des NS-Staats blieb, um unter den damaligen sozialen Bedingungen möglich zu sein – gegen die Intentionen des NS-Staats. Unsere Mitwelt konnte uns mißverstehen, aber das ließ uns unentdeckt.
Was mich Ende des Jahres in Dresden beflügelte, war also eine historische Tendenz. Das Glück hatte seinen geschichtlichen Atem; wahrscheinlich war es deshalb so groß. Ich wußte nichts davon – vielleicht war es deshalb so kurz, so rasch wieder zu verschütten, jedenfalls auf der »Oberfläche« kommender Erfahrung.