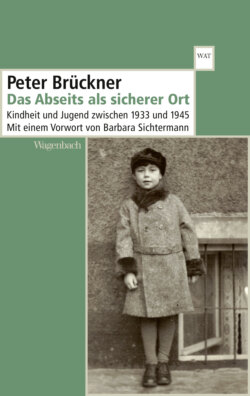Читать книгу Das Abseits als sicherer Ort - Peter Brückner - Страница 5
1922–1932
ОглавлениеIch wurde im Mai 1922 geboren; die ersten 16 Monate lebte ich in Wohnungen, die nicht die meines Vaters waren, und zeitweise – im Hotel.
1924: Märzschnee in einem Villengarten, das Dienstmädchen, das mich auf die Mauer zur Straße setzt und mir die Tabakspfeife meines Vaters überläßt; Freunde, die ein offenes Auto haben, ein Daimler-Cabriolet, ich war gut zwei Jahre alt. Wir wohnen im ersten Stock. 1930, im zweiten Schuljahr, ist die Adresse schlechter, der Wohnraum beschränkt, aber noch Beletage. Aus dem Speisezimmer blicken wir auf eine weiße Privatklinik mit dünnem Park. Ab und an, wenn meine Eltern abwesend sind, sieht die Frau des Hausmeisters nach mir. Ostern 1932 gehe ich zur Höheren Schule, Realgymnasium Seevorstadt; mein (Halb-)Bruder Armin, zwei Jahre älter, besucht noch das vornehmere Vitzthum’sche Gymnasium. Wir wohnen inzwischen im Erdgeschoß; gegenüber: ein großes Bierlager, eine Dienststelle des städtischen Wohlfahrtsamts und ein Polizeirevier.
Das Herrenzimmer, das es als dritten Raum noch gibt, wird bald an einen Handlungsreisenden vermietet.1
Im Mai 1932 war ich für wenige Tage Nationalsozialist. Jedenfalls kam ich eines Mittags nach Hause, mein Vater war viel zu Hause, weil arbeitslos, und berichtete stürmisch, »Wir« (das heißt die Sexta) seien jetzt alle Hitlerjungen. Ich wurde unterbrochen: die ganze Klasse? Das brachte mich kurz: zum Erröten, denn ich wollte antworten: Nein, nur die besten (Schüler), aber da ich einer der schlechtesten war im Herbst 1932 der 44. unter 46 Jungen, hätte ich gestehen müssen, daß die neue Bewegung an mir vorbeiging. (Nur zu Hause war ich Nazi.) So redete ich lieber weiter in meiner Begeisterung: Sobald »wir« die Macht ergriffen haben, gibt es für uns Geld und Essen genug. Ihr habt dann ausgesorgt. Aber nur ihr. Die Lehrer gerade nicht – in der Schule werden sie ganz blaß, wenn wir von Hitler reden.
Die Phantasie des Zehnjährigen, der von Hitler nur auf der Straße und in der Schulpause gehört hat, spiegelt gewisse Momente des Nationalsozialismus getreu: den räuberischen Charakter (Geld für uns, nicht: Klassenmacht), die Gaunergemeinschaft (»wir«), das antiautoritäre, rebellische Element (die Lehrer, das heißt für ein Kind: zentrale Inhaber von institutioneller Gewalt, ängstigen sich), die Attraktivität der »Bewegung« für Heranwachsende, und zwar für die Besten, das hieß für mich damals: die Schüler mit großem Sozialprestige. Und der Marginalisierte, der ich damals ansatzweise war, schluckt die Kränkung, die darin liegt, daß man ihn ausschloß, und identifiziert sich mit der »Macht«.
Meine Eltern, gebildeter Mittelstand am Rande der Verarmung, verhielten sich untypisch. Ich habe das bedrückte Schweigen nicht wieder vergessen, das meiner Eröffnung folgte, nicht den Anblick meines Vaters, der mich an sich zog, ein zärtlicher Mann; und diese Geste fürsorglicher Wärme war eine Antwort. Ich »wußte« von diesem Augenblick an, was Hitler, was der NS-Staat bedeutete.
Freilich: So wie Kinder Unausgesprochenes wissen; nicht als Kenntnis, die jederzeit reproduzierbar ist, und das »nie wieder vergessen …« schloß auch die Möglichkeit ein, über lange Zeiten hinweg gar nicht daran zu denken.