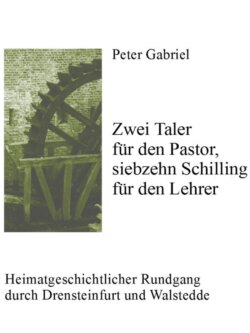Читать книгу Zwei Taler für den Pastor, siebzehn Schilling für den Lehrer - Peter Gabriel - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Elektrisches Licht für das Postamt Drensteinfurt
ОглавлениеAm 19. August 1913 benachrichtigte Postassistent Helm, stellvertretender Vorsteher des Postamts Drensteinfurt, die Oberpostdirektion Münster, dass Anfang November in Drensteinfurt eine Niederspannungsanlage den Betrieb aufnehme. Öffentliche Plätze, Kirche, Krankenhaus, fast alle Geschäfte und Privathäuser sollten elektrisches Licht erhalten. Helm stellte die Frage, ob es nicht zweckmäßig sei, auch die Post an das öffentliche Netz anzuschließen. Nach Auskunft des Elektrizitätswerks Westfalen kostete die Kilowattstunde 35 Pfennig, die Zählergebühr 6 Reichsmark, Benötigt wurden zehn Lampen für Schalterhalle, Abfertigungs- und Stempelraum, Vorsteherzimmer, Packkammer, öffentliche Fernsprechstelle, Flur und Eingang. Elektrische Beleuchtung war auch vorgesehen in der Dienstwohnung des Vorstehers. Sie bestand aus fünf Wohn- und Schlafräumen, Küche und Speisekammer. Kein Licht erhielten der Unterstand für den Paketwagen und die einzige Toilette des Hauses unten im Flur.
Helm fügte seinem Schreiben einen „Beleuchtungsplan“ für das I. und II. Geschoss bei. Die Installation der Leitungen war mit 180, bzw. 108 RM veranschlagt und ging zu Lasten des Eigentümers Dr. Kimmel: Für die Lampen hatte die Post selbst zu sorgen; eine Deckenlampe kostete 1,80 RM, die Tischlampe im Vorsteherzimmer 6,15 RM. Elektrisches Licht war im Unterhalt etwas teurer als die bisher verwendete Petroleumlampe. Die Jahresmiete für das Postgebäude erhöhte sich um 19 Mark.
Die Oberpostdirektion erklärte sich grundsätzlich einverstanden. Da ihre Mittel aber „fast erschöpft“ waren, schlug sie vor, die Lampen entweder später anzuschaffen oder das Geld vom Hausbesitzer, bei 6 bis 6,5 % Verzinsung, vorstrecken zu lassen. Das letztere geschah, und so brannten zu Beginn des Jahres 1914 die ersten elektrischen Glühbirnen im Kaiserlichen Postamt Drensteinfurt.
Nach mehreren Umzügen besaß die Post seit 1895 ein festes Domizil in der Bahnhofstraße Nr. 1. Dort hatte Postverwalter Halberstadt, im spitzen Winkel zwischen Bahnhof- und Kirchhofstraße (später Rietherstraße), ein 550 m² großes Grundstück für 3500 RM erworben und mit Genehmigung des Reichspostamtes in Berlin ein zweistöckiges Haus gebaut. Fast 49 Jahre lang, vom 1. Oktober 1895 bis zum 23. März 1944, war hier die Drensteinfurter Post untergebracht. Die jährliche Miete für die Diensträume im Erdgeschoss betrug zunächst 800 RM, für die Vorsteherwohnung 300 RM.
Überall im deutschen Kaiserreich entstanden damals große, repräsentative Postgebäude, die dem Staatssekretär und früheren Generalpostmeister Heinrich von Stephan heftige Kritik wegen Verschwendungssucht einbrachten. Auch das Postamt in Drensteinfurt hatte stattliche Ausmaße, obwohl es sich nur um ein sogenanntes „Mietpostamt“ handelte. Der Unterschied zur bescheidenen Königlich-Preußischen Postexpedition war augenfällig. Halberstadts Vorgänger hatten der Post noch Einzelräume in ihren Wohnhäusern zur Verfügung gestellt. Als Bernhard Trentmann im Jahre 1885 „wegen mangelnder Amtsführung“ entlassen wurde, musste sich die Post ein neues Quartier suchen. Um in Zukunft vor solchen Überraschungen sicher zu sein, war das Haus an der Bahnhofstraße, einschließlich Dienstwohnung, für zehn Jahre angemietet worden. Übrigens wurde Trentmann 1897 wieder in Gnaden aufgenommen; so schlecht kann seine Amtsführung also nicht gewesen sein. Im selben Jahr verließ Halberstadt Drensteinfurt, nachdem er das Haus an den Bauunternehmer Mertens aus Ascheberg verkauft hatte. Von diesem erwarb es 1908 der praktische Arzt Dr. Kimmel; er baute 1910 einen Trakt mit Praxis und Wohnung an.
Das Kaiserliche Postamt III. Klasse in Drensteinfurt wurde von einem Postverwalter geleitet. Zum Personal gehörten vor der Jahrhundertwende je zwei Unterbeamte und Landbriefträger. Die einen versorgten das Stadtgebiet, die anderen Walstedde und die Bauerschaften. Unvorstellbar aus heutiger Sicht waren die Arbeitsbedingungen. Bei einer Revision im Jahre 1895 trug Halberstadt vor, dass die Unterbeamten stark überlastet seien. Er beantragte eine Erhöhung der Vergütung, aus der ihre Gehälter gezahlt wurden. Hövelmann und Kleinelanghorst hatten werktags von 6 bis 19.30 Uhr bzw. 20.15 Uhr Dienst. Ihre Mittagspause dauerte eineinhalb bis zwei Stunden. Den Sonntagsdienst versahen sie abwechselnd mit den Landbriefträgern. Viermal täglich erfolgte in Drensteinfurt die Postzustellung, hinzu kamen zehn Paketbeförderungen zwischen Postamt und Bahnhof mit dem Handwagen.
Die Oberpostdirektion sah in der elf- bis zwölfstündigen Arbeitszeit der Unterbeamten keine übermäßige Belastung. Sie hielt es auch nicht für notwendig, eine zusätzliche Kraft einzustellen. Halberstadts Vergütung wurde aber von 1270 RM auf 1390 RM jährlich angehoben, so dass Hövelmann und Kleinelanghorst jetzt 690 bzw. 700 Mark erhielten. Beide waren verheiratet; es fiel ihnen schwer, ihr Auskommen zu finden, da sie keine Zeit hatten, sich neben dem Postdienst mit „ländlichen oder anderen Arbeiten“ zu beschäftigen.
Nicht besser gestellt waren die Landbriefträger. Als Oberinspektor Kannegießer aus Münster 1906 in Drensteinfurt weilte, beklagten sich Knöpke, Lenz und Rövekamp, dass ihr tägliche „Marschleistung“ weit über das gewöhnliche Maß hinausgehe. Postvorsteher Trentmann unternehme nichts, um Abhilfe zu schaffen. Trentmann entschuldigte sich, er habe noch keine Zeit gehabt, die Angaben der Landbriefträger zu überprüfen. Er scheue sich auch, solche Kontrollen durchzuführen. Man möge einen Aufsichtsbeamten mit der unangenehmen Arbeit beauftragen.
Trentmanns Bitte wurde abgelehnt. Innerhalb der nächsten vier Wochen hatte er die Strecke abzugehen und zu berichten. Nachdem dies geschehen war, legte Kannegießer der Oberpostdirektion eine ausführliche Stellungnahme vor. Mit 25 bis 30,6 km täglich überschritten die Fußmärsche der Drensteinfurter Landbriefträger tatsächlich das zulässige Höchstmaß. Im Winter war der morastige Boden von Viehweiden, Wiesen und Brachland kaum passierbar. Die regelmäßig auftretenden Überschwemmungen zwangen zu großen Umwegen. Der Einsatz von Fahrrädern brachte keine spürbare Erleichterung, da es nur wenige befestigte Straßen gab. Eine Hilfskraft war also unbedingt erforderlich; es musste auch ein viertes Zustellrevier gebildet werden.
Kannegießers Stellungnahme bewirkte, dass ab 1. September 1906 ein neuer Dienstplan in Kraft trat. An den Werktagen hatten die Unterbeamten morgens von 7 bis 13 Uhr und nachmittags von 16.30 bis 19 Uhr Post auszutragen. Im Innendienst waren sie montags und donnerstags jeweils mit zwei Stunden eingesetzt. Den siebenstündigen Nachtdienst leisteten sie einmal wöchentlich. Das ergab – zusammen mit den zweieinhalb Stunden anteiligem Sonntagsdienst – eine Wochenarbeitszeit von 64 ½ Stunden. Die Landbriefträger waren von 7.30 Uhr bis 16 Uhr unterwegs und kamen mit ihren übrigen Verpflichtungen auf 60 ½ Stunden pro Woche.
Nachfolger Bernhard Trentmanns, der 1913 verstarb, wurde Arnold Huppertz aus Gescher. 1914 zur „Fahne“ einberufen übte er das Amt des Vorstehers erst wieder nach dem Krieg aus. Am 3. September 1922 teilte er seiner vorgesetzten Behörde mit, dass er ein Haus gebaut habe und die Dienstwohnung, zu der weder Garten noch Stall gehörten, nicht mehr brauche. Wenn ein Beamter in dieser Zeit überstehen wolle, müsse er einen Garten bewirtschaften und Tiere – Schweine oder Ziegen – halten. Drensteinfurt sei von Hamsterern überlaufen, die Lebensmittelpreise im Ort lägen weit über denen in Hamm und Münster. Er habe aber auch aus sozialen Gründen gebaut. Als Gemeindevorsteher und Vorsitzender der örtlichen Wohnungskommission kenne er das örtliche Wohnungselend. Drensteinfurt liege in der Tuberkulosen-Statistik des Kreises Lüdinghausen an erster Stelle, schuld daran seien die ungesunden Wohnverhältnisse. Oberpostschaffner Köpke könne die Dienstwohnung übernehmen; er sei verheiratet und habe zwei Kinder. Seine derzeitige Wohnung müsse er räumen, da der Hauswirt ihm gekündigt habe.
Das Reichspostministerium missbilligte dieses „eigenmächtige Verhalten“ und bestand darauf, dass Huppertz aus Gründen der Betriebssicherheit im Postgebäude wohnen blieb. Da er aber vollendete Tatsachen geschaffen hatte, sein Haus war fast fertig und sollte zum 1. Oktober bezogen werden, erhielt Knöpke die Wohnung. Im Juni des Inflationsjahres 1923 stieg die monatliche Miete auf 175 718 Mark; das Geld wurde damals in Wäschekörben transportiert.
Einschließlich der Sonntagsbestellung arbeiteten die Landbriefträger jetzt nur noch 48 ½ Stunden pro Woche. Die Oberpostdirektion empfahl zum wiederholten Male, Räder anzuschaffen. Huppertz antwortete: „Gegenwärtig wird in keinem Revier bei Ausübung der Bestellung ein Fahrrad benutzt. Bei den hohen Fahrradpreisen ist kein Beamter in der Lage, sich ein Fahrrad zu kaufen.“
Am 23. März 1944 richtete ein Bombenangriff in Drensteinfurt schwere Verwüstungen an. Das Postamt wurde zerstört; die Postfacharbeiterin Maria Wältermann konnte nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Zehn Jahre lang war die Post provisorisch in der alten Schule am Kirchplatz untergebracht. 1954 bezog sie gegenüber dem ehemaligen Mietpostgebäude an der Bahnhofstraße dann endlich ein eigenes Haus.