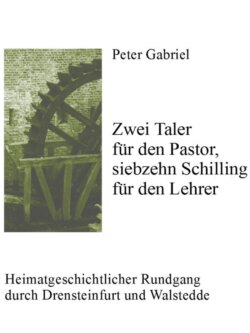Читать книгу Zwei Taler für den Pastor, siebzehn Schilling für den Lehrer - Peter Gabriel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die gemeinen Marken
ОглавлениеRund sechs Prozent des 2448 ha großen Gemeindegebiets von Walstedde bestanden bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts aus gemeinsam bewirtschafteten Heide- und Waldflächen, den sogenannten Marken oder Gemeinheiten. Sie lieferten Humus (Plaggen) zur Bodenverbesserung, Bau- und Brennholz, dienten der Jagd und der Eichelmast, vor allem aber nutzte man sie als Weiden für Rinder, Pferde, Schafe und Schweine. Einen großen Teil des Jahres musste sich das Vieh sein Futter hier selbst suchen, Stallhaltung war damals nur in einem sehr begrenzten Umfang möglich. Infolgedessen war das Rind kurzgebaut und klein, jedoch anspruchslos und zäh. Das westfälische Schwein, berühmt für hohe Qualität von Fleisch und Schinken, brauchte in der Regel bis zu zwei Jahre, ehe es ein annehmbares Schlachtgewicht erreicht hatte.
Einige der Walstedder Marken hießen: Nordhölter Dreisch, alte Heide, Maykenfeld, Walstedder Feld, Hoflinde und Kurwiese. Die zuletzt genannte Mark lag beiderseits der heutigen Bundesstraße nach Drensteinfurt; Hoflinde schloss sich östlicherseits an. Das Walstedder Feld befand sich im südlichen Winkel der Straßen nach Hamm und Mersch. Um die Nutzung des Weidelandes regeln und kontrollieren zu können, hatte man Genossenschaften gegründet, denen alle Bauern angehören mussten, die ihr Vieh in eine bestimmte Mark trieben. Auch Bauern aus anderen Gemeinden konnten sich beteiligen. Ein Oberweideherr vertrat die Aufsicht, er ordnete an, wann und wo das Vieh geschüttet, d.h. zusammengetrieben und gezählt wurde.
Sorgfältig überprüfte man, wie viele Tiere der einzelne Bauer zu Beginn der Weidezeit auftrieb. Ebenso genau wurde gezählt, wenn die Weidezeit beendet war, und das Vieh in die Ställe zurückkehrte. Nur so viele Tiere durfte jeder weiden lassen, wie er den Winter über im eigenen Stall gehalten hatte. Schmuggelte jemand ein paar Rinder vom Nachbarn ein, oder vergaß er, dass Gänse nicht auf den Weiden geduldet wurden, gab es Ermahnungen und Strafen. Zumindest wurde das überzählige Vieh erst einmal festgehalten.
Zu den Weideberechtigten im Eikendorfer Feld, einer Drensteinfurter Mark, gehörten 15 Bauern, unter ihnen Pott aus Walstedde. 1705 hatte er zwei Kälber zu viel weiden lassen; von anderen Markgenossen waren verbotenerweise Ziegen oder zu viele Lämmer und Kühe aufgetrieben worden. Sogar das strenge Verbot der Gänsedrift hatte jemand nicht beachtet. Ziegen waren im Eikendorfer Feld nicht gestattet, weil sie den aufkeimenden Baumwuchs behinderten, Gänse hielt man des schädlichen Kots wegen fern. Den reuigen Sündern half die Ausrede, es habe so lange keine Viehzählung stattgefunden, Unkenntnis sei der Grund für die Missachtung der Weidegesetze gewesen. Die einbehaltenen Tiere wurden den Besitzern ohne Strafe zurückgegeben, nachdem sie Besserung gelobt hatten. Die Anzahl des Viehs, das der Bauer in die Mark schicken durfte, richtete sich nach den Steuern, die er zahlte. Pro Reichstaler durften beispielsweise im Eikendorfer Feld zwei Schafe aufgetrieben werden. Pott aus Walstedde bezahlte 1 ¼ Taler Steuern, also war er berechtigt drei Schafe weiden zu lassen.
Die Viehzählungen erfolgten unter den strengen Augen eines Notars, der darüber ein Protokoll verfasste. Als 1747 von einem Bauern viele Gänse in die Mark getrieben worden waren, musste er Schadenersatz leisten. Vier Gänse wurden ihm abgenommen, sie landeten in der Küche des Freiherrn von Bevernvörde aus Albersloh; ihm gehörte Kampmanns Hof, wo die Schüttungen stattfanden. Die Bekanntgabe der Strafen, wozu auch Geldbußen zählten, erfolgte auf den Versammlungen des Markengerichts. Alle Beteiligten hatten zu erscheinen, wenn sie ihr Weiderecht nicht verlieren wollten. Den Abschluss solcher „Gerichtsverhandlungen“ bildete meist ein feucht-fröhliches Gelage, bei dem die Strafgelder gemeinsam vertrunken wurden.
In den Jahren zwischen 1813 und 1832 wurden die Walstedder Marken aufgeteilt und an Interessenten verkauft. Eine Generalkommission stellte die Werte fest; sie richteten sich nach den jährlichen Abgaben, mit denen ein Stück Land belastet war. Zunächst galt ein 25-facher Betrag, später das 20- und 18-fache. Um die Finanzierung zu erleichtern, richtete man eine Rentenbank ein, mit ihrer Hilfe konnten die Verpflichtungen mit Laufzeiten bis zu 26 Jahren getilgt werden. Mit 23 Morgen und 30 Ruten gehörten Walstedder Mersch und Lütkengeist zu den kleineren Gemeinheiten. 8 ½ Teile davon erhielten Lückmann, 8 Teile Brünemann und Westermann, 5 Teile Heinrich Lienkamp und H. Panick, 3 Teile W. Gärtner, 2 ¾ Teile Ahlmann und 2 ½ Teile das Haus Steinfurt. Als Entschädigung für den Verlust des Markenrichteramtes mussten alle Interessenten dem Freiherrn von der Reck aus Heessen 100 Taler zahlen.