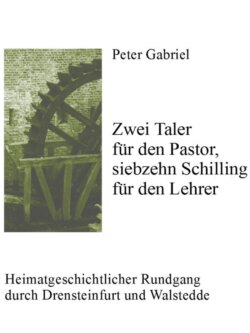Читать книгу Zwei Taler für den Pastor, siebzehn Schilling für den Lehrer - Peter Gabriel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das hochadelige Gut Steinfurt
ОглавлениеDas Staatsarchiv Münster besitzt nur wenige alte Karten von Drensteinfurt, eine davon ist der General Plan der Gebäude und Gärtens des Hochadligen Guths Steinfurt. Bei der 70 × 50 cm großen, kolorierten Federzeichnung handelt es sich um eine Kopie, die der Landmesser Johann Heinrich Berteling, ohne den Verfasser zu nennen, angefertigt hat. Da die Herstellung von Karten sehr aufwendig und teuer war, wurden Originale früher häufig kopiert oder als Vorlage benutzt.
Der Text unter der Scala lautet: „J.H. Berteling fec. pro Copia Cum originali Concordant. Joan Henri Berteling jurato geometra Episcopat. Monaster.“ Der damaligen Mode gehorchend verwendet Berteling die französische Schreibweise seines Vornamens. Er bestätigt die Übereinstimmung zwischen Original und Kopie und weist sich als vereidigter bischöflich-münsterischer Landmesser aus. Seine Tätigkeit ist durch mehrere signierte Karten in den Jahren von 1744 bis 1776 belegt. In der Literatur wird er als Mitarbeiter Johann Conrad Schlauns bezeichnet.
Nach Angaben des Staatsarchivs Münster ist der im Maßstab von etwa 1 : 12 000 gezeichnete Plan 1750 entstanden. Gestützt wird diese Datierung durch einen Hinweis des Vikars Edmund Wiesmann in der Stadtchronik, wonach Berteling zur genannten Zeit auch eine geometrische Karte von Drensteinfurt angefertigt haben soll. Die Kopie des General-Plans zeigt die von 1704 bis 1715 umgestaltete Schlossanlage, einschließlich der Gärten und näheren Umgebung. Rot sind die Gebäude, blau die Gewässer, grün die Gärten und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Rott Kampf, wohl ein gerodetes Waldstück, hebt sich durch eine graue Schraffierung ab.
In dieser Form hat Haus Steinfurt bis 1830 bestanden, dann wurde an der Nordseite ein neuer Zugang mit Brücke und zwei Pavillons geschaffen. Das 1585 erbaute Torhaus blieb erhalten. Buchstaben erleichtern das Zurechtfinden auf der Karte. Das Hauptgebäude, Corps de logis (A, B, C), umschließt mit seinen kurzen Seitenflügeln, den Gärten (R, Q) und einem von Pfeilern gerahmten Gitter den Ehrenhof, Cour d' honneur. An der Rückseite des Schlosses befindet sich ein weiterer Garten (P). Von der ehemaligen Gräfte, die Ober- und Unterburg voneinander getrennt hatte, existiert nur noch der ausgemauerte Hausgraben. Der westliche Flügel des Wirtschaftshofes (H) vereint unter einem Dach: Torhaus, Rentmeisterei und Kutschenstall. Gegenüber im Ostflügel (E) sind Brauhaus, Bierkeller, Schlüterei (Schliesserei) und Ackerstall untergebracht. Die Nordseite wird vom Bau- oder Viehhaus (F) eingenommen. Über einen Steg gelangt man zur ersten der zwei Wäscheinseln (aa, bb).
Die im 16. Jahrhundert entstandenen Gebäude des Wirtschaftshofes sind, wie das Brauhaus, teilweise erneuert, oder wie der Westflügel 1704, um den Kutschenstall, erweitert worden. 1706 wurde das alte Wohnhaus abgerissen, 1709 war der Neubau fertig. Nachzutragen ist, dass Johann Matthias von der Reck das Schloss für seine zweite Frau, die junge Adolphine von Metternich zur Gracht, errichten ließ; Architekt war Lambert Friedrich von Corfey, der 1726 auch die nahegelegene Loreto-Kapelle gebaut hat.
Zwischen Tor- und Bauhaus hindurch öffnet sich der Blick auf den jenseits der Wäschebleichen gelegenen Garten (T). Gelenkartig stellt ein dreieckiger Teich die Verbindung zu dem großen, französischen Garten (U) her, dessen abknickende Achse zweifellos durch das Gelände bedingt ist. Das Wersebett ließ sich nicht so einfach umlegen, eine derartige Maßnahme hätte auch den zum Schloss gehörenden Amtshof (FF, N, X usw.) stark in Mitleidenschaft gezogen. Es folgen der Kraut- oder Gemüsegarten (S) und ein Türmchen an der Nordostecke. Ursprünglich ein Teil der Verteidigungsanlage, diente es später zur Unterbringung der Gartengeräte. Ebenso wie die 1715 fertiggestellte Orangerie (D), ein Gewächshaus, das empfindlichen Pflanzen im Winter Schutz bot, ist das Türmchen im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört und nicht wieder aufgebaut worden.
Auf dem „äußeren oder Vorplatz“ befinden sich laut Stadtchronik: Jägerhaus und Hundestall (K, L); Esel- und Schweinestall, Kackshaus, Wagenremise (I, M) und Misthaufen. Der Vollständigkeit halber sei noch auf die beiden Mühlen für Korn und Öl (ohne Buchstaben) am Mühlenkolk hingewiesen. Mit Hilfe des Wehrs ließ sich der Wasserstand in der Gräfte regulieren.
Auch ohne nähere Erläuterungen vermittelt diese kurze Aufzählung der Gebäude und Anlagen schon eine Vorstellung von der Lebenshaltung des münsterischen Landadels zu jener Zeit. „Selbstbewusstsein und Machtgefühl einer wohlgeordneten Grundherrschaft“ spiegeln sich, nach Theodor Mummenhoff, im Schloss und seiner Umgebung wieder. Unverkennbar ist der französische Einfluss auf die Gesamtanlage mit ihrer repräsentativen Architektur und den geometrisch-axialen Gärten, die man sich ohne Sichtbehinderung durch hohe Bäume oder Baumgruppen vorstellen muss. Traditionelle Bindungen verrät das Festhalten an Teilen der alten Wasserburg: Gräfte, Torhaus usw.
Die Frage nach dem Verfasser des General-Plans lässt sich erst dann beantworten, wenn das Original auftauchen sollte. In Betracht kämen Lambert Friedrich von Corfey und dessen Schüler Johann Conrad Schlaun. Die Tätigkeit des letzteren in Drensteinfurt bezeugt Wiesmann auf einer Flurkarte der Bauerschaft Büren: „Adelich freye Grundstücke des Hauses Steinfurt. Copiert nach Schlauns Karte de 1717.“ Anzunehmen ist, dass der Vikar auch Arbeiten von Berteling in der Stadtchronik verwertet hat.
Lageplan von Haus Steinfurt