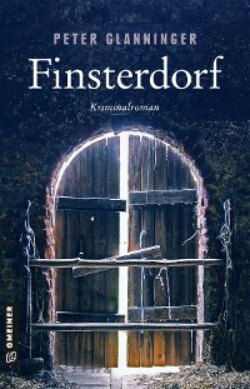Читать книгу Finsterdorf - Peter Glanninger - Страница 20
16.
ОглавлениеDa sie momentan keine andere Idee hatten, wie sie weitermachen sollten, beschlossen Steiger und Radek, das Mittagessen vorzuziehen. Radek schlug vor, ins Gasthaus »Falk« zu gehen.
Als sie ins Lokal kamen, stand Falk hinter der Schank, blickte ihnen misstrauisch entgegen und erwiderte ihren Gruß mürrisch. Sie suchten sich einen Tisch im hinteren Bereich der Gaststube, Falk brachte die Speisekarten und nahm die Getränkebestellung auf. Der fragende Blick, den er zunächst Radek und dann seiner uniformierten Begleiterin zuwarf, war nicht zu übersehen.
Sie studierten das Essensangebot und überlegten gerade laut, ob sie sich für das Mittagsmenü oder die Karte entscheiden sollten, als der Wirt die Getränke brachte.
Nachdem Falk die Gläser auf den Tisch gestellt hatte, konnte er sich nicht mehr zurückhalten. »Sind Sie Polizist?«, fragte er Radek scharf und unvermittelt.
»Ja.«
»Warum haben Sie nicht schon am Wochenende gesagt, dass Sie bei der Polizei sind?« Falks Haltung wurde mit einem Schlag feindselig.
Radek hatte keine Ahnung, warum es beim Wirt zu dieser Ablehnung kam und wie er darauf reagieren sollte. »Hätte das etwas geändert?«, stellte er eine vorsichtige Gegenfrage.
»Na klar.«
»Hätte ich dann kein Zimmer bekommen?«
»Nein, das nicht.«
»Was dann?« Radek spürte eine wachsende Gereiztheit in sich aufsteigen.
»Wir hätten uns von Ihnen nicht bespitzeln lassen!« Falk wurde zornig.
»Wie kommen Sie darauf, dass ich Sie bespitzeln wollte?«
»Warum nehmen Sie sich sonst übers ganze Wochenende ein Zimmer hier, obwohl Sie Polizist sind?«
Radek verstand den Sinn der Frage nicht, trotzdem antwortete er: »Weil ich aus Sankt Pölten bin und mich zwei Tage erholen wollte.« Er sah keinen Grund, den Wirt anzulügen.
Der musterte ihn argwöhnisch, als könnte er dadurch feststellen, ob sein Gast die Wahrheit sagte oder nicht. Dann entschied er sich für eine versöhnlichere Tonart. »Wir mögen eine solche Geheimnistuerei gar nicht«, erklärte er und damit schien für ihn die Sache erledigt zu sein. Er nahm ihre Bestellung entgegen und verzog sich in die Küche.
Während des Essens sprachen Radek und Steiger zunächst über belanglose Dinge. Steiger erzählte vom Polizeidienst in Gresten, von ihrem Mann und ihren Kindern.
Radek hatte keine Frau und keine Kinder, von denen er stolz berichten konnte. Er hatte nicht einmal einen Job, der ihm so viel Spaß machte, um darüber zu reden. Das Einzige, das ihm für ein zwangloses Plaudern brauchbar erschien, war sein geplantes Studium, aber selbst das kam ihm großkotzig vor. So schwätzte er über Sankt Pölten, dessen Sehenswürdigkeiten und verschiedene Lokale, die ihm besuchenswert erschienen. Unverbindlicher Small Talk eben. Wenn Radek sich mit Steiger verglich, ihrem geregelten Leben in ordentlichen Bahnen, fühlte er sich wie ein Außerirdischer, der hier in der Idylle der Provinz nichts verloren hatte.
Trotzdem kamen sie dann auf das LKA, klar, das interessierte Steiger mehr als die Organisation der Studieneingangsphase für Geschichte. Als er erklärte, was er dort machte, wurde sie hellhörig und fragte nach, weshalb das LKA ihn geschickt habe und nicht einen anderen Kriminalbeamten, einen, der schon zuvor in diesem Fall ermittelt hatte. Einen Moment lang glaubte Radek, sie hätte »einen versierten Kriminalbeamten« sagen wollen, aber vielleicht bildete er sich das nur ein. Jedenfalls hatte er keine Lust, ihr etwas zu verheimlichen, und sagte ganz offen, dass er glaubte, nur deshalb geschickt worden zu sein, weil niemand anderer diesen Fall übernehmen wollte. Steiger lachte und kommentierte es mit: »Der mit der geringsten Widerstandskraft kriegt immer die beschissensten Jobs.«
Nachdem Falk, der nun etwas zuvorkommender wirkte, die leeren Teller abgeräumt und den bestellten Kaffee serviert hatte, brachte Radek das Gespräch auf den Grund ihres Hierseins. »Was hältst du von dem Friseur? Der macht einen ziemlich durchgeknallten Eindruck.«
»Ja, ein unangenehmer Zeitgenosse«, antwortete Steiger.
»Ich dachte, solche Typen gibt’s nur in der Stadt.«
»Offensichtlich nicht.«
»Was weißt du über Schandau?« Radek wollte versuchen, sich ein genaueres Bild über das Dorf zu verschaffen.
»Im Grunde nicht viel. Ein ruhiges Nest, ich kann mich an keine bemerkenswerte Amtshandlung erinnern. Hier leben nicht viele Leute, 600, glaube ich. Also eine sehr überschaubare Gemeinschaft. Die Leute kennen sich und haben gelernt, miteinander auszukommen. Klar gibt es wahrscheinlich Rivalitäten und Neidgeschichten, aber die werden so ausgetragen wie auf dem Land eben üblich: Hinten herum wird böse getratscht und nach vorne wird gelächelt. Das kennst du ja.«
Radek dachte an seinen Wohnort Senftenberg im Waldviertel, eine 1.500-Seelen-Gemeinde, und nickte. Ja, das kannte er.
»Wenn du in Richtung Hollenstein weiterfährst, gibt es ein großes Sägewerk und einen Holzbaubetrieb, also eine Zimmerei und eine Tischlerei. Da habe ich vor ein paar Monaten einen Einbruch bearbeitet. Die Betriebe gehören Lenkstein. Das ist der Besitzer der Burg, ein verkappter Aristokrat mit einem Gehabe, als gebe es heute noch die Leibeigenschaft. Ich glaube, die Betriebe sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde, sonst gibt es in der Gegend nicht viele Arbeitsmöglichkeiten.«
»Aber die Infrastruktur ist gut.« Radek zeigte aus dem Fenster. »Mir scheint, dass es hier alles gibt, was man zum Leben braucht.«
Steiger blickte ihn skeptisch an. »Wenn man keine allzu großen Ansprüche stellt. Aber ja, die Nahversorgung scheint ganz gut zu funktionieren.«
Radek fiel noch etwas anderes ein. »Hat es mal mit dem Pfarrer Probleme gegeben?«
»Was meinst du damit?«
»Mir ist am Sonntag aufgefallen, dass kaum Leute in der Kirche waren. Das erscheint mir ungewöhnlich, und ich frage mich, ob der Pfarrer absichtlich gemieden wird, und wenn dem so wäre, warum?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Nein, ich hab noch nie etwas Negatives über den Pfarrer gehört. Der übliche Mitgliederschwund bei der Kirche wahrscheinlich.«
Möglicherweise, dachte Radek. Aber eigentlich glaubte er das nicht. Ja, die Jungen blieben aus, das war plausibel, doch dass auch die Alten nicht mehr in die Kirche gingen, erschien ihm zumindest wert, hinterfragt zu werden.
»Was machen wir jetzt?«, wollte Steiger unternehmungslustig wissen.
Radek dachte einen Moment lang nach. »Wir befragen den Wirt. Die Lindner war zuletzt hier, bevor sie verschwunden ist. Möglicherweise ist dem Falk etwas aufgefallen.«
»Das wollte ich auch schon machen«, gestand Steiger, »hab’s dann aber bleiben lassen, weil ich auf dich warten wollte.«
Sie winkten dem Wirt und verlangten die Rechnung. Nachdem er ihre Zeche kassiert hatte, sagte Radek: »Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.«
»Welche Fragen?« Der Wirt wurde wieder argwöhnisch.
»Zu Bernadette Lindner, sie war ja an dem Freitag, als sie verschwunden ist, hier bei Ihnen im Lokal.«
»Wer sagt das?«
»Das haben uns die Eltern erzählt«, erklärte Steiger. »Die haben noch am frühen Abend mit ihr telefoniert. Und da sagte Bernadette, sie sei hier im Gasthaus.«
Falk überlegte kurz, aber es machte auf Radek nicht den Eindruck, als müsse er sich erst den Abend in Erinnerung rufen, sondern als wäge er ab, was er den Polizisten erzählen durfte und was nicht.
»Ja, sie war hier und ist da drüben gesessen.« Er deutete auf einen der leeren Tische im hinteren Bereich der Gaststube.
»Alleine?«, fragte Radek nach.
»Nein, mit der Schächter.«
»Wer ist das?«
»Veronika Schächter, eine Freundin von der Lindner, aber ein paar Jahre älter.«
»Und die beiden waren die ganze Zeit über beisammen?«, wollte Radek wissen.
»Ja, bis Mitternacht ungefähr, dann ist die Lindner gegangen. Die Schächter ist noch ein bisschen geblieben, weil einer der Burschen an der Bar sie auf ein Glas Wein eingeladen hat. Die Lindner hat gesagt, dass sie morgen früh raus und arbeiten müsse, und ist abgehauen. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe.«
»Was, glauben Sie, ist passiert?« Steiger war daran interessiert, was die Gerüchteküche zu bieten hatte. Der Wirt hatte sich aus dem Querschnitt der Gästemeinungen sicherlich sein eigenes Bild gemacht.
Aber Falk reagierte ablehnend. »Woher soll ich das wissen? Die Kleine wird irgendwo hingefahren sein und dort die Sau rausgelassen haben. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht.«
»Wo können wir diese Schächter finden?«, mischte sich Radek wieder ein.
»Die arbeitet beim Lenkstein im Büro. Ich glaub, sie wohnt noch bei ihren Eltern in der Hinterau.«
»Hinterau ist eine Siedlung ein bisschen außerhalb, in Richtung Hollenstein«, erklärte Steiger dem ortsunkundigen Radek.
»War’s das? Mehr weiß ich sowieso nicht.«
Radek hatte nichts anderes erwartet. Für den Wirt jedenfalls schien die Sache erledigt zu sein, denn ohne auf eine Antwort der Polizisten zu warten, drehte er sich um und ging zurück hinter die Theke.
»Und jetzt?«, fragte Steiger.
»Jetzt fahren wir zu Lenkstein und schauen uns diese Schächter an.«
Als die beiden Polizisten gegangen waren, schnappte sich Falk sein Handy und ging durch die Hintertür in den Hof hinaus. Vorsichtig blickte er sich um, ob ihn jemand beobachtete. Als er sicher war, allein zu sein, drückte er eine Kurzwahltaste und wartete, bis am anderen Ende abgehoben wurde.
Er knallte sein Telefon voller Zorn über den langen Tisch, der in der Mitte des Saales stand und für gesellschaftliche Zusammenkünfte diente. Wäre Christian Steininger nicht rechtzeitig herbeigeeilt, um die rasante Fahrt des Geräts zu beenden, wäre das dünne Smartphone über die Tischkante hinweggeschossen und auf dem Steinboden zerschellt.
Steininger kannte seinen Arbeitgeber und dessen jähzorniges Wesen allzu gut. Dafür wurde er bezahlt, hervorragend bezahlt. Er hatte an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, seinen Bachelor in Betriebswirtschaft und einen Master in Management gemacht. Danach hatte er einige Zeit in der Zentrale von Möbel Haindl in Linz gearbeitet. Dort war er für das Wareneingangs- und Produktionsmanagement verantwortlich gewesen. Bei einer seiner Verhandlungen mit einer Zulieferfirma war er an Leopold Lenkstein geraten, der ihn nach drei Verhandlungsrunden abgeworben und seinen eigenen Key-Account-Manager in die Wüste geschickt hatte. Es komme ihn billiger, Steininger zu kaufen, als ihn weiterhin auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen zu haben, hatte Lenkstein seine Personalmaßnahme begründet. Das Gehalt, das er Steininger anbot, hatte jeden Zweifel über einen Jobwechsel zerstreut. Innerhalb eines halben Jahres war Steininger in Lenksteins Betrieb zum Verkaufsleiter aufgestiegen, und ein Jahr später hatte Lenkstein ihn zum persönlichen Counsellor gemacht. Seit vier Jahren war er nun bei Lenkstein und bereute keinen einzigen Tag davon. Er hatte nicht nur ein überdurchschnittlich hohes Gehalt, sondern auch andere Annehmlichkeiten, die ihm kein Großkonzern bieten konnte. Er war kein Assistent, kein Consultant, kein Unternehmensberater, sondern erfüllte Funktionen, die weit darüber hinausgingen. Steininger kümmerte sich etwa darum, dass der Baron seinen Geschäften nachgehen konnte, bereitete die wichtigsten Termine vor und legte gemeinsam mit ihm die Strategien dafür fest. Häufig führte er auch selbst die Verhandlungen. Der Baron bevorzugte es, seine Geschäfte von der Burg aus zu lenken, anstatt in seinem Büro unten im Werk zu sitzen. Dort war Steininger Lenksteins rechte Hand und leitete die Firma, wenn der Baron Besseres zu tun hatte. Ein Prokurist ohne Prokura, obwohl er das seinem Chef gegenüber so nie ausdrücken würde.
Schon während des Telefonats war Lenkstein erregt aufgesprungen und mit langen Schritten im Rittersaal herumgelaufen. Jetzt stand er an einem der großen spitzbögigen Fenster und starrte zornig hinunter in das Dorf zu Füßen der Burg.
»Schlechte Nachrichten, Herr Baron?«, fragte Steininger mit gedämpfter Stimme.
»Unten im Dorf schnüffeln die Bullen herum«, fauchte Lenkstein, wirbelte herum und kam mit schnellen Schritten zu Steininger.
Zum Glück befindet sich der Tisch zwischen uns, dachte Steininger.
»Können Sie sich das vorstellen?« Lenkstein kochte vor Wut. »Die spionieren im Dorf!«, schrie er. »Ungefragt! In meinem Dorf! Die sollen sich nach Gresten scheren oder sonst wohin und sich dort um ihre Hühnerdiebe kümmern und ihren Arsch nur hierher bewegen, wenn wir sie holen!«
Er nahm seine Wanderung durch den Rittersaal wieder auf. Die Hände hinter dem Rücken, leicht nach vorne gebeugt und wütend vor sich hin stierend. Er trug eine knielange Trachtenlederhose, dunkelgrüne Wollsocken und halbhohe Schnürschuhe, ein weißes Hemd, darüber ein dunkelgraues Leinengilet mit Kragenrevers. Der Schal um den Hals war ihm zuvor wie das Tüpfelchen auf dem I vorgekommen, nun aber schien er ihn unerträglich zu beengen. Voller Zorn riss er ihn herunter und schleuderte ihn im Vorbeigehen in eine Ecke des Saals. Sein rundes Gesicht leuchtete vor Aufregung und bildete einen unangenehmen Kontrast zum halblangen dunklen Haar, von dem ihm einige Strähnen wirr in die Stirn hingen.
Lenkstein war Mitte 40, von kräftiger Statur und hatte einen kleinen Bierbauch, den er nicht zu verbergen versuchte. Er war ein Genussmensch, der Bauch das nach außen hin sichtbare Zeichen dafür.
»Wissen Sie auch, weswegen die Polizisten hier sind?« Steininger formulierte seine Frage vorsichtig. Im Gegensatz zu seinem Arbeitgeber war er beinahe schmächtig und in einen dezenten Trachtenanzug gekleidet.
»Wegen der kleinen Lindner!«, schrie Lenkstein. »Wegen dieser verfickten Schlampe. Wegen der laufen sie herum und stellen blöde Fragen. Ob irgendwer etwas darüber weiß, warum sie verschwunden ist und wo sie war. Solche Scheiße halt!«
Steininger zog es vor, den Mund zu halten. Sollte sein Chef erst einmal Dampf ablassen, dann würde man vernünftig mit ihm reden und geeignete Maßnahmen überlegen können. Das war ein bewährtes Vorgehen.
»Was geht die das an?«, begann Lenkstein wieder zu toben. »Das ist unser Problem. Die Lindner gehört zu uns ins Dorf und wir kümmern uns selbst um solche Sachen. Dafür brauchen wir keine beschissenen Bullen.«
Steininger betrachtete seinen Arbeitgeber mit der Achtsamkeit eines Dompteurs, der sich mit einem Tiger in der Manege befand, im Bewusstsein, die Situation im Griff zu haben, aber auch mit der Gewissheit, dass die Raubkatze ihn jederzeit zerfetzte, wenn er einen Fehler machte. Leopold Freiherr von Lenkstein zu Friedheim, so würde der volle Name seines Chefs lauten, wären die Adelstitel nicht nach dem Ersten Weltkrieg abgeschafft worden. Doch der Titel allein macht keinen Feudalherren, dachte Steininger und fragte sich, mit welch harter Hand die Lenksteins wohl vor 100 oder 200 Jahren über ihre Ländereien geherrscht hatten.
»Am liebsten würde ich ins Dorf fahren und sie rausprügeln«, erboste sich Lenkstein abermals.
Steininger merkte jedoch, dass die Wut bereits am Verrauchen war. »Das wird leider nicht möglich sein, Herr Baron. Wir haben um 15 Uhr einen Termin mit dem Bürgermeister von Amstetten.«
»Ich weiß, ich weiß.« Unwirsch winkte Lenkstein mit den Händen. »Außerdem sind die Zeiten vorbei, wo man so etwas ungestraft tun durfte. Leider. Aber die Bullen haben sich hier nicht einzumischen. Das habe ich dem alten Hager schon oft gesagt.« Noch einmal ergriff die Erregung Besitz von ihm: »Ich bin doch nicht irgendein Arschloch, das gegen eine Wand redet. Ich bin Baron von Lenkstein. Man gehorcht mir, wenn ich etwas sage.« Er trat zum Tisch und schlug mit der Faust darauf, um seine Wut abzureagieren. »Und wenn sich jemand unaufgefordert in Angelegenheiten einmischt, die in meinem Dorf passieren, dann beleidigt er mich höchstpersönlich. Das werde ich mir nicht gefallen lassen.« Erneut lief er wie ein gereiztes Tier auf und ab.
»Vielleicht sollten wir feststellen, was die Polizisten tatsächlich wollen«, begann Steininger die Situation zu analysieren. »Vermutlich müssen die das tun. Möglicherweise ist es nur eine Routineuntersuchung, die schnell beendet ist, und wahrscheinlich sind sie in ein paar Tagen ohnehin wieder weg. Wie die Polizisten, die schon einmal das Verschwinden der Lindner untersucht haben. Die sind auch nach ein paar Tagen wieder abgehauen. Dann kehrt alles zur gewohnten Normalität zurück. Also, wenn wir jetzt schon beim Bezirkspolizeikommandanten anrufen, wirbeln wir voraussichtlich mehr Staub auf, als diese Sache wert ist.«
Lenkstein hielt inne und betrachtete Steininger mit einem Blick, den dieser nicht zu deuten wusste, doch dann entspannte er sich. »Ach, Steininger. Was täte ich ohne Sie. Natürlich haben Sie wieder einmal recht. Wer weiß, was diese uniformierten Idioten da unten im Dorf tatsächlich treiben. Sorgen Sie dafür, dass irgendwer diese Komiker zu mir heraufschickt. Und dann holen Sie den Wagen, wir fahren nach Amstetten.«
Lenkstein verließ den Rittersaal durch eine Tür an der Stirnseite, hinter der, wie Steininger wusste, eine breite Wendeltreppe in den Hof hinunterführte.
Nun konnte sich auch Steininger entspannen. Er zog sein Handy aus der Sakkotasche, führte einige Telefonate und war sich danach sicher, dass alle Schienen gelegt waren, um die Polizisten in die Burg und zum Baron zu führen. Er rief den Chauffeur an und ließ den Wagen vorfahren.