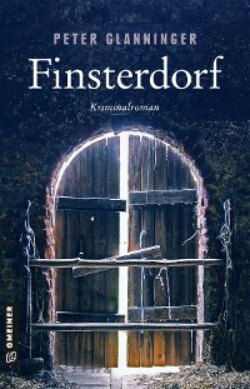Читать книгу Finsterdorf - Peter Glanninger - Страница 7
3.
ОглавлениеSie hatte so lange geweint, bis sie glaubte, keine Tränen mehr in sich zu haben. Sie lag in einem Verlies. Es war kein herkömmlicher Raum, kein Zimmer, sondern ein Kerker, wie sie ihn nur aus Filmen und Besuchen in alten Burggemäuern kannte. Eine kleine Zelle, vier Schritte breit und sechs Schritte lang, die Mauern aus grob behauenen Steinen und der Boden gepflastert, kalt und feucht. Kein Fenster, kein Tageslicht. So finster, dass sie nichts sah. Aber an der Stirnseite der Zelle konnte sie in Kniehöhe einen eisernen Ring ertasten, der dort in die Wand eingelassen war. Der Raum war leer bis auf einen Plastikeimer, den sie als Toilette benutzen konnte.
Sie wusste nicht, ob Tag oder Nacht oder wie lange sie schon hier war. Sie besaß kein Zeitgefühl mehr. Aber mit Sicherheit war sie bereits mehrere Tage in ihrem Verlies gefangen. Die Stunden zerschmolzen in einer Mischung aus Verzweiflung und Angst, unterbrochen von einzelnen Ereignissen.
Manchmal wurde eine Klappe geöffnet, die sich am unteren Rand der massiven Holztür befand. Dann schob jemand eine PET-Flasche mit Wasser in die Zelle und einen Plastiknapf mit Suppe. Es war immer das gleiche Zeug – klare Gemüsesuppe. Ohne Löffel. Sie schlürfte die Suppe und musste das Gemüse mit den Fingern essen. Zuerst hatte sie nichts hinuntergebracht, aber später war der Hunger so groß geworden, dass sie zu essen begonnen hatte.
Manchmal kamen zwei vermummte Männer an die Tür, forderten sie auf, den Eimer zu bringen, nach hinten zu gehen und sich dort mit dem Gesicht zur Wand hinzustellen. Sie tauschten den stinkenden Kübel gegen einen leeren aus, in dem eine Rolle Klopapier lag.
Wenn sich die Klappe öffnete oder die Tür, waren dies die einzigen Momente, in denen sie ein bisschen Licht sah.
Die meiste Zeit saß sie zusammengekauert und frierend in einer Ecke ihres Kerkers. Am Anfang war sie herumgelaufen, von der Tür zur Wand und zurück, zehn Schritte immer hin und her. Später war sie im Kreis gegangen. Sich an den Wänden entlang tastend, einmal in die eine Richtung und dann in die andere. Um ihrer Angst Herr zu werden, um die Dunkelheit zu ertragen und die Einsamkeit. Aber es hatte nichts genutzt. Die Angst war geblieben und die Dunkelheit und die Einsamkeit.
Jetzt saß sie nur mehr in einer Ecke. Oder sie schlief auf dem nackten Steinboden, wenn sie müde war, oder sie aß, wenn es Suppe gab, oder sie verrichtete ihre Notdurft oder sie stellte sich an die Wand, wenn der stinkende Kübel getauscht wurde. Das war nun ihr Leben.
Niemand hatte ihr bisher etwas getan, niemand hatte sie vergewaltigt. Und niemand sprach mit ihr. Sie hatten ihr nur die Schuhe und den Gürtel ihrer Jeans weggenommen. Zunächst hatte sie mit den Männern reden wollen, hatte gefragt, was los sei, was sie von ihr wollten, warum sie hier sei, wo sie überhaupt sei. Aber es gab keine Antwort. Dann schrie sie, beschimpfte sie, und als der Kübel wieder einmal getauscht wurde, versuchte sie an die Tür zu gelangen. Doch die Männer warfen sie brutal zu Boden, einer kniete auf ihrem Rücken und der andere flüsterte ihr ins Ohr: »Wenn du nicht brav bist, hängen wir dich mit einer Kette an die Wand wie einen räudigen Hund.« Trotz der Stoffmaske, die er trug, konnte sie seinen Atem spüren. Und er leuchtete mit einer Taschenlampe auf den Eisenring an der Wand. Von diesem Zeitpunkt an blieb sie gehorsam an der Wand stehen, wenn die Männer kamen.
Jedes Mal, wenn die Tür sich öffnete, wurde sie von einer unbestimmten Angst gepackt. Sie wusste, dass es einen Grund gab, warum sie hier war, dass ihre Entführer etwas mit ihr vorhatten. Und jedes Mal, wenn die Tür sich öffnete, befiel sie die Furcht, dass es jetzt geschehen könnte.
Irgendwann war es so weit. Die Tür wurde aufgerissen und grelles Licht blendete sie. Bevor sie wusste, was geschah, zog sie jemand hoch, und mit einem stinkenden Stofffetzen wurden ihr die Augen verbunden. Die Angst war wieder so übermächtig, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte.
»Zieh dich aus«, hörte sie eine Stimme, gedämpft und wie aus weiter Ferne.
Sie waren gekommen, um das mit ihr zu tun, weshalb sie sie hierhergebracht hatten. Die ganze Zeit über hatte sie darüber nachgedacht, was die Männer von ihr wollten, und war immer nur zu einem Ergebnis gekommen. Sie hatte versucht, sich damit abzufinden, aber es war ihr nicht gelungen. Jetzt war es so weit.
»Nein, bitte, tut mir nichts«, stammelte sie und begann zu weinen. Gleichzeitig wusste sie, dass alles Flehen vergeblich war.
»Zieh dich aus«, wiederholte der Mann, diesmal ungeduldiger. »Oder sollen wir dir dabei helfen?«
Sie war unfähig, sich zu bewegen. Plötzlich hörte sie ein lautes Knacken und spürte einen stechenden Schmerz im Oberschenkel. Sie schrie, stolperte zur Seite und fiel hin.
»Steh auf und zieh dich aus, oder willst du noch einmal?« Erneut hörte sie das ratternde Knacken. Trotz der Augenbinde nahm sie einen hell züngelnden Lichtpunkt wahr. Verzweiflung und Furcht wurden so übermächtig, dass sie sich nicht mehr beherrschen konnte. Sie machte sich in die Hose.
»Los, mach schon!«, hörte sie den Befehl.
Ihr Oberschenkel tat höllisch weh, als sie sich wieder hochrappelte. Sie konnte kaum stehen. Langsam zog sie sich aus, zuerst ihre Bluse, dann die nasse Hose, schließlich stand sie in Unterwäsche da, zitternd vor Angst, Kälte und Scham.
»Alles!«
Nach einem Moment des Zögerns öffnete sie den BH, ließ ihn zu Boden fallen und zog danach ihr Höschen aus. Sie konnte kaum auf den Beinen stehen bleiben. Sie weinte noch immer.
Zwei Männer waren nun neben ihr, packten sie und banden ihre Handgelenke mit einem groben Seil zusammen. Sie spürte einen Ruck an den Fesseln, der sie nach vorne riss.
»Los, gehen wir!« Ein scharfes Kommando. Es war ihr kaum möglich, einen Schritt zu tun, sie stolperte vorwärts, zum Teil gezogen, dann am Arm gepackt und wie eine Blinde geführt.
Es ging durch einen Gang und anschließend über eine enge Wendeltreppe hoch. Sie stieß sich daran die Zehen blutig.
Sie hörte dumpfes Geraune und Stimmen. Eine Tür wurde geöffnet, sie wurde in einen Raum geführt und die Menschen darin verstummten. Sie war gefesselt und konnte nichts sehen. Sie stand nackt da und wusste nicht, wie viele Leute sie anstarrten. Nun begriff das Mädchen, was das alles zu bedeuten hatte und was man mit ihr vorhatte. Das Gefühl, sich wegen ihrer Nacktheit schämen zu müssen, war mit einem Mal verschwunden, wurde weggewischt vom Bewusstsein des Ausgeliefertseins. Entsetzen packte sie und die Angst vor dem Kommenden, wie ein übermächtiges Tier, das sich unbemerkt angeschlichen hatte und sie zerriss. Ihre Beine gaben nach und sie sackte zu Boden.
»Bringt sie her!«, schrie die dumpfe Stimme eines Mannes.
Zwei Männer zerrten das Mädchen an den Armen hoch und schleiften es in die Mitte des Raumes. Eine Kette mit einem Haken hing dort an einem Flaschenzug. Damit zogen sie den schmächtigen Körper an den Armen in die Höhe, bis das Mädchen nur noch auf den Zehenspitzen stehen konnte. Einer der Männer band ihre Fußgelenke an einen metallenen Ring, der im Boden eingelassen war.
Sie begann vor Schmerzen zu wimmern, weil die Fesseln in ihre Handgelenke schnitten. »Bitte«, flehte sie, »bitte tut mir nichts. Ich mache es auch nie wieder. Ich …«
Der Mann vor ihr schlug sie ins Gesicht und beendete damit das Flehen nach Gnade.
Sie begann erneut zu weinen. Dann spürte sie eine Hand zwischen ihren Beinen und schrie. Die Hand verschwand. Sofort aber streichelte sie ihren Rücken und ihre Brüste.
»Du bist schön. Möchtest du schön bleiben oder sollen wir dich so herrichten, dass dich kein Mann mehr ansieht?«
Sie hörte ein Klicken. Ein Feuerzeug, dachte sie und spürte eine Flamme an ihrer rechten Brust und einen brennenden Schmerz. Sie schrie und zerrte an den Fesseln, krümmte sich, doch es war nicht möglich, der kleinen Flamme zu entkommen. Es schien eine Ewigkeit zu dauern und nicht aufhören zu wollen. Dann war die Flamme weg. Aber der Schmerz blieb. Es roch nach verbrannter Haut. Sie musste würgen, und hätte sie etwas anderes gegessen als dünne Suppe, hätte sie sich übergeben. Sie weinte noch immer, und die Tränen wurden von der Augenbinde aufgesogen.
Sie glaubte, das erregte Keuchen von Menschen zu hören, war sich jedoch nicht sicher. Vielleicht täuschten sie ihre Sinne. Vielleicht waren nur die Männer hier, die sie geholt hatten.
Plötzlich spürte sie einen spitzen Gegenstand an ihrer Brust. Eine metallene Spitze umkreiste ihre Brustwarze. Die Angst umklammerte sie noch stärker und ließ sie heftig atmen. Als wolle die Spitze ihren Körper streicheln, glitt sie in das Tal zwischen den Brüsten und danach hoch zur anderen, umkreiste auch dort die Brustwarze, zog weiter und bohrte sich leicht in die zuvor verbrannte Stelle. Ein greller Schmerz durchzuckte sie und ließ sie aufschreien. Sie spürte eine Hand auf ihren Brüsten und unterdrückte einen neuerlichen Schrei.
»Schöne Titten. Du hast so wunderschöne Titten. Wir könnten sie dir in Streifen schneiden. Möchtest du das?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein«, kam kaum hörbar aus ihrer trockenen Kehle.
Dann war seine Stimme an ihrem Ohr: »Weißt du, wo du hier bist?«
Sie nickte zaghaft.
»Und weißt du auch, warum du hier bist?«
»Ja«, flüsterte sie.
»Gut«, sagte er, »sehr gut. Ich werde dir jetzt einige Fragen stellen. Und ich möchte, dass du sie mir beantwortest. Ehrlich beantwortest. Wenn du das nicht machst, werde ich dir sehr wehtun. Dagegen werden dir alle deine bisherigen Schmerzen lächerlich erscheinen. Am Ende wirst du ein Haufen geschundenen Fleisches sein. Glaubst du mir das?«
Sie nickte.
Er stellte seine Fragen, und sie antwortete ihm wahrheitsgetreu. Er wusste, dass sie ihn nicht belog. »Braves Mädchen«, flüsterte er an ihrem Ohr. »Was sollen wir jetzt mit dir machen?«
Sie wurde am Haar gepackt und ihr Kopf zurückgerissen. Sie stöhnte leise.
»Du gehörst uns!«, brüllte er sie an. »Nur uns! Für immer und ewig! Vergiss das nie! Du hast deine Seele dem Teufel verkauft – und jetzt bist du bei mir!«
Sie versuchte zu nicken.
»Vielleicht lassen wir dich laufen. Dann kannst du wieder ein normales Leben führen. Du bist jedoch nicht frei. Außerdem trägst du das Zeichen. Das müssen wir dir vorher herausbrennen.«
»Nein, bitte nicht«, wimmerte sie und zerrte wild an den Stricken. »Bitte nicht. Bitte nicht.«
Ihr Flehen verlor sich in einem fürchterlichen Schrei, als ihr ein glühendes Eisen mit einem grässlichen Zischen unter der linken Achsel ins Fleisch gedrückt wurde. Ihr Körper zuckte und wand sich in den Fesseln. Vergeblich versuchte sie, dem Eisen zu entkommen. Sie warf den Kopf zurück, obwohl er immer noch an den Haaren gehalten wurde, doch dieses Reißen war nichts gegen den Schmerz, der ihren Körper durchfuhr. Sie schrie so laut und so lange sie konnte, bis das Brandeisen wieder weg war. Die Schmerzen wurden schwächer, waren aber noch stark genug, um kaum erträglich zu sein. Tränen liefen über ihre Wangen, die Augenbinde konnte sie nicht mehr zurückhalten. Ihre Brüste hoben und senkten sich schnell, so rasend ging ihr Atem.
Sie wünschte sich, ohnmächtig zu werden, dann würde sie keine Schmerzen mehr spüren, aber es geschah nicht. Als der Mann sie losließ, kippte ihr Kopf nach vorne. Doch einen Moment später wurde er wieder an den Haaren hochgerissen. Sie schrie vor Schmerz und hörte erneut die flüsternde Stimme: »Wenn du nur ein Wort sagst über das, was hier passiert ist, nur ein Wort zu deinen verfluchten Eltern oder einer deiner verfickten Freundinnen oder zu dem versifften Pfaffen oder zu sonst irgendeiner beschissenen Kreatur, nur ein Wort – dann holen wir dich wieder. Ganz egal, wo du dich verkriechst, wir werden dich finden. Und dir wird alles, was wir bisher mit dir gemacht haben, wie das Paradies vorkommen. Wir werden dich ficken und dir die Haut abziehen und dich so lange in deinem Loch verfaulen lassen, bis der Tod dir eine Erlösung sein wird. Hast du das verstanden?«
Sie nickte unmerklich. Der Schlag einer Peitsche traf sie quer über den Rücken. Sie schrie.
»Hast du das verstanden?«, fragte die Stimme noch einmal, immer noch leise, aber bestimmter, wie das zornige Zischen einer giftigen Schlange. »Antworte oder wir schlagen dir das Fleisch von den Knochen.«
»Ja«, keuchte sie, »ja.«
»Lauter.«
Ein neuer Schlag hinterließ eine zweite Strieme, die brannte, als hätte ihr jemand Säure über den Rücken gegossen. Sie brüllte, das Schreien ging in ein hysterisches »Ja! Ja! Ja! Ich hab verstanden!« über.
»Gut«, flüsterte er und streichelte über ihre Brüste.
Jetzt wurden die Stricke gelöst und sie sackte zu Boden. Einen Moment lang keimte Hoffnung in ihr auf. »Bitte, lasst mich gehen«, wimmerte sie.
Als Antwort zog die Peitsche eine neue Strieme über ihren Rücken, und die Stimme sagte: »Du gehst, wenn ich es dir erlaube. Wir sind noch nicht fertig mit dir.«