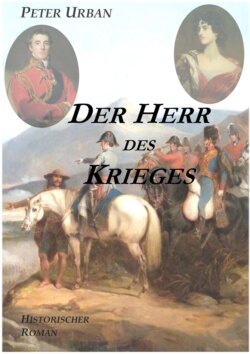Читать книгу Der Herr des Krieges Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4 Das Testament von Robert the Bruce
ОглавлениеDer anglo-alliierte Stab war bereits seit Mitte Februar 1810 vollständig in Viseu versammelt. Nur Robert Craufurd, der mit seiner Leichten Division die Grenze bei Almeida schützte, machte noch immer regelmäßig die beschwerliche Reise durchs Gebirge, um an Lagebesprechungen teilzunehmen. Lord Wellington selbst hatte zähneknirschend sein düsteres, neues Hauptquartier hoch in den Bergen der Beira bezogen. Wie ein Vogelnest hing die Festung von Viseu, das Castelo dos Corvos über der Stadt in den Felsen, fast 5000 Fuß über dem Meeresspiegel. Diese zinnenbewehrte Templerburg aus dem 12. Jahrhundert hatte der Großmeister Gualdim Pais zum Schutz gegen die Mauren errichtet. Die Portugiesen hatten die Wehr nie zerfallen lassen. Ihre doppelten Umfassungsmauern mit den zehn flankierenden Rundtürmen und einem noch höher angelegten Bergfried mit Aussichtsturm waren vollständig erhalten. Doch das Umland war karg und ausgesprochen dünn besiedelt. Obwohl die Temperaturen im Tal und in Coimbra bereits mild und frühlingshaft waren, lag in Viseu und auf dem Hochplateau des Castelo dos Corvos noch Schnee und ein eisiger Wind bließ von Norden her über das ungeschützte Gelände. Die Festung war solide aus schwerem Granit gebaut worden, ihre Wände waren dick und anstelle von Fenstern, gab es Schießscharten. Die Herren des Tempels hatten sorgfältig an den Schutz der nördlichen Einfallsroute nach Portugal gedacht und eine unbezwingbare Wehr konstruiert, nur an Annehmlichkeiten für die Bewohner schien keiner gedacht zu haben. Das Gemäuer war einfach unbeheizbar! Die im überdimensionierten Arbeitszimmer des Oberkommandierenden versammelten Offiziere hatten sich alle in schwere Wollmäntel gehüllt, um der beißenden Kälte zu widerstehen. Sir Thomas Picton, der gerade erst als willkommene Verstärkung aus England in Portugal eingetroffen war, lief leise fluchend auf und ab und schlug die Arme um den Körper, um sich aufzuwärmen. Seine Gesichtsfarbe hatte bereits ins Bläuliche gewechselt und seine Finger waren steifgefroren. Er sehnte sich zurück in die Karibik, auf seine warme sonnige Insel Trinidad. Bob Craufurd berichtete allen Anwesenden über die letzten Entwicklungen im Grenzgebiet zwischen Kastilien und der Beira. Wellington fror erbärmlich. Die langen Jahre in Indien hatten sein Blut dünnflüssig gemacht. Selbst ein unmöglicher handgestrickter Pullover von John Dunn und der pelzgefütterte Dolman, gegen den er seine übliche, blaue Felduniform eingetauscht hatte, boten kaum Schutz vor den Temperaturen auf dem Hochplateau. Seit er das Castelo dos Corvos bezogen hatte, haßte er diesen grauenvollen Ort leidenschaftlich, doch es war der einzige, von dem aus man gleichzeitig die nördliche Einfallsstraße nach Portugal entlang des Mondego, über Celorico, Bussaco und Coimbra und den parallelen Weg, südlich des Mondego von Celorico, über Chamusca, Maceira, Ponte de Murcella und Coimbra überblicken konnte. Mehr als 100.000 französische Soldaten hatten in den Wintermonaten die Pyrenäen überschritten, um König Josephs Truppen zu verstärken und seine Herrschaft über Spanien zu festigen. Die schwer erkämpfte Unabhängigkeit des portugiesischen Verbündeten wurde erneut bedroht. Nur zu genau konnten die Alliierten in diesem Augenblick die Gefahr aus dem Norden einschätzen, denn ein unablässiger Strom von Informationen erreichte Wellingtons Nachrichtendienst in Viseu. In seinem Hauptquartier trafen nicht nur regelmäßig Zeitungen in fünf Sprachen und Depeschen aus England und aus ganz Europa ein. Auch die Guerilleros Spaniens, die irischen Seminaristen der gesamten Iberischen Halbinsel und sein eigener, stetig wachsender Spionagedienst lieferten täglich wertvolle Informationen, aus denen er langsam, Mosaikstein um Mosaikstein, seinen eigenen Operationsplan für den Sommerfeldzug 1810 entwickelte. Meist las er selbst bis tief in die Nacht, oder befragte Spione und Guerilleros. Bevor er seine endgültigen Pläne sowohl Whitehall als auch dem alliierten Stab mitteilen konnte, wollte er sich zu Hundert Prozent sicher sein, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Wellingtons Verstand wurde von einer reinen, mathematischen Logik beherrscht und in den langen Jahren seines Armeedienstes war er ein harter Realist geworden. Er verstand nur zu gut, was in Portugal und Spanien mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln machbar war, ohne ein zweites Talavera zu erleben. Trotzdem gestand er sich noch Kreativität und ein wenig Phantasie zu, um zu spekulieren, was „auf der anderen Seite des Hügels” geschah. Mit jedem Tag, der verging, wurden ihm die Franzosen vertrauter. Er war sich in diesen Augenblicken, wenn er alleine durch die Berge ritt, oder seine großen präzisen Stabskarten betrachtete absolut sicher, daß Portugal verteidigt werden konnte und daß seine Taktik der Zurückhaltung und des Abwartens die richtige war, auch wenn die Verbündeten und seine Regierung ihn dafür beschimpften. Wie er bereits in den Wochen nach Talavera befürchtet hatte, war Sevilla für die Oberste Junta Spaniens nach dem Verlust der Armeen von General Areizagos und dem Duque Del Parque unhaltbar geworden. Sie hatte sich auf Cadiz zurückgezogen und Soult hatte die Exilhauptstadt Spaniens mit dem 1. Armeekorps belagert. Die schrecklichen Dragoner Latour-Maubourgs waren ihm zu Hilfe gekommen und hatten die rechten Flanke Sevillas bedroht und jegliche Verbindungen der Provinz Estremadura mit Kastilien und Leon unterbrochen. Am 1. Februar 1810 war König Joseph im Triumph in der alten Stadt eingezogen. Er bewohnte nun den Reales Alcazares und konnte sich zum ersten Mal wirklich als Herrscher über das ganze Land fühlen. Marschall Victor hatte General Zerain aus Almaden vertrieben und marschierte auf Cordoba, um sich dort mit Marschall Junot zu vereinigen. Obwohl die Oberste Junta den Generälen Albuquerque und Del Parque Marschbefehl erteilt hatte, war in Wellingtons Augen doch schon alles verloren. Lange bevor die Spanier Cordoba erreichen konnten – Albuquerque befand sich in der Estremadura, Del Parque irgendwo in den Bergen zwischen Bejar und Ciudad Rodrigo – waren die Franzosen in das Tal des Guadalquivir einmarschiert. Die Oberste Junta stürzte und wieder einmal versank das Land im politischen Chaos, denn Castaños, de la Romaña, Palafox und die anderen jungen Generäle ertrugen die Fehlentscheidungen ihrer politischen Führer nicht mehr und erhoben sich gegen den Erzbischof von Leodicea, den Conde de Altamira und den unfähigen General Eguia. Zu Arthurs großem Bedauern waren seine spanischen Kollegen heute untereinander genausozerstritten, wie die Intrigantenclique der alten Höchsten Junta es vor ein paar Monaten auch gewesen war. Damit hatte König Joseph Bonaparte sein Spiel vorerst gewonnen. Napoleon konnte mit seinem älteren Bruder zufrieden sein und sich ganz seiner jungen Gemahlin, Marie-Louise von Habsburg und der Gründung einer Dynastie widmen. Für die Alliierten hatte diese Situation insgeheim natürlich doch einen Vorteil: Der Kaiser würde der Iberischen Halbinsel in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht die Ehre geben ...
In Spanien war der offene Widerstand gegen die französische Okkupation zu diesem Zeitpunkt zu einem Ende gekommen. Nur noch in Cadiz und in der unzugänglichen Sierra Nevada flackerte der Aufruhr. Andalusien war unterworfen und wurde von einer Streitmacht von 70.000 Franzosen besetzt, Loison, Thouvenot und Kellermann wüteten grausam in der Provinz, sie plünderten, raubten und mordeten und schürten damit den Haß des einfachen Volkes in einem unbeschreiblichen Maß. Die Guerilleros, die die Grenze bei Nacht überquerten und sich entweder bis Almeida oder bis in Wellingtons Hauptquartier durchschlugen erzählten von übelsten Schandtaten. König Joseph bezeichnete diese Akte des Grauens als Pazifikation, Arthur nannte sie nur noch zynisch die Ouvertüre zu Napoleons Niederlage an der iberischen Front. Sie waren so unglaublich selbstsicher, diese Männer aus Paris. Sie waren so unfähig zu verstehen, welche Büchse der Pandora sie in Spanien geöffnet hatten. Sie waren so ungeduldig und wollten alles sofort: Land, Macht, Geld, Titel. Napoleon schien nur Männer in seinem engsten militärischen und politischen Umfeld zu dulden, denen die wichtigste Grundtugend eines jeden fähigen Soldaten und Diplomaten fehlte: Geduld! Und Geduld hatte ihr britischer Gegner im Übermaß. Anstatt sich zu vereinigen und über die portugiesische Grenze vorzustoßen, befaßten die Marschälle sie lieber mit dem Plündern eines Landes, das sowieso kaum noch über Reichtümer verfügte und deren rebellische Bevölkerung ihnen nur Ärger bereitet. Sie gaben Wellington alle Zeit der Welt, die Wälle von Torres Vedras zu Ende zu bauen und den portugiesischen Teil der Estremadura für ihren würdigen Empfang vorzubereiten. Arthur hatte fast zehn Jahre gebraucht, um sich selbst und die Gesetze des Krieges zu begreifen. Doch im Frühjahr 1810 besaß er nun endlich dieses unumstößliche Selbstvertrauen, das notwendig war um jeden Gegner in die Knie zu zwingen, selbst einen Napoleon Bonaparte mit seiner sieggewohnten französische Armee. Ein Feldherr, der nicht danach strebte, aus Eitelkeit die Grenzen des Ruhmes zu überschreiten und der nicht nach Unsterblichkeit und einem Platz in den Geschichtsbüchern suchte, sondern nur nach einem sauberen, militärischen Erfolg war unbesiegbar. Aus Eile und persönlichem Ehrgeiz erwuchsen Fehler, nicht aus logischer Planung und korrekter, wenn auch unspektakulärer Umsetzung. Diese Lektion hatte der Ire gelernt!
Während Craufurd redete, gingen Arthur ein paar Zeilen aus dem Testament von Robert the Bruce durch den Kopf, Schottlands König, der im 14. Jahrhundert England in die Knie gezwungen hatte: Der Bruce war in einer ähnlichen Lage gewesen, wie er in diesem Augenblick. Und es war ihm trotzdem gelungen, mit einer Bande Wilder im Kilt über Edward Longshanks Sohn und seine kampferprobten Ritterheere zu siegen, weil er den Mut besessen hatte, vor der Entscheidungsschlacht bei Bannockburn die schmutzige, kleine Waffe des armen Mannes einzusetzen: Verbrannte Erde! Sie war schlimmer für einen Feind, als jedes strahlende Feldheer mit farbenprächtigen Standarten, Kanonen und Gewehren.
„In strait placis gar hide all store,
And byrnen ye plain land thaim before,
Thanne sall thei pass away in haist,
When that thai find na thing but waist,
So sall ye turn thain with gret affrai,
As thai were chasit with swerd awai!”
Als er den Portugiesen den Befehl erteilt hatte, alles Land vor den Wällen von Torres Vedras zu verwüsten und alles, was sie nicht hinter den Wällen oder in den Bergen in Sicherheit bringen konnten gnadenlos zu vernichten, hatte er sich tagelang elend gefühlt: Portugal war ein armes Land! Die meisten Gegenden, die er in den letzten drei Jahren kennengelernt hatte, produzierten nicht einmal genug um einer eigenen, dünnen Bevölkerung ein warmes Essen am Tag zu sichern. Für eine durchziehende Armee reichten die Vorräte, die die Bauern für ein ganzes Jahr anlegten kaum drei oder vier Tage. Der Sommerfeldzug würde ein Wettlauf zwischen den Alliierten und den Franzosen werden, bei dem der als Sieger hervorging, der als letzter verhungerte! Arthur lief bei diesem Gedanken ein eisiger Schauder den Rücken hinunter. Die Iberische Halbinsel war ein erbarmungsloser Kriegsschauplatz. Die Geographie war trügerisch und der größte Feind leichtsinniger Soldaten. Wer nur eine Landkarte zur Hand nahm, dem mußte es scheinen, als ob alles einfach darauf hinauslief, Streitkräfte die drei größten Flüsse Spaniens – Douro, Tejo und Guadiana – hinunter gen Portugal zu befördern, um das kleine Land am Atlantik zu nehmen. Doch Spaniens Flüsse waren keine Verbindungswege im militärischen Sinn, sie waren zuverlässige natürliche Hindernisse, eingebettet in tiefe Schluchten, reißend, wild und völlig unberechenbar. Ihr Wasserspiegel konnte in wenigen Stunden sinken oder fast grenzenlos ansteigen. Hauptverkehrsstraßen vermieden es, den Läufen dieser Flüsse zu folgen. Über viele Jahrhunderte hinweg hatten Spanien und Portugal sich den Rücken gekehrt, und ihre wichtigsten Städte waren weder durch die Flüsse noch durch vernünftige Verkehrsachsen miteinander verbunden. Von Madrid nach Lissabon gab es keinen direkten Weg. Die Grenze zwischen beiden Ländern war für militärische Aktivitäten völlig ungeeignet. Lediglich ein Grenzabschnitt war so etwas wie Flachland und bot sich möglicherweise als Schlachtfeld an: Zwischen dem Douro und Almeida erstreckte sich bis kurz hinter den Coa auf etwa 15 Meilen eine Ebene. Bereits vier oder fünf Meilen hinter Almeida begann gleich wieder das Gebirge. Der Rest der portugiesisch-spanischen Grenze verlief durch dünn besiedeltes, rauhes, zerklüftetes Hochland, das vom Coa, Mondego, Zezere, Poncul, Agueda und Alagon in winzige, kaum begehbare Teilstücke zerschnitten wurde. Eine durchziehende Armee würde sich in kleine Untereinheiten aufspalten müssen, wehrlos in unwirtlichem Gelände. Während der vier Wochen in Coimbra hatte Wellington jede Gelegenheit genutzt, die Geschichte der Kriege auf der Iberischen Halbinsel zu studieren: Seit dem Mittelalter bis hinein in den Spanischen Erbfolgekrieg Anfang des 18. Jahrhunderts waren alle Angreifer an dieser Geographie Portugals gescheitert. Plötzlich legte sich von Hinten eine Hand auf seine Schulter: „Sir, haben Sie mir nicht zugehört?“ Craufurd war mit seinem Bericht zu Ende gekommen und hatte den Oberkommandierenden nach neuen Befehlen bezüglich der Disposition der Leichten Division gefragt. Arthur schreckte aus seiner Tagträumerei hoch und blickte Black Bob entschuldigend an: „Nein, mein Freund! Ich war mit meinen Gedanken wo anders. Es tut mir leid!”
„In der Gegend um Lissabon, nicht war?” zischte Craufurd ihm leise zu, damit die anderen es nicht hören konnten. „Leg endlich deine Karten auf den Tisch, Arthur!”
„Noch nicht, Bob! Gib mir Zeit!”
Craufurd nickte seinem Freund verständnisvoll zu und setzte sich auf die Tischkante, neben Wellington.
Thomas Picton, der zynische, alte General aus Wales und ehemalige Gouverneur von Trinidad und Tobago war über seine Versetzung auf die Iberische Halbinsel nicht sonderlich erfreut gewesen. Er ertrug nur schwer, unter einem Mann zu dienen, der 20 Jahre jünger war als er selbst und den sie nun schon drei Mal über seinen Kopf hinweg befördert hatten. Außerdem besaß Sir Thomas einen aufbrausenden, extrovertierten Charakter und viel Temperament. Er konnte mit Menschen, die ruhiger und verschlossener waren als er selbst nicht umgehen. Bereits bei seiner ersten Begegnung mit Lord Wellington hatte der alte Waliser beschlossen, daß er seinen Gegenüber überhaupt nicht leiden mochte: Er war ihm zu ruhig, zu beherrscht, zu undurchschaubar! Es verunsicherte General Picton, daß sein neuer Vorgesetzter ihm zwei oder drei Stunden zuhören konnte, ohne ihn zu unterbrechen, ohne sich zu bewegen, ohne seinen Blick von ihm zu wenden und scheinbar ohne die geringste Gefühlsregung. Die beißende Kälte im Zimmer und die kleine Szene mit Craufurd hatten sein heißes, walisisches Blut nun endgültig zum überkochen gebracht. Mit der Faust schlug er auf Arthurs Schreibtisch. Black Bob gelang es gerade noch im Reflex, die Teetassen vor dem keltischen Ungestüm zu retten: „Verdammt, Craufurd hält mit 4000 Mann mehr als 60 Meilen Front und ihm stehen 80.000 oder 90.000 Franzosen gegenüber, die jeden Moment über uns herfallen können und Sie hören ihm nicht einmal zu, Sir Arthur! Machen Sie sich eigentlich über den gesamten Stab lustig?”
Wellington zog seinen Mantel fester um sich, in der Hoffnung, der dicke Wollstoff würde die Kälte des Raumes ein wenig von ihm fernhalten. Dann lächelte er Picton an: „Nein, Sir Thomas!”
„Wollen Sie uns dann wenigsten an Ihren erlauchten Gedanken teilhaben lassen?” Der Waliser hatte vor Aufregung rote Wangen bekommen. Ihm wurde schlagartig warm. Seit Tagen schon wartete er darauf, daß diese Sphinx, die ihm gegenüber saß endlich aus ihrem Winterschlaf erwachte und ihm die Pläne der Alliierten für den Sommerfeldzug mitteilte. Er war auf die Iberische Halbinsel gekommen, um sich mit den Franzosen zu schlagen, nicht um langsam in einer Templerfestung zu erfrieren. Als er in London gewesen war, hatte er aus der englischen Presse lediglich gelernt, daß man täglich mit einem Abzug des Feldheeres aus Portugal rechnete. Er kannte, wie viele andere auch, die Einschätzung Sir John Moores, der kurz vor seinem Tod bei La Coruña ein Memorandum an den britischen Kriegsminister verfaßt hatte, in dem er dargelegt hatte, daß es unmöglich war, dieses Land vor den Franzosen zu retten. Und viele seiner Londoner Bekannten, die Söhne in Arthurs Armee hatten erzählten ihm, daß man mit einer Niederlage im Jahr 1810 rechnen mußte und daß Lord Wellington sich vor den nächsten Schritten der Franzosen fürchtete. Es ging das Gerücht um, Arthur sei am Ende seiner Weisheit angelangt und wich aus diesem Grund seit Talavera allen Feindkontakten aus. Er habe sich aus Spanien nur zurückgezogen, weil er Angst vor einer erneuten Begegnung mit Victor oder Soult hatte. Der Ire wußte um jedes dieser Gerüchte. Viele seiner Offiziere und selbst einige der Männer, die in seinem Arbeitszimmer versammelt waren, schrieben in ihren Briefen nach Hause negative Dinge, die dann auf dem einen oder dem anderen Weg in die Presse gelangten und ihm schweren Schaden zufügten. Doch trotz des Regierungswechsels in Whitehall hatten sich die beiden Kriegsminister Portsmouth und Liverpool und die beiden Außenminister Bathhurst und dann Mornington an die Versprechen ihrer Vorgänger Castlereagh und Canning ihm gegenüber gehalten und mischten sich vorläufig nicht in seine Art der Kriegführung mit Frankreich ein. Lord Liverpool hatte ihm diesbezüglich sogar einen einzigartigen Befehl erteilt: „Ich nehme Abstand davon, Ihnen irgendeinen Befehl zu erteilen! Tun Sie, was Sie für richtig halten!”
Damit war Arthur möglicherweise der erste General der neueren, britischen Kriegsgeschichte, dem seine Regierung für einen ganzen Kriegsschauplatz ‚Carte Blanche‘ gegeben hatte. Nur wußte niemand in diesem Raum etwas von Lord Liverpools Entscheidung und Wellington war davon überzeugt, daß dies auch für alle Anwesenden besser war. „Picton, wenn ich jetzt den Mund aufmache und Ihnen alles erkläre, garantieren Sie mir dann, daß nicht morgen schon die ersten Briefe an Familienangehörige nach England gehen, in denen ausführlich breitgetreten wird, wie wir mit den Franzosen im Sommer 1810 verfahren werden?”
„Wie bitte?” Die Röte war von Sir Thomas’ Wangen auf die Nase übergesprungen. Wild schüttelte er seine steingraue Mähne.
„Picton, Sie wissen, daß solche Informationen aus privatem Schriftverkehr immer ihren Weg in die Presse finden. Sie haben doch gerade eben erst selbst an der Walcheren-Expedition teilgenommen und konnten am eigenen Leib das Unheil erfahren, das aus Indiskretionen erwächst!” Wellington hatte sich zum ersten Mal seit Stunden bewegt. Er hatte den schweren Mantel über den Stuhl gelegt und war vor die große Stabskarte von Nordportugal getreten, die an der Wand hing.
„Wollen Sie etwa behaupten, Mylord, daß wir hier alle Verräter sind?” Der alte Waliser war nun richtig wütend geworden. Ein Oberkommandierender, der seinem eigenen Stab nicht vertraute, war ihm in seiner langen militärischen Karriere noch nicht untergekommen. Und dann auch noch einer, der es offen vor einem guten Dutzend Offiziere im Generalsrang zugab, ohne dabei die Stimme zu erheben.
„Sir, ich bin zwar in der Form mit General Picton nicht einverstanden”, mischte Rowland Hill sich in die Auseinandersetzung ein, „aber im Inhalt muß ich ihm leider recht geben! Es ist schwer mit einem Mann zusammenzuarbeiten, der niemanden in seine Pläne einweiht. Sie dürfen sich nicht beklagen, wenn dann defätistische Briefe nach England gehen, in denen jeder, der irgendwie schreiben kann, darüber spekuliert, wann wir uns zurückziehen, oder wie die Franzosen uns in Stücke schlagen werden!”
„Ich beklage mich nicht, Rowland!” Wellington sah seinen Freund traurig an. Es verletzte ihn ein wenig, daß gerade Hill nicht verstehen wollte oder konnte, was er eigentlich vorhatte.“ Ich bitte Sie alle hier in diesem Raum lediglich um ein wenig Vertrauen! Ist das zuviel verlangt?”
Brent Spencer schüttelte den Kopf: „Arthur, das gilt ebenfalls für alle hier im Raum versammelten! Wir bitten auch dich nur um dein Vertrauen! Wir haben nichts getan, was es rechtfertigt, daß du uns so schrecklich mißtraust!”
„Bist du dir da so sicher, Brent?” Wellingtons Augen wurden plötzlich kalt. Der Nachteil eines gut funktionierenden Nachrichtendienstes war es, daß man oft auch Dinge erfuhr, die man eigentlich nicht wissen wollte. In ihrem Übereifer hatten portugiesische und spanische Partisanen schon einige Male, um eines französischen Schriftstückes Willen offizielle Postsäcke geraubt. Zuviele Briefe seiner eigenen Offiziere waren durch Arthurs Hände gegangen, in denen mit militärischen Geheimnissen sträflich leichtfertig umgegangen wurde. Konnte er überhaupt noch irgend jemandem vertraute? Sie schrieben an ihre Frauen, ihre Mädchen oder ihre Mütter und sie plauderten alles aus, was sie wußten. Es war nie böswillig geschehen, nur immer leichtsinnig. Doch der Leichtsinn und die Schwatzhaftigkeit weniger konnte in diesem Krieg viele ihr Leben kosten. Und die bösen Briefe nach England hatten ihn sehr verletzt. Seine ausgeprägte menschliche Reserviertheit hatte sich zwischenzeitlich in eine Art Scheu verwandelt, die viele nur noch als Arroganz oder Überheblichkeit interpretieren konnten.
Wilhelm von Bock hatte kurz mit Robert Craufurd getuschelt. Beide Männer nickten einander zu. Craufurd warf noch einen Blick zu Peregrine Maitland hinüber, der an eine große Säule gelehnt am anderen Ende des Zimmers stand. Auch Maitland gab ihm mit dem Kopf ein Zeichen. „Sir Thomas, Sie sind erst vor kurzem bei uns angekommen und deshalb sicher noch nicht so ganz mit den Gepflogenheiten in unserem Stab vertraut! Es geht hier im Augenblick weder um Verräter noch um Geheimniskrämerei! Lassen Sie uns alle jetzt einfach friedlich in den Salon hinübergehen und zu Abend essen. Wir haben zu wenig Soldaten, um auch nur das geringste Risiko einzugehen. Das ist alles, was Lord Wellington sagen wollte!” Black Bob hatte Picton versöhnlich die Hand auf die Schulter gelegt und wollte ihn gerade energisch zu einer großen Holztür drängen, als Arthur ihn mit einer Geste zurückhielt: „Laß gut sein, Bob! Er hat recht! Ich muß lernen euch genauso zu vertrauen, wie ihr mir vertraut! Meine verdammte Geheimniskrämerei führt zu nichts! Ich führ mich im Moment auf, wie das Orakel von Delphi! Los! Setzt euch alle wieder hin. Bitte!” Drei Stunden später hatte der General den Anwesenden seinen gesamten Plan für den Sommerfeldzug 1810 offengelegt, so wie er in diesem Augenblick fertiggestellt war. Die meisten reagierten ungläubig. Picton, der zuvor wegen der Passivität und der Reserviertheit seines Oberkommandierenden so wütend gewesen war, war nun wegen der Tollkühnheit des alliierten Planes völlig verwirrt. Aufgeregt lief er in dem großen Raum auf und ab und murmelte, für alle deutlich hörbar vor sich hin: „Total durchgedreht! Von allen guten Geistern verlassen! Übergeschnappt! Das ist doch Selbstmord! Welcher Affe hat dich bloß in Indien gebissen, mein Junge!” Dann bremste er plötzlich scharf vor Arthur ab und schlug ihm kräftig mit seiner großen Pranke auf die Schulter: „Verrückt, aber genial! Warum eigentlich nicht ...” Wellington grinste Picton verschlagen an, dann wurde seine Miene wieder ernst und er zeigte auf die Tür zum Salon: „Können wir jetzt endlich zu Abend essen, meine Herren? Ich hab Hunger ...” Innerlich schickte er gleichzeitig ein verzweifeltes Stoßgebet los: „Und gib, gütiger Himmel, daß dieser Sack voll Flöhe für die nächsten acht oder zehn Wochen den Mund hält, oder mein Anfall von Vertrauensseligkeit wird uns alle den Kopf kosten!”