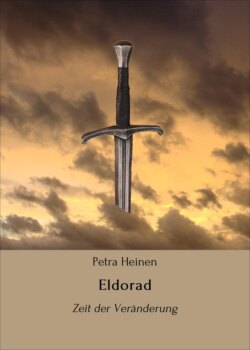Читать книгу Eldorad - Petra Heinen - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Robert Galen
ОглавлениеDie Tage nach der Ankunft des Fürsten in Undidor vergingen in ereignisloser Gleichförmigkeit. Für einen Mann wie ihn, der Zeit seines Lebens gehandelt hatte, wirkte die Untätigkeit doppelt hart. Er verbrachte viel Zeit mit der Ausbildung seines Pferdes. Die Stute wurde in den Ställen des Königs gut versorgt, aber Roman fühlte, dass auch sie der Ruhe überdrüssig war. Das härteste Training ersetzte nicht die Erfahrungen des Kampfes.
In den frühen Morgenstunden, wenn die meisten Krieger Undidors noch schliefen, galoppierte Roman über die taufeuchten Reitbahnen und übte sich im Bogenschießen. Er begann auch, das Werfen der Shuriken vom Pferd zu trainieren. Die scharfkantigen fünfzackigen Sterne waren im Grunde eher eine Nahkampfwaffe, in Brandai zudem völlig ungebräuchlich. Aber es konnte nicht schaden, sie auch aus dem Sattel heraus ins richtige Ziel zu bringen.
In Ermangelung anderer Tätigkeiten übte er sich auch im Gebrauch der Handaxt. Das war eine Waffe der Bergvölker und Roman hatte ihre Wirksamkeit schon oft erlebt. Man hielt sie für keine besonders ehrenhafte Waffe und für seinen Geschmack war sie zu klein und leicht. Aber gerade weil ihr Einsatz einen so ganz anderen Bewegungsrhythmus verlangte als sein Schwert, setzte er seinen Ehrgeiz daran, sie zu beherrschen.
An den Nachmittagen durchstreifte er die Stadt. Immer wieder verblüffte ihn Undidors beinahe unüberschaubare Größe und die faszinierende Unordnung. Der Schmutz stieß ihn ab, genauso wie die in den Vierteln am Fluss herrschende Armut. Niemals hatte er so viele Bettler gesehen, die zudem noch eine erstaunliche Unverfrorenheit an den Tag legten. Nirgendwo in Gorderley gab es soviele elende Gestalten, die müßig herumlungerten oder ganz offen dunklen Geschäften nachgingen. Seinen Augen und Ohren entging nicht, dass es Gegenden in der Hauptstadt des Königs gab, in die sich kein Edler ohne bewaffnete Begleitung wagen durfte.
Wenn er aus den engen Gassen, dem Gestank von Mist, ungelüfteten Stuben, Abwässern und vergammeltem Gemüse auftauchte, zog er sich mit einer gewissen Erleichterung in die saubere Abgeschiedenheit seines Hauses zurück. Es hatte nur weniger Lektionen bedurft, bis Tore gelernt hatte, seinen Wünschen zu entsprechen und die Räume in Ordnung zu halten.
Er machte keine Pläne und erwartete nichts. Wenn er sich gestattete, über den König nachzudenken, wunderte er sich ein wenig, dass dieser ihn bisher nicht weiter über die Verhältnisse in Gorderley ausgefragt hatte. Abgesehen vom regierenden Fürsten Elder von Gorderley, war er der höchste militärische Befehlshaber Gorderleys, und sein Wissen konnte dem König nicht gleichgültig sein, doch bisher blieb er unbehelligt.
Es vergingen zwei Wochen.
Roman stand vor einem großen Gebäude direkt innerhalb der Burgmauer. Eine Weile betrachtete er die umlaufenden Steinfriese in denen Szenen aus der Großen Schlacht dargestellt waren. Die Fenster des Gebäudes lagen im oberen Drittel der Wand und waren von innen mit Tuchbahnen abgedeckt, einige standen offen und es klangen manchmal Wortfetzen und Waffenklirren zu ihm herüber.
Der Eingang befand sich auf der Schmalseite des Gebäudes und wurde von zwei riesigen Löwen aus weißem Marmor bewacht. Der Stein war fleckig und an einigen Stellen zeugten Risse und Löcher vom Alter der Figuren. Dennoch waren die Oberflächen der Löwen blank poliert und kündeten, wie das ganze Haus von sorgfältiger Pflege. Hier lag nirgendwo Unrat herum, die Stufen waren gefegt und in den Winkeln und Bögen der Steinmetzarbeiten lag kein Staubkörnchen.
Roman ließ sich Zeit. Hin und wieder verließ ein Knabe oder Jüngling das Haus, zwei Ritter gingen hinein und kamen nach einiger Zeit wieder heraus. Niemand beachtete den Fürsten, der im Schatten eines Balkons an einer Mauer lehnte, aber er war sich sicher, dass jede seiner Bewegungen genauestens beobachtet wurde. Vielleicht sollte er noch einen Tag warten und ihnen die Gelegenheit geben, sein Interesse zu melden?
Nein, das war unnötig. Der Mann, den er sehen wollte, musste nicht vorbereitet werden.
Die Schatten wurden länger und schon seit einer ganzen Weile klangen keine Kampfgeräusche mehr aus den Fenstern. Roman reckte sich und überquerte den Vorplatz. Als er die Löwen passierte, fragte er sich, wieviele Brandai schon einen dieser mächtigen Steppenjäger gesehen haben mochten. Aus den Kulturlandschaften entlang des Branduin waren sie seit Jahrhunderten vertrieben.
Die Türe schwang lautlos zurück, als er dagegen drückte. Obwohl es später Nachmittag war, lag eine warme Helligkeit in der Halle. Die Tücher, die mittags vor der blendenden Sonne schützten, waren zur Seite gezogen und der vertraute Geruch von Leder, Schweiß und Staub hing in der Luft.
Am Ende der Halle standen zwei große Plattformen, entlang der Wände verliefen Holzbänke und einige Regale. Waffen jeglicher Art lagen darauf oder hingen in Halterungen an den weißgekalkten Mauern.
Der Waffenmeister stand mit dem Rücken zur Türe an einem Ständer mit Schwertern. Obwohl Roman beim Eintreten kein Geräusch verursacht hatte, drehte er sich um. „Fürst Gorderley“, seine Stimme verriet keine Überraschung, „ich habe Euch erwartet.“
Er nahm ein Schwert aus der Halterung und deutete wortlos auf einen Kreis aus dunklerem Holz, der im hellen Holzboden der Halle eine Arena andeutete. Roman zog sein Schwert und trat schnell heran. Es gab keinen förmlichen Beginn, der Waffenmeister griff an, kaum dass er den Kreis betreten hatte. Metall klirrte aufeinander und sein Gegner sprang zurück.
Es folgte ein schneller Schlagabtausch. Schon nach den ersten Minuten erkannte Roman, dass er einem gleichwertigen Gegner gegenüberstand. Der Waffenmeister gab sich keine einzige Blöße, hielt Risiko und Vorsicht in klugem Gleichgewicht und durchschaute Romans Finten, als hätten sie schon hunderte Male miteinander gefochten. Bei aller Übesicht kämpfte er dennoch mit unbegrenztem Einsatz und völliger Hingabe an das Gefecht, mit dem Herz und der Leidenschaft, die nur ein echter Krieger empfinden kann.
Nach einer halben Stunde, in der nur das schnelle Atmen der Männer, das Klirren der Schwerter und ein gelegentlicher Ausruf des Triumphes oder der Überraschung die Stille in der Halle durchbrach, senkte Roman nach einem heftigen Konter sein Schwert und sah seinen Gegner wachsam an. „Ihr fechtet nicht wie ein Brandai. Aber Ihr kämpft zu sehr wie ein Brandai, um ein Gorderley zu sein“, stellte er fest.
Schwer atmend gab der Waffenmeister den Blick zurück und zögerte mit der Antwort, als müsse er sich über etwas klar werden. „Ich lernte das Kämpfen in Gorderley“, sagte er schließlich, und als der Fürst abwartend schwieg fuhr er bitter fort, „ich war achtzehn, als man mich nach der Schlacht von Mancafell gefangen nahm und nach Gorderley brachte. Sie stellten mich in eine Arena und ließen einen verdammten Barbaren auf mich los. Bei Ebelond, die Unsterblichen haben damals meine Hand geführt und ich tötete ihn. Daraufhin ließen sie mich leben, als Kampfsklave.“
Einen Moment hielt er von der Erinnerung gefangen inne, bevor er weiter sprach: „Ich überlebte, weil ich lernte zu kämpfen. Und schließlich floh ich und kehrte in meine Heimat zurück. Nach neun Jahren Sklaverei.“
Mit einem Ruck drehte er sich um, ging zu dem Schwertständer und hängte seine Waffe auf. Dann schritt er langsam auf eine Tür am hinteren Ende der Halle zu. Als er den Fürsten passierte, blickte er starr geradeaus.
Nachdenklich betrachtete Roman die sich entfernende Gestalt. In den Worten des Waffenmeisters blieb vieles ungesagt. Neun Jahre in den Verliesen von Fern oder Burg Witstein zu überleben bedurfte mehr als kriegerischer Fähigkeiten. Es war eine Hölle ohne Aussicht auf Erlösung. Dieser Mann war entkommen und Roman fragte sich, wie er noch die seelische Kraft dafür gehabt haben konnte.
Nun wandte er dem Fürsten von Gorderley den ungeschützten Rücken zu, wissend, dass das Leben eines entlaufenen Sklaven unwiderruflich verwirkt war. Nein! Natürlich war dem Waffenmeister klar, dass Roman ihn hier nicht töten würde. Aber mit jedem langsamen Schritt, mit dem er wehrlos seinen Rücken darbot, gab er dem Fürsten das Recht es zu tun.
Es war erstaunlich: Der Waffenmeister bekleidete eine hohe Stellung am Hof. Er hatte überlebt, wo die meisten anderen Männer, Brandai wie Gorderley, gestorben wären, und dennoch war ein Teil von ihm der Sklave geblieben, zu dem ein gordischer Stockmeister ihn mit achtzehn Jahren gemacht hatte. Und nun überließ er, ohnmächtig gegenüber seiner eigenen Vergangenheit dem Fürsten die Entscheidung.
„Es wäre mir eine Ehre, wenn Ihr mit mir zu Abend speisen würdet, Robert Galen. Morgen?“
Der Waffenmeister stoppte. Nach einer kurzen Pause antwortete er, ohne sich umzuwenden: „Ich werde da sein. Die Ehre ist auf meiner Seite, Fürst Gorderley.“ Die Türe zu seinen Privaträumen schlug hinter ihm zu.
Roman steckte sein Schwert in die Scheide, warf noch einen Blick in die Runde und ging ebenfalls.
Vielleicht konnte dies ein Anfang sein. Er blinzelte in die schräg stehende Sonne und dachte auf dem Heimweg über den Waffenmeister nach, der ihn hätte hassen müssen und stattdessen auf seine Anerkennung gewartet hatte.
Robert Galen.
Diese Begegnung würde sich seltsam ausnehmen in den Berichten seiner unsichtbaren Bewacher. Nur der Waffenmeister konnte wirklich begreifen, was er gesagt hatte.
Sklaven trugen keine Namen.
Die Ankündigung eines Abendessens mit dem Waffenmeister versetzte Tore in helle Aufregung. Er konnte wohl die einfachen Gerichte kochen, die seinem Herrn auszureichen schienen, aber ein offizielles Abendmahl für den Waffenmeister des König überstieg seine Kochkünste bei weitem.
Für ein Versagen würde er allerdings kaum Verständnis finden, was sollte er nur tun?
In seiner Verzweiflung klagte er Lina sein Leid.
Lina war die Sonne in Tores grauer Welt. Ihre Eltern waren an der großen Winterseuche vor sechs Jahren gestorben. Sie hatte sich, eine magere Siebenjährige, allein bis Undidor durchgeschlagen, wo sie dem Küchenmeister bei dem Versuch, von seinem Wagen einige Kartoffeln zu stehlen, förmlich vor die Füße fiel. Er nahm sie mitleidig auf und ließ sie in der Hofküche arbeiten, wo sie bald der Liebling aller Köche, Dienstboten und Helfer wurde.
Lina besaß eine natürliche Liebenswürdigkeit, gepaart mit Schlagfertigkeit und Witz. So jung sie war, wusste sie sich durchaus zu behaupten und mit zunehmendem Alter wuchs sie zu einem bildhübschen Mädchen heran, dem sämtliche Küchenburschen nachstellten. Keiner konnte verstehen, dass ausgerechnet Tore Linas Herz eroberte, am wenigsten Tore selbst. Er war der geborene Verlierer, unscheinbar, furchtsam und ständig in Schwierigkeiten. Der zweite Küchenbursche sprach aus, was jeder dachte: „Ich möchte wissen, was du an diesem Angsthasen findest?“
Lina hörte nicht auf das Gerede. Anfangs gab ihr Tore einfach die Gelegenheit, gebraucht zu werden und war für sie wie ein kleiner Bruder. Sie liebte seine Sanftheit und Gutherzigkeit. Er war so ohne Arg, das er einen Scherz nicht einmal verstand, wenn dieser auf Kosten eines anderen ging. Anfangs war zu schüchtern, in ihrer Gegenwart ein Wort zu sprechen, aber mit der Zeit fühlte er, dass ihre Zuneigung, so unbegreiflich sie ihm schien, ernst war, und verlor allmählich seine Scheu. Bei ihr konnte er das Schweigen brechen, das ihn seit DER NACHT am Sprechen hinderte, doch nicht einmal ihr hatte er erzählen können, was damals vorgefallen war. Lina war klug genug, nicht in ihn zu dringen und wartete ab.
Natürlich wusste sie auch Rat für Tores Problem.
Sie zerrte ihn kurzerhand zum Küchenmeister, und weil Tore vor Respekt schon wieder zu stottern begann, erklärte sie selbst sein Dilemma und hatte in kürzester Zeit Küchenpersonal und Vorräte für ein fürstliches Mahl erschmeichelt.
Es war sogar viel einfacher als erwartet, denn Meister Jokander war wohl der einzige Mensch am Hof, der überhaupt keinen Respekt vor Bewern hatte. Im Gegenteil, er verabscheute den Hofmarschall und machte keinen Hehl aus seiner Abneigung. Mehrfach hatte er auch schon Tore ein Stück Brot zukommen lassen, wenn Bewern den Jungen hungern ließ. Das einzige Mal, als der Hofmarschall die Küche betreten hatte, um Rechenschaft über eine Anzahl von Einkäufen zu fordern, hatte Jokander ihn, ein Abziehmesser in der Hand nach kurzem Wortwechsel hinaus gejagt.
Bewerns schmähliche Rolle beim Fürsten war inzwischen stadtbekannt und der Küchenmeister hatte schallend gelacht, als er davon erfuhr. Ohne es zu wissen, besaß Roman von Gorderley seitdem einen mächtigen Verbündeten am Hof, und so kam es, dass Robert Galen, ein unerwartet hervorragendes Mahl beim Fürsten von Gorderley einnahm.
Sie begannen mit einer Fischsuppe, die auch Roman mundete und jeden Vergleich mit der fürstlichen Küche in Gorderley aushielt. Anschließend trug Tore vor Nervosität innerlich zitternd, gefüllten Fasan auf, geschmorte Kartoffeln, Bratäpfel und frisches weißes Brot. Es folgte mariniertes Rindfleisch in hauchdünn geschnittenen Scheiben, gefüllte Feigenblätter mit einer dunklen Soße aus Krabbenfleisch, gebratene Leber mit Waldpilzen und schließlich ein goldgelbes lockeres Soufflé, das die Mahlzeit abschloss.
Dazu gab es einen edlen Wein, hellrot und voller Reife. Tore hatte das erste Goldstück restlos verbraucht, um einige Flaschen dieses Weines zu erstehen, aber der Küchenmeister hatte versichert, dass es sich um die bevorzugte Sorte des Waffenmeisters handelte. Tore hoffte, dass der Fürst ihm die teuren Ausgaben nicht vorwerfen würde.
Er versuchte die beiden Ritter lautlos und aufmerksam zu bedienen und war froh, dass sie ihn überhaupt nicht beachteten, sondern sich den vorzüglichen Speisen widmeten. Dieses Essen hatte eher symbolischen als gesellschaftlichen Charakter und so sprachen sie nur wenig, bis Tore die letzten Teller abräumte und sich in die Küche zurückzog.
Robert Galen lehnte sich zurück, nahm einen tiefen Schluck des Weines und ließ sich für einen Augenblick ganz von dem wunderbaren Geschmack nach Sonne, Erde und lebendiger Reife einfangen. Er liebte diesen Wein, weil er ihm ein Stück des Lebens wiedergab, das in ihm gestorben war. Es war eine Ironie des Schicksals, dass er ihn nun im Hause eines Gorderley trank.
Der Waffenmeister spürte den Blick des Fürsten auf sich ruhen.
Dass man niemals frei wurde von seiner Vergangenheit! Gorderley schien so weit entfernt, endgültig abgeschlossen. Er hatte nach seiner Flucht Jahre gebraucht, um sich wieder in einem normalen Leben zurecht zu finden, Monate schon, um nicht automatisch bei einem Gespräch den Blick zu senken. Aber schließlich war doch alles gut geworden. Er stieg zum Waffenmeister des Königs auf, hatte ein Heim, Diener, genügend Einkünfte und eine Aufgabe, die er liebte. Man achtete ihn, die Knappen und die jungen Ritter, die er in die Kriegskunst einweihte, verehrten ihn sogar und der König schätzte seine Gesellschaft.
Und dann erschien plötzlich Roman von Gorderley und Robert Galen erkannte, dass seine Flucht nichts geändert hatte. Die Freiheit, die er errungen glaubte, war nur oberflächlich. Er hatte damit gerechnet, dass der Fürst irgendwann in seine Halle kommen würde, nur der Waffenmeister des Königs konnte hier in Brandai ein angemessener Gegner sein, und natürlich würde der Gorderley seinen Kampfstil erkennen. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit, wann er von seiner Vergangenheit erfuhr.
Und dann?
Der Fürst hatte keinen Einfluss am Hof, war selbst eher ein Gefangener mit besonderen Privilegien. Was konnte einem Robert Galen an der Meinung dieses Mannes liegen. In Undidor erzählte man sich die Geschichte seiner Flucht als Heldentat und seine Zeit als Sklave hatte keine Bedeutung.
Aber für ihn selbst entschied Roman von Gorderleys Urteil alles: Würde oder Verachtung, Ritter oder Sklave.
Und mit zwei Worten hatte der Fürst diese Entscheidung getroffen.
Der Waffenmeister räusperte sich: „Ihr wollt sicher eine Erklärung hören.“
Roman wollte nichts weniger als das. Er wusste, wie es in den Verliesen Ferns und Witsteins zuging und während seiner Knappenzeit hatte er mehr als einen Gefangenen zum Sklaven gebrochen, das erste Mal mit vierzehn Jahren unter Anleitung seines Schwertherren, und später je nach Notwendigkeit in eigener Verantwortung.
Aber der Mann, der ihm hier gegenüber saß, war kein Sklave. Und vielleicht hatte Robert Galen ein Recht darauf, ihm seine Geschichte zu erzählen. Oder ein Bedürfnis? Wer konnte ihn schließlich besser verstehen, als ein Gorderley?
„Ihr seid frei“, antwortete er kurz.
Galen schüttelte langsam den Kopf. „Nicht ganz.“
Roman beugte sich vor, schenkte dem Waffenmeister noch einmal den Kelch voll und trank selbst einen langen Schluck. Über den Rand des Bechers musterte er seinen Gast und stellte dann den Becher fest ab. „Dann will ich eine Erklärung hören.“
Robert Galen wich seinem Blick nicht aus. Unbewusst drehte er seinen Weinkelch zwischen den Fingern. Dann ließ er sich zurückfallen, erst wie ein Beobachter, doch schon nach wenigen Sätzen wurde die Erinnerung lebendig und alles schien noch einmal zu geschehen.
„Ich wurde bei der Schlacht von Mancafell mit einigen Kameraden in einen Hinterhalt gelockt. Wir konnten nicht einmal um unseren Tod kämpfen, es waren mindestens fünfzig Bogenschützen, die auf uns angelegt hatten. Gegenwehr schien sinnlos, also ergaben wir uns. Ahnungslos wie wir waren, konnten wir uns nicht vorstellen, dass man einen adligen Ritter versklaven konnte. Bauern ja, einfache Krieger, Söldner, aber doch nicht uns.
Bei den Unsterblichen, es ging so schnell, dass wir es nicht einmal merkten...“
Man hatte den Gefangenen bis auf die Unterkleider alles abgenommen, selbst die Gürtel und die Schuhe. Sie trugen Fußschellen, die über zwei Ketten mit den Handgelenken verbunden waren. Die Handschellen wiederum hingen mit zwei weiteren Ketten an einem breiten Halsring. Alle Ketten waren so kurz, dass sie nach vorn gebeugt laufen mussten und nur unter Mühe den Kopf heben konnten, um zu sehen, wohin man sie trieb. Doch schon bald unterließen sie auch das, denn die bewaffneten Begleiter ihres Zuges straften jedes Heben des Blickes mit unbarmherzigen Peitschenhieben.
Sie liefen den ganzen Tag und ohne eine Pause weiter in der Dunkelheit. Wenn jemand stolperte und fiel oder auch nur taumelte und das Vorwärtshasten verlangsamte, hagelte es Schläge mit der Peitsche. Gestürzte wurden durch Stockhiebe aufgejagt, bis sie schließlich beinahe besinnungslos einen Fuß vor den anderen setzten und nicht einmal mehr zusammen zuckten, wenn Leder oder Stock auf ihre Rücken niederschlugen.
Robert Galen strauchelte, als neben ihm ein Mann stöhnend zusammenbrach. Sofort war ein Bewacher zur Stelle, aber diesmal brachten die Schläge den Gestürzten nicht mehr auf die Beine. Galen hatte verzweifelt einen Schritt vorwärts gemacht, um sein Gleichgewicht wieder zu finden, als er das scharfe Schleifen hörte, mit dem ein Schwert aus der Scheide fährt. Es gab einen dumpfen Schlag, dann trieb der Gorderleyritter sein Pferd voran und seine Peitsche kreiste über die Rücken der Gefangenen. Der Platz neben Galen wurde von einem anderen dahin taumelnden Mann aufgefüllt. Es schnürte ihm die Kehle zu, wenn er an das Schicksal seines Kameraden dachte und er konzentrierte sich darauf, nicht über seine Ketten zu stürzen.
Der Marsch nahm kein Ende. Die Schellen an den Gelenken scheuerten die Haut wund und machten jede Bewegung zur Qual. Irgendwann drang ein Befehl durch die Dunkelheit und der Tross stoppte. Galen fiel zu Boden und schlief sofort ein.
Als laute Rufe und, noch bevor er ganz wach war, der brennende Hieb einer Peitsche ihn weckten, glaubte er, nur Minuten gerastet zu haben, aber als er den Kopf hob, sah er einen hellen Streifen am östlichen Horizont. Es dämmerte bereits, die Pause musste tatsächlich mehrere Stunden gedauert haben.
Ohne Nahrung oder Wasser trieb man sie weiter. Der Boden begann felsig zu werden und ihr Weg führte ständig bergauf. Spitze Steine schnitten durch Galens Fußlappen und er spürte klebriges Blut zwischen seinen Zehen. Ihre Bewacher schienen keine Müdigkeit zu kennen und prügelten ihre Gefangenen rücksichtslos zu schnellerem Tempo. Galen vergaß die Zeit, vergaß die Kälte und den schneidenden Wind, der mit zunehmender Höhe durch sein dünnes Hemd fuhr. Er fixierte das winzige Stückchen Weg vor seinen Füßen und schleppte sich vorwärts. Einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen. Plötzlich kam ihm der Fels entgegen. Es gelang ihm nicht einmal, sich abzustützen und er prallte mit dem Kopf auf den Boden. Für einen Sekundenbruchteil lag er ausgestreckt da, dann traf ihn der Stock. Galen schrie vor Schmerz und versuchte, seinen Kopf zu schützen, während er unter Aufbietung aller Kräfte aufsprang. Noch zwei weitere Schläge trafen ihn, bevor er die Lücke zu seinem Vordermann wieder geschlossen hatte. Blut rann ihm aus einer Stirnwunde in die Augen, aber er wagte nicht mehr, die Hände soweit zu heben, um es abzuwischen. Wenn er wieder stolperte, konnte das sein Tod sein.
Als sie einen eiskalten Gebirgsbach durchquerten, gelang es ihm, einige Handvoll Wasser zum Mund zu führen. Die Wachen ließen sich hier ein wenig mehr Zeit, bevor sie den zerlumpten Haufen, der einmal eine Einheit brandaianischer Ritter gewesen war, wieder antrieben. Gegen Nachmittag des zweiten Tages erreichten sie eine Hochebene und der Weg wurde glatter. Irgendwann verlangsamte sich das Tempo des Gefangenenzuges und Galen erwachte aus der Betäubung, die ihn seit Stunden umfangen hielt. Sein Nacken war steif und Schmerz durchfuhr ihn wie spitze Dolche, als er den Kopf hob und nach vorn sah. Sie näherten sich einem Podest aus Stein, auf dem einiger Männer standen und die Gefangenen musterten. Galen sah zur Seite und erschrak beim Anblick der Elendsgestalt neben ihm. Er hatte mit Herbrand so manche Nacht durchgezecht, aber sein einst so unverwüstlicher Kamerad starrte mit leerem Blick vor sich hin und schien ihn nicht mehr zu erkennen. Bevor Galen ihm etwas zuflüstern konnte, spürte er das Nahen einen Pferdes. Er spannte die Schultermuskeln in Erwartung eines Hiebes, aber diesmal fuhr der Stock auf Herbrand nieder. Mit knappen Stößen wurde der Ritter zur Seite gedrängt. Galen wagte nicht mehr, sich zu bewegen. Es gab einige Unruhe um ihn herum und Männer wurden vorbei getrieben. Schließlich ließ ihn ein Stoß in den Rücken vorwärts stolpern. Er rannte mit keuchenden Atemzügen neben dem Pferd des Gorderley her und hatte nur den verzweifelten Gedanken, jetzt nicht über seine Fußketten zu stürzen. Es mochten kaum zweihundert Meter sein, die er über das Feld gehetzt wurde, aber als sie eine Gruppe am Boden liegender Gefangener erreichten, brach er erschöpft zusammen. Jeder Atemzug trieb ihm feurigen Schmerz in die Lunge und minutenlang dachte er, ersticken zu müssen. Eine Weile konnte er sich nicht bewegen, sein erschöpfter Körper verweigerte schlicht den Dienst. So lag er still da und starrte in den blassen Himmel. Als er wieder versuchte, seinen Kopf zu heben, protestierte jeder Muskel, aber er zwang sich zu einer langsamen Drehung, bis er über die Schulter seines wie leblos daliegenden Nebenmannes die Ebene überblicken konnten.
Und zum ersten Mal überfiel ihn hoffnungslose Verzweiflung.
Hunderte von Brandai schleppten sich in Gruppen über das weite Feld. Mancafell musste eine totale Niederlage für das Reich gewesen sein. Galen sah die dunkle Masse der Gefangenen und begriff, dass niemand sie retten würde. Wenn so viele Krieger lebend in die Hände der gordischen Rebellen gefallen waren, wieviele mehr mussten tot auf dem Schlachtfeld geblieben sein?
Er stellte fest, dass die meisten Gefangenen in größeren Gruppen zusammen getrieben wurden und heiße Angst stieg in ihm auf. Warum hatte man ihn abgesondert? Er wollte nicht sterben!
Brennend schlang sich das schwere Leder einer Peitsche um seinen Hals und riss ihn auf die Beine. Ihm blieb keine Zeit für weitere Gedanken. Während der größte Teil der Gefangenen auf der Ebene zurückblieb, trieb man Galen und vierzehn andere Männer weiter. Es wurde schnell Nacht, aber die Gorderleywachen ließen ihnen keine Pause. Im unruhigen Licht der Fackeln führte ihr Weg wieder bergan. Es begann zu schneien und die Kälte machte Galens blutende Füße gefühllos. Er zwang sich fest aufzutreten, um das Blut zum Zirkulieren zu bringen, auch wenn ihm die Stiche, die bei jedem Schritt durch seine Sohlen fuhren, das Wasser in die Augen trieben.
Auch in dieser Nacht rasteten sie einige Stunden vor Sonnenaufgang. Galen fühlte vor Erschöpfung nicht einmal mehr den nagenden Hunger. Einige seiner Kameraden aßen Schnee gegen den Durst - Stunden später krümmten sie sich vor Magenkrämpfen. Galen nahm das Stöhnen teilnahmslos wahr. Ihn umgab ein Dämmerzustand, der seinen Beinen ermöglichte, weiterzulaufen, ohne dass er sich dessen noch bewusst war. Beinahe wäre er gegen seinen Vordermann geprallt, als dieser plötzlich stehen blieb. Dann ertönte ein Schrei. Laut und heulend, kaum noch menschlich weckte er Galen aus seiner Betäubung. Schon ertönte der Befehl zum Weitergehen. Wenige Schritte nur und er trat beinahe auf den Mann, der immer noch schrie und sich in Agonie auf dem Boden wand, wo rotes Blut im Schnee versickerte. Voller Entsetzten sah Galen, dass man ihm beide Hände abgetrennt und die Achillessehnen durchgeschnitten hatte. Sie ließen ihn sterbend zurück, die Schreie steigerten sich zu qualvollem Kreischen und klangen den übrigen Gefangenen noch meilenweit in den Ohren. Für einen Augenblick konnte Galen wieder völlig klar denken. „Sie lassen ihn hier einfach zurück. Er ist ihnen nicht einmal den Tod wert“, durchfuhr es ihn. Er betrachtete seine von Blut durchweichten Fußlappen und plötzlich wusste er, dass er diesen Marsch überleben würde. Ihn würden sie nicht verstümmelt den Raubtieren überlassen! Der Augenblick der Klarheit verschwamm, aber es blieb eine Kraft in ihm zurück, die ihn weiterlaufen ließ.
Noch ein Tag verging und eine weitere Nacht. Die Männer taumelten willenlos vorwärts. Sie hatten einen Pass überquert und kamen wieder in tiefere Regionen. Es wurde wärmer, aber das fühlten sie schon nicht mehr. Ihre Bewacher machten nur noch selten Gebrauch von den Peitschen und Stöcken, aber die Gefangenen waren weit über das Stadium hinaus, indem sie das noch bemerkten.
Die Wintersonne hatte ihren höchsten Stand schon überschritten, als sie unter dem hohen Burgtor der Festung Witstein hindurch taumelten. Galen kam wieder zu sich, als sie auf einen rauen Befehl hin im Burghof anhielten. Die Gorderley sprachen das Brando so verzerrt und unverständlich, dass es eine eigene Sprache zu sein schien, aber in den letzten Tagen hatten die Gefangenen die Bedeutung der kurzen Befehle kennengelernt. Und sie hatten gelernt, ihnen unverzüglich nachzukommen.
Galen fehlte die Kraft, sich umzusehen. Es gab keinen Teil seines Körpers, der nicht schmerzte und nach Ruhe schrie. Seine Knie waren geschwollen und zitterten. Mit all seiner verbliebenen Konzentration bemühte er sich, auf den Beinen zu bleiben. „Nicht jetzt fallen“, dachte er verzweifelt, nicht jetzt, wo das Ende dieser Qualen nahe war.
Die Nachmittagssonne schien warm in den Burghof, aber in den offenen Striemen und Wunden der Männer brannte sie wie Fieber. Dazu kam der Durst. Sie hatten seit vier Tagen nichts gegessen und kaum etwas getrunken. Als Galen das leise Plätschern eines Brunnens vernahm, wuchs sein Verlangen, bis er glaubte, wahnsinnig zu werden.
Am anderen Ende des Hofes klappte ein Tor und in die zerlumpte Gruppe der Gefangenen kam Bewegung. Einige Männer wurden durch das Tor gestoßen und verschwanden in der Dunkelheit. Galen verspürte nicht einmal mehr Angst, vor dem, was ihn erwartete. Jeder Gedanken wurde ausgefüllt von dem Geräusch des fließenden Wassers, das näher kam, je weiter der Trupp sich voran schob. Schließlich stand er neben einem Wasserbecken. Hohe Gemäuer spiegelten sich in der Wasseroberfläche, die in sein Blickfeld kam, ohne dass er den Kopf wenden musste. Er brauchte nicht einmal zur Seite zu treten. Wenn er die Hand ausstreckte, konnte er in das Becken greifen..., mit einem Schluchzer atmete er ein und ballte seine Hand zur Faust. Es konnten keine Menschen sein, die ihm dies antaten.
Er zitterte am ganzen Leib, als er einen Schritt weiterging, und dann noch einen. Die Wasserfläche verschwand aus seinen Augen, aber das muntere Plätschern blieb und steigerte seinen Durst ins Unerträgliche.
Vor ihm tat sich das Tor auf und mit einem leichten Schlag seines Stockes trieb ihn ein Wachposten vorwärts. Der Gang wurde durch Fackeln erleuchtet, aber nach der Helligkeit des Tages war Galen einen Moment lang fast blind. Trotzdem schritt er vorn, bis ein leises „Stad“, ihn innehalten ließ. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit. Er stand an einer flachen Kante. In das Blickfeld seiner gesenkten Augen kamen zwei Hände, die sich an seinen Fußschellen zu schaffen machten. Und dann ließ plötzlich der schmerzende Zug an seinem Hals nach. Galen widerstand dem Drang, sich aufzurichten und schon forderte ihn eine Stimme auf, weiter zugehen. Als er die Stufe hinunter sprang, wäre er beinahe gefallen, aber ein Hieb quer über die Brust hielt ihn auf den Füßen. Erstaunlicherweise folgten aber keine weiteren Schläge und so bewegte Galen sich langsam vorwärts. Nach vier Tagen in der gebeugten Haltung fühlte sich sein Körper jetzt seltsam leicht an. Vielleicht war es dieses Gefühl, das ihn den weiteren Weg bewältigen ließ. Von Hinten steuerte ein Gorderley ihn mit kurzen Befehlen oder Stockstößen. Sie durchliefen lange dunkle Gänge, überquerten mehrere Höfe und einen sandbedeckten Platz. Weitere Gänge führten mit leichtem Gefälle oder über Treppen in tiefere Regionen der Burg. Galens übermüdeter Geist gaukelte ihm in den Schatten an den Wänden Dämonen und Spukgestalten vor und es schien, als führe man ihn direkt ins Unterreich.
Vor einer Türe aus dicken Bohlen stoppte ihn ein neuer Befehl. Ein metallischer Gong ertönte und Sekunden später wurde das Tor geöffnet. Ein letzter Stoß ließ Galen in die Dunkelheit des Raumes stolpern. Er fiel gegen einige aufrecht stehende Gestalten, die sich bemühten unter seinem Anprall auf den Beinen zu bleiben.
Als sich die Türe schloss wurde es stockfinster. Mit letzter Kraft tastete Galen sich zwischen den schweigenden Leibern hindurch, bis er die Wand erreichte. Dort sank er nieder und schlief ein bevor sein Kopf den Boden berührte.
Er wusste nicht mehr, wieviel Zeit vergangen war.
Wieder einmal erklang der Gong und er sprang auf und blieb mit gesenktem Kopf stehen. Das bohrende Hungergefühl in seinem Magen ließ ihn hoffen, dass es die Sklaven mit dem Essen waren. Man ließ sie nicht gerade verhungern, aber es reichte auch niemals für alle Gefangenen. Die Türe öffnete sich und ein Korb wurde herein gezogen.
Galen spannte die Muskeln an. Kaum fiel die Türe ins Schloss, warf er sich nach vorn und rammte gegen die anderen Körper, die sich mit unterdrücktem Keuchen um den Korb drängten. Er angelte sich einen Brocken aus der dunklen Masse in dem Korb und zog sich schnell zur Wand zurück. Gierig biss er in das harte getrocknete Fleisch. Es weichte auf, während er daran saugte und faserige Streifen abschabte. Seit er in diesem Kerker aufgewacht war, hatte er nur Brot und einen körnigen, faden Mus gegessen, den sie mit den Händen aus dem Topf schaufeln mussten. Das Fleisch war ein köstliches Festmahl und er gab sich minutenlang dem süßlich-herben Geschmack hin.
Plötzlich spürte er eine Bewegung an seiner Hüfte. Reflexartig schlug er zu. Seine Faust traf Stoff und dann Knochen. Mühsam versuchte er in der Dunkelheit die Gestalt neben sich zu erkennen.
Der Mann lag auf dem Rücken und hatte die Hand ausgestreckt. Galen beugte sich über ihn und vernahm jetzt auch die schweren Atemzüge, deren unregelmäßige Abstände die Schmerzen verrieten, die sie bereiteten. Von diesem Gefangenen drohte ihm keine Gefahr.
„Bitte..“, die Stimme war kaum zu vernehmen. Galen bückte sich zum Mund des anderen hinab.
„Wasser“
Die fiebrig glänzenden Augen schimmerten in der Dunkelheit. Galen verwünschte seine vorschnelle Reaktion und erhob sich langsam, damit seine Ketten nicht zu laut klirrten. Vorsichtig tastete er sich zu dem Wasserbottich hindurch. Wasser zumindest bekamen sie ausreichend, bisher jedenfalls. Nach der Qual des Durstes auf dem Marsch in diese Gefangenschaft, war es zu einem Zwang für ihn geworden, immer wieder aufzustehen und einige Schlucke zu trinken. Er musste sich einfach vergewissern, dass noch genug Wasser da war. Nie wieder würde Trinken etwas Selbstverständliches für ihn sein.
Als er nach der Flüssigkeit tastete, fühlte er beunruhigt, dass der Wasserspiegel kaum noch die Fingerspitzen bedeckte und er zögerte unwillkürlich. Schnell trank er aus der hohlen Hand, auch wenn dadurch der Fleischgeschmack fort gespült wurde. Dann formte er mit den Händen eine Schale und füllte sie mit Wasser. Es tropfte zwischen seinen Fingern heraus, aber der Mann schlürfte gierig das wenige, was er mitbrachte und Galen holte noch eine zweite Handvoll.
Danach hockte er sich neben den Liegenden und starrte auf ihn hinab. Das Wasser war verschwendet, der Mann würde in den nächsten Stunden sterben. Galen war überrascht, wie wenig ihn das berührte..
„Kamerad.“
Es war nur ein gehauchtes Wort, aber es stach wie ein Blitz in Galens Gedanken. Kamerad! Dieser Mann war ein Brandai, ein Leidensgenosse, und er hatte ihn geschlagen. Er fühlte, wie er vor Scham rot anlief und beugte sich wieder zum Mund des Sterbenden herab.
„Nimm die Schuhe“, ein röchelnder Husten unterbrach die keuchenden Worte. Besorgt blickte Galen zu dem kleinen hellen Viereck in der Türe, aber alles blieb ruhig. Sanft stützte er den Rücken des Mannes. Unter dem feuchtschweißigen Hemd fühlte er deutlich die Rippenbögen hervortreten. Wie lange mochte er schon nichts mehr gegessen haben?
Nach einem Augenblick inneren Kampfes zog er den Rest seines Fleischstückes hervor, riss einen Streifen ab und wollte ihn dem Mann in den Mund schieben, aber der schüttelte schwach den Kopf.
„Nimm die Schuhe.“
Galen nickte und brachte seinen Mund an das Ohr des Liegenden. „Wie ist Euer Name. Vielleicht kann ich jemandem von Euch berichten, falls ich hier heraus komme.“
Ein Zucken durchlief den Körper, gefolgt von einem scharfen Atemzug. Lautloser Husten schüttelte ihn. Wahrscheinlich würden die anderen Gefangenen den Todkranken umbringen, wenn er die Wachen alarmierte. Eine Hand umschloss Galens Arm. Mehrmals setzte der Brandai zu sprechen an, bevor keuchte: „Nuram. Ich heiße Nuram Berg. Aber das solltest du vergessen. Vergiss alle Namen, wenn du nicht so enden willst. Vergiss!“
Sein Griff wurde schwach und er verstummte. Dann fiel sein Kopf zur Seite.
Galen nahm behutsam seine Hand und hielt sie fest. Es dauerte noch einige Stunden, bis Nuram aufhörte zu atmen, aber er gelangte nicht mehr zu Bewusstsein. Einige Male murmelte er leise unverständliche Wortfetzen und Galen verschloss ihm mit der Hand den Mund, damit er nicht zu laut wurde.
Dann war es vorbei.
Galen blieb noch einen Moment lang still sitzen, bevor er mit den Händen an dem Toten entlang strich. Tatsächlich trug er feste Stiefel. Es war erstaunlich schwierig, sie von den Füßen zu streifen. Galen hielt mehrmals inne, wenn seine Ketten gegeneinander schlugen, aber trotzdem ließ sich nicht verbergen, dass er sich ungewöhnlich stark bewegte. Endlich hatte er den ersten Stiefel herunter und schlüpfte hinein. Ein wenig zu groß; nun, das war besser als umgekehrt. Als der zweite Stiefel vom Fuß des Toten rutschte, sah Galen aus den Augenwinkeln, wie sich ein Schatten näherte.
„Gib sie mir! Ich warte darauf, seit er hereingekommen ist“, zischte eine fordernde Stimme. Der Schatten baute sich breit vor Galen auf, der noch immer am Boden hockte. „Hau ab!“, flüsterte er. Der Fausthieb streifte ihn nur, und er ließ sich nach hinten fallen. Der andere trat einen Schritt vor. Blitzschnell zog Galen die Beine an und rammte sie ihm in den Unterleib. Dann schnellte er auf, sprang an dem Angreifer vorbei in die Mitte des Raumes und blieb stehen, während der andere mit einem Aufschrei zu Boden ging. Schon flog die Türe auf und die Wachen stürmten in den Raum. Galen biss die Zähne zusammen, als ihn der erste Peitschenhieb traf. Er taumelte unter den Schlägen, aber er blieb auf den Beinen bis der Gorderley sich das nächste Opfer suchte. Man hörte nur das dumpfe Klatschen der schweren Lederpeitschen und das Stöhnen unterdrückten Schmerzes während die Wachen auf die Männer einprügelten. Je weiter hinten in der Dunkelheit ein Gefangener stand, desto mehr Hiebe prasselten auf ihn nieder, und Liegende wurden gnadenlos blutig geschlagen, bis sie sich nicht mehr bewegten.
Galens Angreifer hatte es nicht geschafft, rechtzeitig auf die Beine zu kommen und krümmte sich unter der Peitsche, ohne dass ein weiterer Schrei von seinen Lippen kam. Endlich schien den Wachen die Strafe auszureichen und sie verließen die Zelle, die Türe fiel ins Schloss und Dunkelheit legte sich über die schwer atmenden Gefangenen. Galen wartete, bis der Riegel knirschend vorgeschoben wurde, bevor er sich bewegte. Mühsam tastete er sich zur Wand zurück und fiel neben seinem Angreifer auf die Knie. Einen Augenblick rang er nach Luft, dann packte er den anderen an den Haaren und zerrte dessen Kopf an seinen Mund. „Komm mir nie wieder zu nahe“, flüsterte er, „ich kann das hier wiederholen, und ich werde es tun. Willst du herausfinden, wer von uns beiden länger durchhält?“
Der Mann war größer als Galen und hatte sich im Kampf um die Nahrungsrationen erfolgreich genug durchgesetzt, um sich stark zu fühlen. Aber nun deutete eine minimale Bewegung seines Kopfes ein Kopfschütteln an. Galen ließ ihn los und beobachtete, wie er sich langsam kriechend zurückzog.
Der zweite Stiefel lag da, wie er ihn fallen gelassen hatte. Galen ignorierte den Schmerz seiner blutenden Striemen und zog ihn an, bevor er sich in das Stroh zurück sinken ließ. Es war absurd, aber er fühlte eine tiefe Zufriedenheit.
Er konnte sich nicht erinnern, wann er den Überblick über die Tage verloren hatte. Anfangs versuchte er, die Essenszyklen zu zählen, aber schon bald brachte ihn die Eintönigkeit der langen Stunden durcheinander. Es fiel ihm immer schwerer, einen klaren Gedanken zu fassen. Häufig wachte er aus einem unklaren Dämmerzustand auf und erkannte, dass er sich nicht einmal an das Vergehen der Zeit erinnern konnte.
Hin und wieder wurde das Gleichmaß der Tage unterbrochen, wenn die Wachen außerhalb der üblichen Zeiten eintraten und den einen oder anderen Gefangenen mitnahmen. Sie sahen sie niemals wieder - hingerichtet, sagten die einen, freigekauft hofften andere, wenn die Zurückbleibenden überhaupt miteinander sprachen.
Einmal wurden vier weitere Gefangene in den Kerker gestoßen, einer von ihnen starb schon wenige Zyklen später bei einer Auspeitschung.
Galen bemerkte es teilnahmslos. Die Schmerzen seines aufgeplatzten Rückens wurden ihm so gewohnt, dass er sie kaum noch fühlte und der süßliche Geschmack des Blutes in seinem Mund ließ sich nicht mehr fortspülen. Erstaunlicherweise wurde er nicht schwächer, wie so viele andere. Er stand stets vorn, wenn sich die Türe öffnete, und so konnte er genug von dem kalten Brei ergattern, um zu überleben. Der Hunger bohrte immer, aber Galen ging nicht so weit, sich mehr zu erkämpfen, als er unbedingt brauchte. Trotzdem reichte es nie für alle, und einige der Gefangenen konnten sich abgemagert und ausgemergelt nicht mehr auf den Beinen halten, wenn es zu einer Strafaktion der Wachen kam. Es war ein Teufelskreis: Zu schwach, um sich Nahrung zu erkämpfen, wurden sie noch schwächer. Irgendwann starben sie unter den Peitschenhieben.
Der Gong erklang.
Galen sprang hastig auf uns schüttelte benommen den Kopf. Es war viel zu früh für die Sklaven mit der nächsten Mahlzeit, was geschah jetzt?
Schwacher Lichtschein fiel durch die geöffnete Türe, dann schob sich ein Schatten davor und eine Wache blickte von der Treppe in den Raum. Galens Augen waren auf den Boden geheftet. Der Gorderley kam herab und stieß ihn mit einem Stock an. „Vorwärts!“
Die Angst schnürte ihm die Kehle zu, als er die Treppe hinauf stolperte. Der Gang war von Fackeln mäßig beleuchtet, aber nach der – wochenlangen? - Dunkelheit stach ihm das Licht in die Augen. Mit einem Schlag auf die Schulter trieb ihn die Wache voran, ein weiterer Gorderley trug eine Fackel. Eine lange Steigung endete an einer Treppe, es folgte ein weiterer Gang, dann wurde es heller: Von irgendwoher schien Tageslicht herein. Ein halblauter Befehl ließ Galen anhalten. Einige Minuten geschah nichts. Er fühlte die Anwesenheit mehrerer Männer außerhalb seines Blickfeldes und spürte, wie sich seine Schultern zusammen zogen. Was hatten sie vor? Wollten sie ihn töten?
„Die Hände!“
Es dauerte einen Sekundenbruchteil, bis er die Worte in dem verzerrten Gorderley-Dialekt erkannte, aber diese Zeit ließ man ihm nicht. Ein Stockhieb knallte auf seinen linken Unterarm. Mit einem Stöhnen riss Galen die Hände hoch und streckte sie nach vorn. Jemand machte sich an seinem Nacken zu schaffen und plötzlich war der eiserne Halsring fort. Im nächsten Moment wurden die Ketten von seinen Handgelenken gelöst und dann auch von den Füßen.
„Weiter!“
Verwirrt ging er den Gang entlang. Es wurde heller und dann endete der Schatten des Torbogens und weißer Sand blendete ihn. Ein Windzug strich durch die verfilzten Haare. Galen atmete tief ein, schloss einen Herzschlag lang die Augen und sah auf.
Kein Stock prügelte ihn nieder, obwohl sich hinter ihm einige Männer bewegten.
Er stand in einer Arena. Es war ein kleiner Platz von vielleicht fünfzehn Schritten Durchmesser, umrandet von einer übermannshohen Steinmauer. Darüber zogen sich rundherum vier hölzerne Sitzreihen. Direkt gegenüber dem Tunnel, aus dem Galen nun endgültig heraustrat, unterbrach eine überdachte Loge die Ränge. Es gab keine Zuschauer außer einigen Kriegern, die sich gelangweilt auf die Balustrade vor den Sitzen stützten und hinab sahen.
„Die glauben doch nicht, dass ich hier für sie kämpfe“, dachte Galen entrüstet und blickte sich um. Es war eine Erleichterung, sich ohne das Gewicht der Ketten strecken zu können.
Ein Geräusch lenkte seine Aufmerksamkeit auf ein weiteres Tor, direkt unterhalb der Loge. Ein Mann lief heraus, sah sich kurz um und näherte sich dann Galen. Hinter ihm schloss sich die Türe.
Er trug eine Handaxt und wiegte sie locker, während er einen leichten Bogen schlug bis die Sonne in seinem Rücken stand.
„Was soll das? Ich will nicht kämpfen, ich habe nicht einmal eine Waffe “, sprach Galen ihn an. Sein Gegner schien ein Barbar aus den unwegsamen Bergen im Norden Gorderleys zu sein. Er war größer als jeder Mann, den Galen bisher gesehen hatte. Das rötliche Haar war zu einen bis zur Hüfte herab hängenden Zopf geflochten. Der unbekleidete Oberkörper wies Narben auf, aber keine Anzeichen von Hunger. Im Gegenteil, die Muskeln legten die Vermutung nahe, dass der Kämpfer körperlich kerngesund war und auf jeden Fall besser in Form als Galen.
Viel zu schnell, als dass er reagieren konnte, sprang der Barbar heran und schlug zu. Der Hieb schlitzte ihm den gesamten Oberarm bis zum Ellbogen auf, so glatt und schnell, dass Galen zuerst nicht einmal Schmerz empfand. Im nächsten Moment blitzte die Schneide der Axt wieder in der Sonne und holte Schwung für einen weiteren Schlag. Galen warf sich mit einem Wutschrei zu Boden und rollte gegen die Beine seines Gegners. Der Hieb verfehlte ihn und der Barbar wich seitwärts aus. Leichtfüßig tänzelte er um den Brandai, der taumelnd wieder auf die Füße kam.
Galens Arm hing nutzlos herab, das Blut lief ihm über die Beine und tropfte in den Sand. „Er bringt mich um“, dachte er verzweifelt, „ich kenne ihn nicht einmal, und er bringt mich um.“ Er sprang unter einem neuen Angriff fort und versuchte seinen Gegner zu umrunden, damit er ihm wenigstens den Vorteil der Sonne nahm. Der Barbar schnitt ihm den Weg ab. Mit einer weit ausholenden Bewegung ließ er die Axt an Galens Brust vorbei streifen und zerfetzte das ohnehin brüchige Hemd. Ein roter Streifen zog sich über die Haut.
Der pochende Schmerz aus dem Arm machte Galen fast blind und der Blutverlust würde ihn in wenigen Minuten so geschwächt haben, dass er seinem Gegner nicht mehr ausweichen konnte. War dies eine makabere Form von Hinrichtung?
So einfach sollten sie es nicht haben! Es lag mehr Wut als echte Kraft in dem Fausthieb mit dem er den angreifenden Barbaren empfing. Er traf ihn an der Schulter und brach sich dabei einen Fingerknöchel, aber es reichte, um den Angreifer aus dem Konzept zu bringen. Bevor der seinen Schwung abbremsen konnte, war er fast an Galen vorbei. Das war die Chance : Mit aller Kraft rammte Galen ihm den Ellbogen in die Seite und trat ihm danach von hinten in die Kniekehlen. Der Barbar fiel nach vorn. Bevor er sich abfangen konnte, warf sich Galen auf seinen Rücken und drückte den Kopf in den Sand. „Gib auf“, keuchte er, „gib auf!“
Der Körper unter ihm versuchte, sich aufzubäumen. Mit dem verletzten Arm drückte Galen die Waffenhand seines Gegners zusammen. Ihm wurde vor Anstrengung beinahe schwarz vor Augen, als er sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Kopf des Barbaren stützte und dessen Gesicht in den Boden presste. Endlich erlahmten die Abwehrbewegungen. Galen rollte sich zur Seite und hoffte, dass es keine Finte war. Nach einigen Sekunden richtete er sich auf. Sein Gegner lebte noch und atmete schwach, aber er war nicht bei Bewusstsein. Galen wollte die Handaxt mit dem Fuß fort schieben, als er die Stimme vernahm: „Töte ihn!“
Suchend sah er sich um, aber in dem Torbogen, aus dem er gekommen war, konnte er nur schemenhaft eine Gestalt in der Dunkelheit erkennen. Er starrte auf den Barbaren herab und biss sich auf die Lippen. Kein Mann von Ehre tötete einen Wehrlosen. Angeekelt wandte er sich ab.
„Töte ihn!“
Die Stimme verriet unmissverständlich Ärger.
Auf dem Boden begann sich der Barbar wieder zu regen. Schnell hob Galen die Axt auf und trat zurück. Die Bewegung verursachte Schwindel und er wusste, dass er nicht mehr sehr lange durchhalten würde.
Etwas zischte von hinten an seinem Kopf vorbei und blieb im Sand vor ihm stecken. Ein Pfeil. Galen fuhr herum und sah im Gegenlicht einen Krieger auf den Zuschauerrängen, der mit gespanntem Bogen auf ihn zielte. Diese Warnung war eindeutig.
Langsam wandte er sich wieder der liegenden Gestalt zu. Schwarze Punkte tanzten vor seinen Augen. „Er ist wehrlos. Ich kann nicht..ich kann nicht..“ Die Axt fuhr auf den Hinterkopf des Barbaren und spaltete ihn sauber in zwei Teile.
Der Stiel entglitt Galens Händen und er starrte auf die hervor quellende Gehirnmasse. Am liebsten hätte er sich selbst erschlagen vor Scham. Als er mit schleppenden Schritten auf das Tor zuging, versuchte er die Gestalt zu erkennen, die ihm diese Tat aufgezwungen hatte, aber die Schatten verbargen die Gesichter der Männer. Er zögerte einen Augenblick, die sonnige Arena zu verlassen, dann, angewidert von sich selbst trat er in die Dunkelheit des Torbogens.
Roh wurden ihm die Arme hoch gerissen und er schrie auf, als jemand seinen verletzten Oberarm festhielt. Eisernen Schellen schlossen sich erneut um seine Handgelenke und im selben Augenblick spürte er auch den Halsring. Fast war er erleichtert, denn wenn sie ihn anketteten, würden sie ihn wohl am Leben lassen. Der Gedanke hatte kaum Zeit bewusst zu werden, bis ihn der erste Stock traf.
Gnadenlos prasselten die Schläge auf seinen Rücken, Beine und Arme bis er zu Boden stürzte. Galen fühlte, wie seine Handknochen brachen, als er versuchte, seinen Kopf zu schützen. Er hörte, wie eine Rippe splitterte, und spürte, wie die Haut mit einem widerlichen Schmatzen aufplatzte und das rohe Fleisch seines Rückens freigab. Irgendwann wurde es schwarz um ihn.
Es konnten nur wenige Minuten vergangen sein, als er wieder erwachte. „Ich bin nicht tot“, war sein erster Gedanke. Sein Gesicht lag in einer Blutlache. Galen wagte nicht, die Augen zu öffnen, aus Angst vor neuen Schlägen, aber als er eine Bewegung direkt vor seinem Kopf wahrnahm, zwang er die blutverklebten Lider auseinander. Direkt vor seinem Gesicht stand ein eisenbeschlagener Stiefel. Schnell kniff er die Augen wieder zusammen. Er wollte nicht zuschauen, wie ihm dieser Fuß ins Gesicht trat.
Aber es geschah nichts.
In fehlerlosem Brando erklang die Stimme über ihm: „Du hast gut gekämpft, deshalb lebst du überhaupt noch. Und weil man dich möglicherweise noch nicht über deinen Status aufgeklärt hat.
Wenn du am Leben bleiben willst, merke dir drei Dinge, denn ich werde sie nicht wiederholen: Du bist ein Sklave. Wenn man dir einen Befehl gibt, wirst du gehorchen. Und du wirst deine Augen am Boden und deine Zunge stumm halten, ist das klar?“
Galen versuchte zu nicken und schabte mit der Wange über den rauen Boden. Ein Peitschenhieb biss sich in die offene Armwunde. „Ja“, Galen schrie und zuckte unter einem weiteren Schlag zusammen. In die Prellungen und Platzwunden schnitten unbarmherzige Striemen. „Ja, jajajaja“, seine Stimme brach in einem Schluchzer als das Leder einen blutigen Streifen über sein Gesicht zog. „Ja, ...ich habe verstanden.“
„Wiederhole!“
Mühsam schluckte er das Blut in seinem Mund herunter. „Ich bin ein Sklave. Wenn man mir einen Befehl gibt, gehorche ich. Ich sehe niemanden an und darf nicht unaufgefordert sprechen.“ Die Worte kamen stockend und undeutlich über seine geschwollenen Lippen und Galen fühlte die Aufmerksamkeit der Wachleute. Er hielt den Atem an und wartete auf neuen Schmerz, aber nach einem Augenblick befahl die Stimme: „Steh auf!“
Galen war sicher, es nicht zu schaffen. Seine rechte Hand war gebrochen und einige andere Knochen auch. Der linke Arm war zerfetzt und blutete ohne Unterbrechung, jeder Punkt seines Körpers schrie vor Schmerz. Dennoch zog er die Ellbogen unter den Bauch und versuchte, seinen Oberkörper zu heben.
Ich will nicht sterben, dachte er verzweifelt und presste die Zähne aufeinander, als beim Aufsetzen der Schmerz der gebrochenen Hand wie eine feurige Lohe in den Arm hinauffuhr. Jeder Atemzug war Qual und trieb schaumiges Blut in seinen Mund, jede Bewegung steigerte die Pein bis zum Rande des Unerträglichen. Und dennoch ertrug er es. Kein Laut kam von seinen Lippen, während er sich schneckenhaft langsam auf die Knie zog und von irgend woher die Kraft nahm, auf die Füße zu kommen. Er wusste mit tödlicher Sicherheit, dass man ihm keine zweite Chance geben würde.
Später konnte er sich nicht mehr daran erinnern, wie er den Weg in den Kerker hinter sich gebracht hatte. Irgendwann fand er sich fiebernd und zitternd auf dem Stroh wieder. Tage lag er im Delirium. Hin und wieder spürte er Flüssigkeit auf den brennenden Lippen, aber nichts half gegen die brüllenden Schmerzen in jeder Faser seines Körpers.
Galen kämpfte.
Manchmal schlug er um sich und wehrte sich mit der Kraft eines Wahnsinnigen gegen die Hände, die ihn festhielten. Dann wieder lag er tagelang bewegungslos, während er in seinem Inneren gegen Feuer und Dunkelheit, Kälte und Tod focht.
Schließlich überlebte er.
Er erwachte und fühlte sich so schwach, dass er kaum schaffte, weiter zu atmen. Die Schmerzen waren zu einem dumpfen Pochen abgeklungen, aber er spürte deutlich die unförmige Schwellung seiner Hand. Eine Weile lag er still da und nahm die Geräusche seiner Umgebung auf.
Etwas war anders.
Es dauerte Stunden, bis es ihm gelang, die Augen zu öffnen, und die Aufregung, die daraufhin den dunklen Raum erfüllte, strengte ihn so sehr an, dass wieder das Bewusstsein verlor. Später spürte er Wasser auf den Lippen und jemand wischte den Schweiß von seiner Stirn. Dankbar leckte er die kalte Flüssigkeit auf. Ein Becher wurde an seinen Mund gesetzt und man flößte ihm vorsichtig weiteres Wasser ein.
Übergangslos fiel er wieder in Schlaf. Als er wieder aufwachte, war sein Kopf klarer und er begriff plötzlich, was sich verändert hatte: Er befand sich nicht in dem alten Kerker. Auch dieser Raum war dunkel, der Boden strohgedeckt und die Luft voller Staub. Aber die Ausdünstungen ungewaschener Körper waren weniger beißend, und es gab auch weniger Gefangene in diesem Verlies. Außerdem drang von irgendwo ein wenig Licht herein. Als er versuchte, sich aufzurichten, stützten ihm Hände den Rücken. Jemand flüsterte ein paar Worte in unbekannter Sprache und eine Gestalt hockte sich vor ihm nieder. „Endlich.“ Der Ton verriet keine Freude, eher Ungeduld.
Sehr leise und sehr schnell erklärte der andere, was geschehen war: Vor zwölf Tagen hatten die Wächter ihn in dieses Verlies gebracht, die Armwunde war grob aber fachmännisch verbunden. Ansonsten gab es nur den knappen Befehl „Seht zu, dass er lebt!“
Seitdem hatten sie ihre Rationen mit ihm geteilt, ihr Wasser an ihn verschwendet, seine Wunden gewaschen und seinen fiebernden Körper gekühlt. Galens Dankbarkeit verlor sich in der Kälte, mit der sein Zellengenosse sprach. Sie hatten es nicht aus Mitleid getan. Sein Tod hätte ihre Bestrafung, wahrscheinlich ihren eigenen Tod nach sich gezogen. Es war beinahe erstaunlich, dass sie ihn nicht hassten. Solange er nicht in der Lage war, beim Erklingen des Gongs zu stehen, gab es keine Nahrung für ihn und somit weniger für sie. Aber auch als er zwei weitere Tage benötigte, um taumelnd das erste Mal auf die Füße zu kommen, war es eher Ungeduld, mit der ihm zwei Mitgefangene schließlich unsanft beim Aufstehen halfen.
Die Zeit verging und Galen wurde langsam kräftiger. Die Nahrung in diesem Verlies war besser, als in dem anderen Kerker, wenn auch kaum reichlicher. Die acht Gefangenen waren eine Art Gladiatoren, wie sie Galen erzählten. Von Zeit zu Zeit holte man einen von ihnen heraus. Bisher waren alle mehr oder minder verletzt aber lebend zurückgekehrt.
Obwohl die Wachen hier offenbar weniger scharf auf Geräusche aus dem Verlies reagierten, gab es kaum Kontakt unter den Gefangenen. Den größten Teil der Zeit verbrachten sie in halbwachem Dämmerschlaf und die Gespräche begrenzten sich auf wenige Worte über das Essen, oder einen Fluch, wenn jemand über einen der liegenden Körper stolperte. Nur drei von ihnen sprachen überhaupt Brando, die anderen waren Barbaren aus den Bergen oder stammten aus noch ferneren Gebieten Eldorads. Der Gefangene, der ihn nach dem Aufwachen versorgt hatte, erklärte: „Es interessiert mich nicht, wer du bist. Je weniger ich dich kenne, je weniger ich von dir weiß, desto leichter fällt es mir, dich in der Arena zu töten. Ich habe nichts gegen dich, aber da draußen überlebt immer nur einer. Ich will nicht sterben, weil ich aus Sympathie zögere, jemandem den Hals zu brechen bevor er dasselbe mit mir macht.“
Tage und Wochen vergingen. Galen bemerkte es eigentlich nur daran, dass seine Verletzungen langsam abheilten. Er begann seine vom langen Liegen erschlafften Muskeln zu trainieren. Der erwartete Spott der anderen blieb aus. Sie sahen ihm unbeteiligt zu, wenn er schwitzend und atemlos Liegestützen machte, sich in Kniebeugen zwang und Bauch und Rückenmuskeln mit all den langweiligen Übungen kräftigte, die er irgendwann einmal bei seinem Fechtlehrer gelernt hatte. Seine Ketten durchflocht er mit Stroh, um das Klirren zu mindern und mehr als einmal glaubte er zu ersticken, wenn er gewaltsam sein angestrengtes Keuchen unterdrückte. Der linke Arm schmerzte noch leicht, aber es war das Handgelenk, das Galen Sorgen bereitete. Die gebrochenen Knochen waren offenbar nicht glatt zusammengewachsen und verhinderten nun, dass er mit der Hand fest zugreifen konnte.
Als man ihn das erste Mal herausholte, war er dennoch erleichtert. Man hatte ihn nicht vergessen. Es war fast ein Gefühl der Dankbarkeit, mit dem der den Wachen folgte. Wieder nahm man ihm die Ketten ab, aber diesmal bekam er ein kurzes Schwert in die Hand gedrückt, bevor er in das helle Rund der Arena trat. Sein Gegner wartete schon. Galen nahm sich Zeit. Gierig sog er die frische Luft ein. Es war kalt und sein Atem bildete weiße Wolken.
Ohne den Kopf so weit zu heben, dass er die Brüstung sehen konnte, spürte er die Zuschauer dort, nicht viele, aber doch mehr als bei seinem letzten Kampf. Er fasste seinen Gegner ins Auge und erschrak.
Es war ein Gorderley.
Und es war ein Kind - nun ein Junge zumindest, nicht älter als fünfzehn. Galen packte sein Schwert fester und schluckte. Verlangten sie von ihm, einen der Ihren zu töten. Oder war dies ein Scherz. Und wenn es kein Scherz war, konnte er ein Kind töten?
Der Junge zog sein Schert und kam mit schnellen Schritten auf Galen zu. „Stirb!“, zischte er und zielte auf Galens Hals. Die Bewegung kam schnell, aber vor allem kam sie so unwahrscheinlich leicht und flüssig, wie sie nur ein geübter Kämpfer ausführen kann. Reflexartig parierte Galen den Hieb und lenkte die Schwertspitze ab. Schon folgte der nächste Angriff und die Klingen prallten gegeneinander. Ein stechender Schmerz fuhr durch Galens Handgelenk, aber er hielt dem Druck stand und schob seinen Gegner schließlich von sich fort und rang nach Luft. Er hatte seine Muskeln kräftigen können, aber der Kerker hatte ihm jegliche Ausdauer genommen. Drei, vier heftige Angriffe wehrte er schwach ab und ließ sich rückwärts durch die Arena treiben, aber es war nur eine Frage der Zeit, wann ein Hieb des Gorderley seine Deckung durchbrechen würde. Der Junge kämpfte wie ein erwachsener Krieger und Galens einziger Vorteil war sein größeres Gewicht - obwohl es damit nach den Monaten kärglicher Nahrung nicht mehr weit her war. Galen fluchte lautlos. Er hatte noch einen Vorteil: Wer keine Ehre mehr besaß, konnte auch dreckig kämpfen....
Sein Gegner täuschte einen Ausfall nach rechts an und führte dann das Schwert in einer flachen Kurve gegen Galens linke Hüfte. Es war ein Rückhandangriff und so gut der junge Gorderley sein mochte, diesem Hieb fehlte die Wucht. Galen sah die Finte im Ansatz, wich kaum merklich zur Seite und verlagerte das Gewicht auf das linke Bein. Das Schwert des Gorderley prallte auf die blanke Schneide seines Kurzschwertes, glitt ab und streifte Galens Oberschenkel. Doch im gleichen Moment rammte Galen ihm das rechte Knie zwischen die Beine und warf sich nach vorne. Mit einem Aufschrei fiel sein Gegner zu Boden. Galen ignorierte den Schmerz im Oberschenkel und stieß dem Gorderley sein Schwert in den Magen. Sofort zog er die Klinge wieder heraus und blieb abwartend stehen. Der Junge wälzte sich am Boden und presste beide Hände über die tödliche Bauchwunde. Galen wartete auf einen Befehl, aber alles blieb ruhig bis auf das unterdrückte Stöhnen seines Gegners. Obwohl er ein Gorderley war, tat er Galen plötzlich leid. Er musste furchtbare Schmerzen haben. Warum hatte man ihn in die Arena geschickt?
Ihm kam wieder zu Bewusstsein, dass er einen Halbwüchsigen niedergestochen hatte, aber er verdrängte den Gedanken. Der Junge hatte gekämpft wie ein Krieger und seinen Tod gewollt. Die anderen Gefangenen hatten recht: Hier durfte man keine Skrupel haben. Die Arena verließ immer nur einer.
Er hob sein Schwert und stieß es dem Gorderley ins Herz.
Das Stöhnen verstummte sofort und der Körper wurde schlaff. Galen beugte sich hinab und sah in die starren wasserhellen Augen des Toten. Sanft drückte er die Lider herunter. Dann legte er sein Schwert neben den Leib und ging gesenkten Kopfes zum Tunneleingang zurück, wo er unaufgefordert seine Hände hob. Diesmal waren seine Herren offenbar zufrieden mit ihm. Die Ketten schlossen sich um seine Gelenke und er wurde ohne Schläge zurück in das Verlies gebracht. Galen fühlte sich müde. Sein Sieg brachte keine Freude und er fühlte Angst in sich aufsteigen: Was machte man mit ihm?
Von nun an holten sie ihn immer wieder. Und er gewann. Manchmal nur gerade eben, dann brauchte er Wochen, seine Verletzungen auszukurieren, manchmal auch mit spielerischer Leichtigkeit. Am überraschendsten für seine Kerkermeister war sicher sein Erfolg mit der Schleuder. Galen war sicher, dass man seinen Tod geplant hatte, denn sein Gegner trug sowohl eine Axt, als auch einen Gürtel voller Wurfpfeile. Er bekam nur eine Schleuder und eine Handvoll Metallkugeln. Für einen kurzen Augenblick blitzte ein Bild aus seiner schon fast vergessenen Vergangenheit auf, als er mit den Bauernjungen aus dem Dorf auf Hasenjagd ging. Es war lange her, aber die Hand erinnerte sich und er hatte nichts von seiner Treffsicherheit verloren. So kam es gar nicht zu einem echten Kampf. Sein Gegner mochte die dünnen Lederbänder nicht für voll genommen haben, jedenfalls stellte er sich deckungslos vor Galen, der ohne zu zögern vier Kugeln in schneller Reihenfolge abschoss. Schon die erste zerschmetterte dem anderen den Wangenknochen. Die zweite drang durch das Auge ins Gehirn, doch das fühlte er nicht mehr, weil inzwischen die dritte Kugel die Schläfe getroffen hatte. Die vierte flog vorbei, denn er lag bereits im Sand und atmete nicht mehr.
Meistens jedoch waren seine Siege weniger spektakulär, mühsam erkämpft und oft nur Ergebnis eines schmutzigen Tricks. Er war lange darüber hinaus, sich dessen zu schämen. Je länger er überlebte, desto mehr begann er, den Kampf zu lieben. Dort draußen gab es Licht und Luft, in der Arena war er frei, konnte leben und sogar denken. Das konnten ihm nicht einmal seine Wächter nehmen.
Dachte er.
Sein letzter Kampf war so lange her, dass Galen sich kaum noch daran erinnern konnte. Bei jedem Gong sprang er voller Erwartung auf, doch immer wurden andere ausgewählt.
Er sehnte sich nach dem Licht der Arena, dem schnellem Atem und dem pochenden Herzen in den Augenblicken der Todesgefahr, und die Dunkelheit des Kerkers wurde immer erdrückender. Am liebsten hätte Galen bei den Wachen darum gebettelt, wieder kämpfen zu dürfen, aber das war natürlich völlig sinnlos und würde eher seinen sofortigen Tod nach sich ziehen. Und so wartete er, hoffend, den anderen sogar ihre Wunden neidend.
Als man ihn dann endlich holte, sprang er die Stufen zum Gang so hastig hinauf, dass er stolperte und gerade noch das Gleichgewicht halten konnte. Sein Herzschlag beschleunigte sich vor unterdrückter Aufregung und als der Befehl zum Anhalten kam, hob er ungeduldig die Hände, damit man ihm die Ketten abnahm.
Endlich!
Gierig griff er nach der Axt, die ihm eine Hand reichte und der auffordernde Stoß der Wache erreichte ihn schon nicht mehr, so schnell trat er durch das Tor in die Arena.
Es war ein herrlicher Frühlingstag und flüchtig kam Galen der Gedanke, dass er bereits ein Jahr in den Kerkern dieser Burg zugebrachte. Tief einatmend blickte er zum strahlend blauen Himmel hinauf und ließ den Blick langsam über die grauen Mauern schweifen. Auf den Zuschauerrängen lümmelten sich nur einige Krieger und er vermied, sie genauer zu fixieren. Die Sonnenstrahlen malten helle Kringel auf die Steine und ließen die Mooskissen in den Fugen hellgrün leuchten. Mit zusammengekniffenen Augen starrte Galen in die Sonne und fühlte, wie sie warm sein Gesicht streichelte. Ein scharrendes Geräusch lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Umwelt. Durch das zweite Tor war sein Gegner eingetreten, ein kleiner Mann, aber offenbar kräftig und im Umgang mit dem Kurzschwert geübt. Federnd bewegte er sich auf Galen zu. Der ließ sich Zeit. Er hatte keine Angst und empfand beinahe Sympathie für den Mann, den er gleich töten würde. Aber bis dahin konnte er noch kostbare Sekunden warten, Augenblicke dieses hellen Tages einfangen, die ihm helfen würden weiter zu leben, wenn sie ihn wieder einsperrten.
Bewegungslos ließ er zu, dass sein Gegner in seinen Rücken gelangte. Er lauschte auf das scharfe Einatmen, dass den Beginn des Angriffs verraten würde.
Dann ging alles blitzschnell. Natürlich hatte der andere auf seinen scheinbar ungeschützten Hals gezielt, und er war sogar auf eine Abwehr gefasst gewesen. Nur deshalb traf ihn Galens Axt nicht sofort tödlich. Die Schneide prallte auf den Hüftknochen und zerschmetterte ihn, während Galen der Schwertklinge geduckt auswich. Er machte nicht den Versuch, seine Waffe herauszuziehen, sondern hämmerte dem verblüfften Angreifer beide Fäuste in das Gesicht. Schreiend ließ der Mann sein Schwert fallen und versuchte mit einer Hand die Axt aus seinem Unterleib zu reißen, während er mit der anderen die zerbrochene Nase bedeckte.
Galen hob das Schwert auf und ließ sich Zeit zu einem einzigen sauberen Hieb, der das Genick des anderen durchtrennte.
Das Schreien brach abrupt ab. Galen sah auf den Toten hinab, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Langsam sank er in die Knie und legte das Schwert zu Boden. Seine Hände tasteten nach dem feinkörnigen Sand, der warm durch seine Finger rieselte. Er wusste, dass man ihn bestrafen würde, aber er konnte jetzt einfach nicht sofort zurück in die Dunkelheit des Kerkers.
„Komm her!“
Er wartete noch zwei kostbare Atemzüge lang, bevor er sich erhob, Zeit, für die er würde bezahlen müssen, aber die ihm jeden Schmerz wert schien.
„Komm her!!“ Deutlich schwang Ärger in der Stimme, die sein Leben regierte, aber Galen beeilte sich nicht. Bevor er in den Schatten der Mauern eintauchte, blieb er noch einmal stehen und legte den Kopf in den Nacken. Ein kleiner Vogel schwirrte durch die Arena, landete auf der Holzbrüstung vor den Zuschauerrängen und schaute schwanzwippend herab. Mit einem Triller hüpfte er wieder in die Luft und verschwand zwischen den Mauern. Galen schluckte und ließ es zu, dass sich dieser Augenblick in ihm ausbreitete und ihn ganz und gar erfüllte. Dann erst trat er in den Schatten des Kellerganges. Die Ketten schlossen sich um seine Handgelenke und er spannte die Rückenmuskeln an, aber der erwartete Schlag blieb aus.
Galen spürte die Anwesenheit der Wachen und irgendwo vor ihm stand „die Stimme“, aber nichts geschah. Plötzlich packte ihn panische Angst. Warum schlugen sie ihn nicht? Was hatten sie vor?
Die Stimme sagte etwas, dass Galen nicht verstand und im selben Moment brachte ein einziger Tritt ihn zu Fall. Er wollte sich aufrichten, aber ein harter Hieb auf den Kopf nahm ihm für Sekunden das Bewusstsein und dann schleiften ihn grobe Hände den Gang hinab zu den Verliesen. Schließlich ließen ihn die Wachen fallen. „Aufstehen!“, befahl die Stimme. Er kam taumelnd auf die Beine und erkannte im unruhigen Licht der Fackeln eine kniehohe Mauer, offenbar ein Brunnenschacht. „Nein“, keuchte er und wollte zurückweichen, aber ein Stockhieb stieß ihn voran und im nächsten Augenblick stürzte er über die Kante. Seine linke Hand prallte schmerzhaft auf gegen die Wand, dann fiel er in die Schwärze.
Galen durchschlug die Wasseroberfläche und kam kaum gebremst auf dem Grund auf. Panisch wand er sich um die eigene Achse und rang nach Luft. Sofort drang Wasser in seine Lungen und der Schmerz erfüllte ihn mit Todesangst. Sie wollten ihn ertränken! Wild schlug er um sich und plötzlich war Luft da. Spuckend und hustend gelang es Galen, den Mund über der Wasseroberfläche zu halten. Erst ganz langsam wurde ihm klar, dass er auf dem Boden kniete und er richtete sich auf.
Das Wasser reichte ihm gerade bis zur Hüfte.
Galen zitterte am ganzen Leib. Das Gefühl des sicheren Todes war noch zu frisch und es dauerte lange, bis sich sein keuchender Atem beruhigte. Vorsichtig begann er, sein Gefängnis zu ertasten. Es war stockdunkel und von außen drang kein Geräusch zu ihm herunter. Er konnte nicht einmal erkennen, ob die Wachen den Brunnen abgedeckt hatten.
Der Brunnenschacht hatte vielleicht zweieinhalb Meter Durchmesser und schien direkt in den Felsen geschlagen zu sein, unter seinen prüfenden Fingerspitzen waren keine Fugen oder Mauersteine zu ertasten. Es gab keine Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten, um denn Schacht empor zu klettern, Galen hatte es auch nicht wirklich erwartet.
Als er ein weiteres Mal über die Wände strich, stieß er knapp oberhalb des Wasserspiegels auf eine Kante. Ein Felsstück ragte eine Unterarmlänge in den Brunnen hinein, gerade breit genug, um darauf zu sitzen. Galen schwang sich hinauf und klammerte sich an der Wand fest. Das Wasser tropfte leise von seinen Beinen. Vorsichtig entspannte er sich ein wenig, immer darauf bedacht, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Das Blut pochte in seiner geschwollenen Hand und Galen ließ sich wieder in das Wasser gleiten, um sie zu kühlen. Wahrscheinlich war sie erneut gebrochen.
Die Zeit verging, ohne dass er feststellen konnte, wie lange die Dunkelheit andauerte. Es mochten Stunden sein, aber bald schien seine Haft Tage zu dauern und schließlich vermochte er sich kaum noch daran zu erinnern, wann man ihn in den Brunnen geworfen hatte. Unzählige Male fiel er von der schmalen Kante ins Wasser, wenn er für Minuten einnickte. Er flehte in den Schacht hinauf um Gnade, schrie, bettelte bis er heiser war, aber nicht ein Mal zeigte sich ein Gorderley.
Hunger, Dunkelheit und Nässe krochen in ihn hinein und füllten ihn aus. Anfangs wehrte er sich noch, beschwor die Erinnerung an den hellen Himmel, die wärmende Sonne herauf, rief sich den fröhlichen Triller des Vogels ins Gedächtnis und vertrieb damit für Minuten die lähmende Finsternis. Aber je länger er dort saß, desto mehr verlor die Erinnerung an Farbe und Wärme. Es war nicht so, dass er irgendetwas vergaß, er sah noch immer jedes Detail vor sich, den rauen Stein, den feinkörnigen Sand, die Maserung des Geländers der Brüstung… alles war gegenwärtig. Aber es begann zu verblassen, und schließlich begriff er.
Galen erinnerte sich nicht, jemals geweint zu haben, aber nun traten ihm die Tränen in die Augen. Er ließ sie fließen, während er an der feuchten Wand lehnte und den Fels an der Wange spürte. Mit offenen Augen starrte er in die Dunkelheit und ließ wehrlos die Leere in sich einziehen. Und er stand noch lange dort, als die Tränen versiegt waren und eine salzige Schicht auf seinen Wangen hinterlassen hatten.
Stunden lehnte er im Wasser an der Wand, dann kletterte ein um das andere Mal auf die Kante, um der Nässe für kurze Zeit zu entrinnen. Es kostete ihn keine Überwindung mehr, von dem Wasser trinken, in das er sich entleerte. Er dachte an nichts mehr und erwartete nichts mehr.
Irgendwann erklangen Stimmen und dann erhellte ein schwacher Schein die Dunkelheit. Der Sklave starrte mit gesenktem Kopf auf die Wasseroberfläche. Polternd entrollte sich eine Strickleiter und baumelte schließlich neben ihm. „Komm herauf!“
Die erste Querlatte befand sich in Hüfthöhe. Der Sklave griff nach den Seilen und holte tief Atem, bevor er versuchte, sich mit einem Ruck aus dem Wasser zu schnellen und die erste Stufe zu erreichen. Mit letzter Kraft klemmte er ein Knie zwischen zwei Querhölzer und stützte sich ab, bis der andere Fuß Halt fand. Sein Herz raste vor Anstrengung und seine Arme zitterten so sehr, dass er sich kaum festhalten konnte. Vor seinen Augen wirbelten schwarze Schatten, aber er zögerte keine Sekunde, sich weiter hinauf zuziehen. Seine Schulter schabte an der Wand entlang, während er langsam von einem Tritt zum nächsten kletterte. Es gab nichts mehr in der Welt als diese rauen Seile in seinen Fäusten und die scheinbar meterweit auseinander liegenden Tritte, die er irgendwie bezwang. Er bemerkte kaum, dass es heller um ihn wurde und die Fugen des gemauerten Randes vor ihm auftauchten. Plötzlich hörte die Leiter auf: Er hatte die Kante erreicht. Es war nicht seine eigene Kraft, die ihn auf die Mauer hievte, sondern nur noch der Wille der Stimme. Einige Sekundenbruchteile lag er ausgestreckt dort, dann glitt er herunter und lag auf dem Boden.
„Steh auf“.
Er gehorchte, obwohl er zu schwach war, um zu stehen, zu schwach, um irgendwohin zu gehen, aber er wusste mit einer Sicherheit, die jeden anderen Gedanken ausschloss, dass er dennoch solange hier stehen würde, bis die Stimme ihm etwas anderes befahl.
Minuten vergingen schweigend.
Der Stockmeister und sein Gehilfe betrachteten den Sklaven, der mit gesenktem Kopf und hängenden Armen neben dem Brunnen verharrte. Schließlich nickte der Stockmeister und befahl halblaut. „ Vorwärts!“ Zwei Wachen begleiteten den Sklaven in den Gang.
„Er ist soweit, nicht wahr?“ Der Gehilfe zog die Strickleiter herauf.
Der Stockmeister blickte dem Sklaven nach, der jetzt hinter einer Biegung des Ganges verschwand. „Vielleicht. Wir werden sehen, wie er sich beim nächsten Mondwechseltag macht.“ Er rieb sich die Hände. Man wusste nie, wie sich ein Sklave entwickelte, aber dieser schien die Mühe wert zu sein, ihn gut abzurichten. Trotzdem, rief er sich selbst zurecht, die letzte Probe fehlte noch. Das würde wieder einmal ein interessanter Mondwechseltag werden.
Wieviel Zeit war vergangen?
Irgendwann holte man ihn in den Gang hinaus. Gesenkten Kopfes trabte der Sklave vor den Wachen her. Der Gang unter seinen Füßen nahm heute einen anderen Lauf und als man ihm die Ketten abgenommen hatte und er die Arena betrat, befand er sich in einem großen, etwa vierzig Schritte durchmessenden Rund. Über den hohen umlaufenden Steinwänden erhoben sich mehrere Reihen Zuschauerränge auf denen sich Menschenscharen drängten. Der Blick des Sklaven glitt nur flüchtig zu ihnen hinauf, bevor er sich auf seinen Gegner konzentrierte.
Auch der andere trug keine Waffen. Er war hochgewachsen und sah ihm aufmerksam entgegen. Der Sklave näherte sich langsam. Die Kleidung seines Gegners war nur noch in Fetzen vorhanden, aber er erkannte trotzdem die Uniform der königlichen Garde und erschrak. In diese Eliteeinheit des Königs von Brandai wurden nur die Edelsten der Edlen aufgenommen. Nicht nur konnten sie ihr Geschlecht nach Möglichkeit bis in die Tage der Großen Schlacht nachweisen, sie waren auch die Besten im Kampf, ob zu Pferd oder zu Fuß. Der Sklave ballte unwillkürlich die Fäuste. Wie sollte er mit bloßen Händen einen Krieger der Garde auch nur gefährden?
Der andere sagte etwas und nach einem Augenblick des Besinnens verstand der Sklave die Worte. „Ich grüße dich, Kamerad.“
Er antwortete nicht, sondern wandte sich seitwärts, um den Brandai zu umkreisen. „Lass uns dieses Spiel verweigern. Sie können uns töten, aber sie können uns nicht unsere Ehre nehmen.“ Die Stimme klang beschwörend und der Sklave hielt inne. Der andere trat einen Schritt auf ihn zu und sprach weiter: „Wir sind Brandai, Kamerad. Bei allem, was sie dir angetan haben kannst du das nicht vergessen haben. Ein Ritter des Königs stirbt lieber, als sich zum Spielzeug dieser ehrlosen Rebellen zu machen.“
Der Sklave schnellte voran, aber der Ritter wich mit einem eleganten Seitschritt aus. Vorsichtig umkreisten sich die beiden Männer. Als der Sklave wieder vorsprang, wehrte ihn der Brandai mit einem Hieb ab, der ihn zu Boden schleuderte. Der Sklave rollte sich instinktiv ab und kam federnd wieder auf die Beine, bereit sich zu verteidigen, aber sein Gegner stand ruhig in der Arenamitte und betrachtete ihn voller Verachtung. „Ich sollte dich töten, du Verräter, aber damit mache ich mir die Hände nicht dreckig. Es ist eine Schande, dass so ein Abschaum in Brandais Armee dient.“
Ein Pfeil bohrte sich neben seinen Fuß in den Boden, ein zweiter streifte den Arm des Sklaven.
Der Ritter lachte höhnisch, zerbrach mit einem Fußtritt den Schaft und sah in die Menge der Zuschauer. „Tötet mich doch!“, rief er herausfordernd.
„Es gibt Schlimmeres“, sagte der Sklave leise.
„Aber nicht hier. Hier wollen sie Blut sehen. Welch ein Spaß, wenn sich ihre Erzfeinde gegenseitig umbringen.“ Er sah den Sklaven mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung an. „Du glaubst doch nicht, dass du am Leben bleibst, wenn du mich tötest?“
Ein weiterer Pfeil blieb federnd zwischen ihnen stecken, der nächste würde treffen. Der Sklave trat einen Schritt näher, noch einen und murmelte: „Aber was soll ich tun?“ „Du solltest...“, diesmal kam der Angriff überraschend. Der Sklave sprang dem Brandai gegen die Knie und schlug den abwehrenden Arm des anderen zur Seite. Dann schlossen sich seine Hände um den Hals des Ritters. Doch der Erfolg dauerte nur Sekundenbruchteile. Sein Kopf wurde nach hinten gerissen und Finger legten sich auf seine Augen. Mit einem Aufschrei ließ er sich zurückfallen. Wieder folgte kein weiterer Angriff. Der Ritter stand über ihm. „Bastard!“
Der Sklave zuckte zusammen. Die Verachtung des Ritters traf etwas in ihm, dass er nicht mehr kannte. Vorsichtig richtete er sich auf und kniete im Sand. Er wusste, dass man sie in wenigen Minuten beide töten würde und spürte, wie sich seine Nackenhaare in Panik aufrichteten. Der Ritter schwieg jetzt, ließ ihn aber nicht aus den Augen. Er schien keine Angst zu haben, dass sein Gegner ihm wirklich schaden könnte. „Ich muss gegen Euch kämpfen“, stöhnte der Sklave und stand auf. Beinahe gelangweilt ließ ihn der Krieger ins Leere laufen. Der Sklave stolperte und wurde von seinem eigenen Schwung zu Boden gerissen.
„Bemühe dich nicht. Wenn du es nicht freiwillig tust, zwinge ich dich, wie ein Brandai zu sterben.“ Höhnisch ließ der Ritter den Blick über die Galerie schweifen und suchte nach den Bogenschützen. „Worauf wartet ihr noch, Rebellenhunde“, schrie er hinauf.
Der Sklave hockte vornüber gebeugt da und sah zu dem Mann hinauf. Dann stieß er zu. Mit verzweifelter Kraft trieb er die Pfeilspitze durch das zerfetzte Hemd des Brandai in dessen Bauch.
Ungläubig weiteten sich die Augen des Ritters und er tastete fahrig nach dem Schaft. Mit einem letzten Stoß rammte der Sklave die Spitze tiefer in den Körper und ein Schwall Blut ergoss sich über seine Arme. Die Wunde war tödlich, aber der Verletzte brach nicht zusammen. Schwankend blieb er stehen und umklammerte mit einer Hand die Wunde. Er schrie nicht, stöhnte nicht einmal, als er endlich auf die Knie sackte. Die ganze Zeit wich sein Blick nicht von dem Sklaven, der einen Schritt zurückgetreten war und wie gelähmt dastand. Endlich brach der Blick und der Brandai fiel vornüber in den Sand.
Der Sklave schluchzte trocken auf. „Stirb in Ehre, Ritter“, flüsterte er, „ich will leben.“
Er wartete nicht die Aufforderung der Stimme ab, um zum Tunneleingang zurückzugehen.
Wieder war es ein anderer Gang, den man ihn entlang trieb. Er bemerkte es unbeteiligt. Ein Gong ertönte, eine Türe tat sich auf, er stolperte in die Dunkelheit eines neuen Kerkers.
Die Gorderley liebten nichts mehr, als einen guten Kampf, ob sie selbst beteiligt waren, oder nur zusahen. Es war eine der Aufgaben der Stockmeisters, die Arenasklaven zu trainieren, damit die Schaukämpfe an den Mondwechseltagen nicht zu bloßen Blutbädern ausarteten. Den notwendigen Eifer gab den Sklaven das Wissen, dass stets nur der Sieger eines Kampfes die Arena lebend verließ. Das Training bewirkte, dass diese Sieger im Allgemeinen auch den ästhetischen Ansprüchen der Bewohner und Besucher Burg Witsteins genügten. Der Stockmeister war zu dem Schluss gekommen, dass dieser brandaianische Sklave gute Anlagen besaß und viele Jahre erfreuliche Kämpfe bieten könnte.
Und so begann das Training. Tag für Tag holte man den Sklaven aus dem Verlies, ohne dass er jemals eine Waffe in die Hände bekam. Er musste rennen und springen, bis er zusammenbrach, warf sich hunderte Male in den Staub, nur um auf den nächsten Befehl wieder aufzuschnellen, hing an Klimmzügen, stemmte Gewichte, wippte stundenlang auf Zehenspitzen und Fingern im Liegestütz,...hätte er sich erinnern können, wären ihm die Übungen seines alten Fechtmeisters kindisch vorgekommen.
Niemals gönnte ihm die Stimme Ruhe, solange er in der Arena war. Und sofort krallte sich die Peitsche der Gehilfen in seinen Rücken, wenn es nur den Anschein hatte, er schone sich. Der Sklave lernte schnell, bei allem, was man ihm befahl, stets das letzte zu geben. Oft schleppten ihn andere Sklaven zurück in den Kerker, wenn er irgendwann unter der Anstrengung zusammenbrach. Aber je länger sie ihn quälten, desto zäher wurde er. Seine Bewegungen wurden weicher, seine Kräfte beherrschter und sein Vermögen, Schmerzen zu ignorieren mit jedem Monat größer. Irgendwann kam der Tag, an dem man ihm wieder ein Schwert gab.
Der Stockmeister ließ sich fast ein Jahr Zeit, um den Sklaven zu schulen, aber schließlich gab es kaum eine Waffe, die er nicht beherrschte und seine Reflexe waren die eines wachen Berglöwen. Es war nur noch selten nötig, ihn zu strafen und dadurch in Gefahr zu laufen, dass er starb. Der Einsatz zahlte sich aus, als man ihn bei den Mondwechselkämpfen einsetzte. Nach einiger Zeit begannen die Zuschauer ihn sogar zu vermissen, wenn er wegen einer Verletzung nicht antrat, denn seine technischen Fähigkeiten wie sein Kampfeifer fanden ihre Anerkennung. Er wurde mit den Jahren gut genug, um als Trainingspartner für die einfachen Söldner des Heeres zu dienen, die einzigen Kämpfe, die er lebend überstehen konnte, ohne siegen zu müssen.
Dünner Nieselregen fegte über den feuchten Sand. Das Klirren der Waffen klang heute dumpf und die Bewegungen der kämpfenden Männer schienen müder als üblich. Die Gehilfen setzten immer wieder ihre Peitschen ein, um die Sklaven anzutreiben. Der Stockmeister blickte von seinem Podest in das Rund. Ohne die einzelnen Sklaven genau wahrzunehmen, entging ihm kaum eine Bewegung. Hin und wieder wies er mit einem kurzen Befehl oder einer Handbewegung auf eine der kämpfenden Gruppen, worauf der Obergehilfe schnell einschritt, korrigierte oder strafte. „Er macht seine Sache nicht schlecht“, dachte der Stockmeister, aber ohne in seiner Aufmerksamkeit nachzulassen, beschäftigte etwas anderes seine Gedanken. Die Nachrichten aus dem Osten waren besorgniserregend. Jetzt, wo ein Großteil des Heeres an der Grenze zum Königreich gebunden war, waren Barbaren in Gorderley eingefallen, unerwartet früh, denn der Schneefall hatte noch nicht eingesetzt, und auch erstaunlich gut geführt. Sie hatten einige Güter überrannt, das östliche Bergland in Schutt und Asche gelegt und marschierten auf Qualinn zu. Die Bauernfreischaren hatten den Ansturm bremsen können, aber die Gefahr, dass die Stadt gestürmt wurde, war nicht von der Hand zu weisen. Die Vorstellung war unerträglich und der Stockmeister bedauerte zum ersten Mal, dass ihn seine Aufgabe in der Burg festhielt.
Sein Blick blieb an einer Zweiergruppe hängen. Der riesige Ostländer war ein nicht zu unterschätzender Gegner für den brandaianischen Sklaven, der eben einem mächtigen Hieb geschickt auswich und dem Barbaren mit der Spitze seines Schwertes eine feine Blutspur über den Rücken zog, die sofort auf der regennassen Haut zerlief.
Dennoch konnte er den Vorteil nicht nutzen, denn der Barbar schlug in einer kreisenden Bewegung sein Schwert zur Seite und die Wucht des Angriffs ließ den Brandai zurück taumeln. Es war eigentlich eine schöne Abfolge, aber dennoch störte den Stockmeister etwas. Er sprang von dem Podest, schritt zu dem Paar und befahl halblaut „Stad“. Der Brandai brach mitten in seiner Abwehrbewegung ab. Der Ostländer reagierte nicht so schnell. Seine Axt fuhr ungehindert auf den Hals seines wehrlosen Gegners zu. Der Stockmeister fing die Klinge mit seinem Schwert eine Handbreit vor dem Sklaven ab. Sein Gehilfe war schon heran und schlug den ungehorsamen Barbaren mit dem Stock zu Boden. Der Regen wusch das Blut der Platzwunden ab, als ihn zwei Arbeitssklaven fort schleppten. Der Stockmeister rief ihnen einige Anweisungen nach, in diesem Fall war eine Lektion in Gehorsam fällig.
Dann wandte er sich dem Brandai zu, der mit gesenktem Kopf bewegungslos stehen geblieben war. Dieser hatte seine Lektion schon hinter sich, und er hatte sie gut gelernt. Nichts an der Gestalt verriet Aufsässigkeit, Ungeduld, nicht einmal Erleichterung, dem Tod gerade noch entronnen zu sein. Er wartete einfach auf den nächsten Befehl. Der Stockmeister ging langsam um ihn herum und fragte sich, ob er nur überreizt war und Gespenster sah. Warum sollte ausgerechnet dieser Sklave, einer der problemlosesten, Zeichen von Widerstand zeigen. Er hatte seine Umkreisung beendet und musterte ihn genau. Das Wasser tropfte aus den nassen Haaren herab, es wurde Zeit, ihn zu scheren, sonst würde er Läuse bekommen, bemerkte der Stockmeister, aber seine Aufmerksamkeit galt mehr dem Gesamtzustand des Sklaven. Er suchte nach verräterisch gespannten Nackenmuskeln, nach einem leichten Zittern der Knie, lauschte auf ein gepresstes Einatmen, alles Anzeichen von geheimen Gedanken, die immer zu Ärger führten. Aber er konnte nichts entdecken. Gäbe es etwas zu verbergen, wäre der Sklave längst nervös geworden, sagte sich der Stockmeister. Trotzdem war er nicht zufrieden. „Lass ihn laufen!“ befahl er seinem Gehilfen.
„Renn“, ein leichter Peitschenhieb begleitete den Befehl und der Sklave ließ sein Schwert fallen und rannte los.
Eine Runde, zwei, drei, in der vierten Runde stolperte er das erste Mal, fing sich aber und lief weiter. Sein Tempo ließ nach, aber der Stockmeister schüttelte den Kopf, als der Gehilfe fragend die Peitsche hob. Erst als der Sklave das erste Mal stürzte, ließ er ihn beim Aufstehen antreiben. Der Brandai keuchte und holte krampfartig Luft, aber er taumelte immer weiter durch die Arena. Irgendwann schaffte er es nicht mehr, sich aufzurichten. Unter den Hieben der geflochtenen Lederpeitsche zog er sich auf Knien und Händen voran, dann Fuß für Fuß auf den Ellbogen, bis er schließlich zusammenbrach.
Dunkelheit. Schmerz. Dazwischen das Wort. Galen. Es verbiss sich in seinen Kopf. Der Sklave war zu schwach, sich zur Wehr zu setzen. Es kam immer wieder, überwand den Dämmerzustand, in dem er die Stunden im Verlies zubrachte, brachte ihn um den Schlaf und tauchte sogar in wirren Träumen auf, an die er sich nicht erinnern konnte, die ihn aber mit Sorge erfüllten.
Galen. Das Wort lenkte ihn ab, und das war gefährlich. Solange er wach war, versuchte er es zu verdrängen, aber jetzt forderten die Schmerzen seine ganze Kraft und das Wort drängte sich ungehindert heran. Ein dumpfer Gong ertönte und der Sklave erhob sich schwerfällig. Licht schien vom Gang in das Verlies als eine Wache eintrat. Der Sklave schwankte leicht und hoffte, dass der Gorderley nicht bemerkt hatte, wie spät er sich aufgerichtet hatte. Die Wache verhielt einen Atemzug lang neben ihm und er spannte die Muskeln in Erwartung eines Schlages, aber dann hörte er den kurzen Befehl und einer der anderen Sklaven wurde geholt. Als sich die Tür schloss, sank er erleichtert auf das Stroh zurück.
Er musste schlafen. Wenn er schlief konnten die Wunden heilen und er sammelte Kräfte. Die Striemen auf seinem Rücken brannten, aber die Erschöpfung war sein größerer Feind. Sein Leben erlaubte keine Kraftreserven, er brauchte seine ganze Energie für den Kampf. Im Augenblick konnte er kaum stehen, jeder Gegner würde ihn mit dem ersten Stoß nieder werfen. Und das war der Tod. Er brauchte Zeit und Schlaf. Schlaf und Zeit, Schlaf...
Galen.
Er stieß seinen Kopf auf den Boden auf, damit der Schmerz das Wort vertrieb. Diesmal funktionierte es und er schlief ein.
Er erwachte, ohne dass es einen Grund gab. Einen Moment lang glaubte er, den Gong überhört zu haben, aber in dem dunklen Raum gab es kein Geräusch außer dem Atmen der Sklaven und einem gelegentlichen Rascheln, wenn sich jemand anders hinlegte.
Leise stand er auf, nicht einmal die Ketten klirrten, als er zum Wassertrog ging und einige Schlucke schöpfte. Ein leichter Schwindel zwang ihn, sich zu setzten und er lehnte den Kopf gegen die Holzwanne. Galen. Es war beinahe, als bedeute ihm das Wort etwas. Es schien ihm jetzt weniger bedrohlich, weniger bohrend in seinem Kopf zu schweben. Er holte tief Luft und zwang sich, zu seinem Platz zurückzugehen. Sein Herz schlug schnell - er war noch lange nicht erholt genug, um wieder kämpfen zu können.
Er musste dieses Wort loswerden, sonst würde es ihn das Leben kosten. Die Strafe, die er bekommen hatte, war auch eine Folge dieses Wortes. Zum ersten mal hatte es sich in seinen Kopf eingeschlichen, während er in der Arena stand. In einem echten Kampf hätte der kurze Moment sein letzter sein können. Natürlich war es der Stimme aufgefallen. Das Wort war sofort wieder verschwunden und er hatte den plumpen Angriff seines Gegners abwehren können und auch sofort auf den leisen Befehl der Stimme reagiert, aber es war zu spät gewesen.
Das durfte nicht wieder geschehen. Wenn ihn seine Gegner nicht töteten, würden es die Strafen für seine Unaufmerksamkeit tun. Als er die Augen schloss, konzentrierte er sich mit aller Kraft darauf, an seine Genesung zu denken, bis ihn wieder die Dunkelheit des Schlafes umfing.
Sie waren gnädig genug, ihm Zeit zu lassen. Der Sklave war sich der besonderen Aufmerksamkeit bewusst, mit der die Stimme ihn beobachtete, und verbannte jeden ablenkenden Gedanken aus seinem Kopf. Konzentriert führte er jede Waffenübung durch und forderte sich schonungslos bis zur Erschöpfung in den langen Trainingsstunden. Trotzdem schien es ihm, als hätte er noch nie so viele Schläge erhalten, wie in diesen Wochen. Die Wachen waren überaus gereizt und griffen bei der kleinsten Verfehlung zu ihren Stöcken. Auch in ihrem Kerker wurde nun jedes lautere Geräusch durch unbarmherzige Auspeitschungen bestraft und mehrere Sklaven wurden hingerichtet, weil sie gegen die strengen Regeln ihres Lebens verstoßen hatten. Einmal wurden alle Kampfsklaven in der großen Arena versammelt. Die Mauerkante war besetzt mit Bogenschützen, und schwer bewaffnete Gorderleyritter überwachten jede Bewegung.
Ein Sklave wurde hingerichtet.
Er hatte unvorsichtig einer Wache ins Gesicht geblickt. Nun hing er angekettet in einem Wasserbecken und ruderte verzweifelt mit den Armen. Die Ketten hielten ihn von den Rändern entfernt und er kämpfte darum, nicht unterzugehen. Es war ein langsames Sterben, Stunde um Stunde sahen sie dem Unglücklichen zu. Irgendwann verließen ihn die Kräfte und er tauchte unter. Mehrmals gelang es ihm noch, den Kopf über die Wasseroberfläche zu stoßen, aber schließlich versank er. Das Regiment der Gorderley wirkte sogar hier noch, mit Ausnahme des Keuchens gab er keinen Laut von sich.
Der Sklave bewegte vorsichtig die Zehen, die in der Kälte gefühllos geworden waren. Diese Hinrichtung erinnerte ihn daran, wie leicht man hier starb. Ein falscher Blick, eine unbedachte Bewegung reichte aus, um das Todesurteil zu besiegeln. Es dauerte noch einige Zeit, bis die Wachen die Sklaven zu ihren jeweiligen Verliesen trieben. Er versuchte das Zittern zu unterdrücken und starrte auf den Sand zu seinen Füßen. Galen. Er zuckte zusammen. Es kam so plötzlich, gerade jetzt, dass er fast aufgesehen hätte, um festzustellen, wer das verräterische Wort gesprochen hatte. Zum Glück waren die Gorderley zu beschäftigt, um seine überraschte Bewegung zu sehen. Nun kam auch für seine Gruppe der Befehl und sie liefen dicht gedrängt in den Tunnel.
Als sie wieder in ihrem Verlies lagen, breitete sich das Wort aus. Galen Galen Galen. Als hätte sich eine Schleuse geöffnet, überflutete ihn, was er wochenlang mühsam verdrängt hatte. Er presste die Hand auf den Mund und biss in den Ballen, um nicht zu stöhnen. „Was willst du?“, fragte er flüsternd, „was bei den Unsterblichen willst du?“
Und Galen verschwand und hinterließ Leere. Der Sklave lauschte in sich hinein und sann über seinen letzten Satz nach. Er hatte die Unsterblichen angerufen. Aber die Unsterblichen gehörten nicht zu seiner Welt, die Unsterblichen gehörten nach… Brandai.
Obwohl er sich darüber klar war, dass er aus Brandai stammte, verband er nichts mehr damit. Auch Brandai war fern… Er glitt in einen leichten Dämmerschlaf, aber ein Teil von ihm war hellwach und dachte weiter. Galen war ein Brandai. Galen war ein Ritter gewesen. Er wusste plötzlich, wie es war, ein Ritter zu sein, aber das Gefühl schien zu jemand anderem zu gehören, der ein kleines Stück neben ihm stand.
In den folgenden Wochen geschah es immer wieder, dass er plötzlich durch die Augen eines Fremden sah. Nur Sekundenbruchteile, zu kurz, um etwas wahrzunehmen aber lang genug, um ihn zu beunruhigen. Es war fast ein Wunder, dass die Gorderley nichts bemerkten. Er wurde zweimal ausgepeitscht, aber immer aus anderen, nichtigen Gründen. Und dann holte man sie überhaupt nicht mehr in die Arena.
Der Gong ertönte und die Kerkertüre wurde so rasch aufgerissen, dass die Sklaven kaum rechtzeitig auf die Beine kommen konnten. Der Gang war durch Fackeln hell erleuchtet und der Schein reichte in das Verlies hinein, so dass der Sklave zum ersten Mal den ganzen Raum erkennen konnte. Sofort senkte er den Kopf, denn zwei Gorderley sprangen die Stufen hinab. Sie hielten ihre Kurzschwerter in der rechten und die Stöcke in der linken Hand und der Sklave spürte ihre Nervosität. Es war erlösend, den kurzen Befehl zum Vorwärts gehen zu vernehmen. Er achtete darauf, weder zu schnell noch zu langsam die Stufen hinaufzusteigen und in den Gang zu treten. Nach wenigen Metern stoppte ihn ein weiterer Befehl. Am ganzen Körper angespannt blieb der Sklave stehen und als sich ein Gorderley neben ihn kniete, schloss er hastig die Augen. Dann spürte er die Fußschellen um seine Knöchel. Eine dumpfe Erinnerung jagte ihm durch den Kopf und war wieder fort.
Mit leisem Klirren bewegte sich der Zug durch die unterirdischen Gänge. Der Sklave war die Wege zu den beiden Arenen so unzählige Male gegangen, dass er jede Bodenunebenheit kannte. Er merkte, dass man sie durch andere Tunnel führte, über Treppen und Rampen, bis sie einen Hof erreichten, in dem ein Wagen stand. Zehn Sklaven kletterten auf die Ladefläche, in deren Mitte ein Gerüst aufgebaut war, an dem man ihre Handschellen befestigte. Zu beiden Seiten des Wagens waren Haken angebracht und der Sklave pries sich glücklich zu denen zu gehören, die dort angekettet wurden und laufen durften, denn für ihn befanden sich die Haken in Schulterhöhe, während das Gerüst die Unglücklichen auf dem Wagen zwang, die Arme in Kopfhöhe zu halten, wenn sie nicht aufrecht dem Gerüttel stand halten wollten.
Die Gorderley verloren keine Zeit. Sobald alle Sklaven angekettet waren, rollte der Wagen an. Kaum verließen sie den geschützten Hof, fegte eisiger Wind über sie hinweg. Galen. Kälte. Durst. Wieder blitzte eine Erinnerung auf, die nicht ihm gehörte. Diesmal schenkte er ihr keine Beachtung. Es war lebenswichtig, nicht zu stolpern. Es war lebenswichtig, weiterzulaufen, auch wenn man im Schneematsch ausrutschte. Und wenn es doch geschah, war es entscheidend, den Blick irgendwie auf den Boden zu heften und unter der Peitsche wieder auf die Beine zu kommen.
Nach einigen Stunden hielten sie an. Dankbar sank der Sklave gegen den Wagen. Die Wachen umkreisten zu Pferd den Wagen und ließen misstrauisch die Blicke über die Gruppe gleiten. Auch sie wirkten angespannt und nervös. Der Sklave wunderte sich ein wenig, dass er sich darüber Gedanken machte. Er war ihnen vollkommen ausgeliefert und konnte nur hoffen, dass sein Gehorsam sie davon abhielt, ihn zu töten, alles andere ging ihn nichts an!
Die Pause dauerte nicht lange, aber dass sie überhaupt gehalten hatten, beschäftigte den Sklaven während sie weiter liefen. Obwohl die Gorderley jede Verzögerung unerbittlich bestraften, wollten sie offenbar die Sklaven halbwegs gesund an ihren Zielort bringen. Der Gedanke gab ihm neuen Mut, denn es bedeutete, dass man sie wahrscheinlich nicht zu ihrer Hinrichtung brachte .
Sie rasteten am Abend und die Sklaven durften sich neben dem Wagen nieder legen. Sie schliefen kaum in der Nacht, denn es wurde sehr kalt. In den Verliesen sank die Temperatur selbst in den kältesten Wintermonaten selten soweit, dass sie frieren mussten. Sie versuchten vorsichtig, näher zusammen zu rücken, und als die Wachen nichts dagegen unternahmen, drückten sie sich zitternd aneinander, um so wenig Wärme wie möglich an die Nacht abzugeben.
Noch vor dem Morgengrauen zogen sie weiter. Der Wind ließ nach und die Temperaturen stiegen wieder, dafür setzte leichter Nieselregen ein. Trotzdem kamen sie gut voran. Die Sklaven gewöhnten sich an das Tempo und verfingen sich seltener in den Fußketten, so dass der Tross nicht mehr aufgehalten wurde.
Als sie an diesem Abend rasteten, reichte einer der Wachen ihnen einen Wassersack. Er gestattete jedem Sklaven einige Schlucke, bevor er mit einem leichten Rucken seiner Peitsche andeutete, den Beutel weiter zu geben. Es kam zu keinem Zwischenfall. Sie waren alle zu lange in der Knechtschaft der Gorderley, um in diesem Augenblick Ungehorsam zu riskieren.
Sie liefen zwei weitere Tage, bevor sie ihr Ziel erreichten. Die hohen Mauern einer Stadt warfen ihren Abendschatten, als sie durch das Tor zogen. Das Wetter war beinahe schön, die Sonne stand hinter einem leichten Schleier und gab, wenn doch schon nicht Wärme, immerhin ein sanftes Abendlicht.
In der Stadt drängten sich Menschenmassen und der Sklave wagte es, den Kopf ein wenig zu heben. Sein unbestimmter Eindruck bestätigte sich bei diesem kurzen Blick. Es waren Flüchtlinge darunter. Der Wagen hielt auf einem kleinen Platz. Sie wurden zu einer Gruppe Männer gescheucht, die um einen Brunnen lagerten und kettete sie an. Im Laufe des Abends erreichten weitere Sklavengruppen den Platz. Zwischen ihnen patrouillierten Gorderleykrieger, die wachsam alle Regungen beobachteten, aber als es dämmerte wagte der Sklave dennoch, sich unauffällig umzusehen. Die Häuser ringsum waren alle groß und sehr einheitlich. Gerade Linien, schmale Fenster ohne Verzierungen, nur selten einmal ein Balkon.
Als rundherum Fackeln angezündet wurden, duckte sich der Sklave wieder. Eine Gruppe von Männern näherte sich und als sie vor ihm standen, erkannte er zwei Sklaven, die einen dampfenden Kessel schleppten. Einen Augenblick weigerte sich sein Gehirn zu glauben, was geschah. Sie schöpften mit einer Holzschale eine dicke Suppe aus dem Kessel und reichten sie ihm. Er wagte beinahe nicht, die Hand auszustrecken, aber bei aller Brutalität waren die Gorderley niemals heimtückisch. Wenn sie Essen verteilten, durfte er es auch annehmen. Es roch gut. Es roch nach Fleisch. Er schlürfte einen Schluck und verbrannte sich beinahe den Mund. Dennoch nahm er gierig noch einen Schluck und fühlte, wie sich die Wärme den Hals hinunter in seinem Bauch ausbreitete. Wann hatte er das letzte Mal eine warme Mahlzeit erhalten?
Er schlang die Suppe hinunter und leckte die Schale aus, dann legte er sich nieder. Eine wohlige Schläfrigkeit überkam ihn und er bemerkte kaum, wie die Schüsseln wieder eingesammelt wurden. Die Steinstufen um den Brunnen waren hart und kalt, aber der Sklave drückte sich an seinen Nebenmann und schlief ein.
Ein leises Klappern weckte ihn und er fuhr auf, nur um im nächsten Augenblick zusammen zu zucken und sich zu ducken. Vorsichtig hob er ein zweites Mal den Kopf soweit, dass er auf den Platz hinaus sehen konnte. Es dämmerte gerade und im trüben Zwielicht des anbrechenden Tages sah er, wie einige Sklaven von Wächtern fortgeführt wurden. Als eine Wache näher kam, hockte er sich schnell wieder auf den Boden und wartete auf seine Bestrafung, aber obwohl der Gorderley bei vor ihm blieb, geschah nichts. Keiner der anderen Sklaven regte sich, aber an ihrem vorsichtigen Atmen erkannte er, dass sie nun auch alle erwacht waren. Zwei weitere Wächter erschienen und machten sich an den Ketten zu schaffen, dann forderte ein Knuff mit dem Stock den Sklaven zum Gehen auf. Er trabte zwischen den Gorderley über den Platz und wurde zu einer Bank dirigiert, wo man ihm die Fußschellen abnahm. Neben der Bank stand ein Bottich mit einer dampfenden Flüssigkeit. „Trink!“
Der Sklave ergriff eine seitlich hängende Kelle und schöpfte die dunkle Flüssigkeit heraus. Es schmeckte bitter, aber aromatisch, und er fühlte, wie die Wärme die Nachtkälte aus seinen Gliedern vertrieb.
„Was bedeutete dies alles?“, fragte eine Stimme in seinem Hinterkopf, aber er wollte jetzt nicht darüber nachdenken. Die Vergünstigungen seiner Herren kamen immer unverhofft. Manchmal war er nach einem Kampf nicht sofort zurück in den Kerker gebracht worden, sondern man erlaubte ihm, sich in einem kleinen Hof waschen. Hin und wieder durfte er aus einem Korb einen Apfel nehmen, ein anderes Mal war es ein zusätzliches Stück Brot. Diese Gelegenheiten kamen selten und waren nicht kalkulierbar, hingen auch nicht davon ab, ob er gut oder schlecht gekämpft hatte, sondern nur von der Gnade der Stimme. Es hatte keinen Zweck, darauf zu hoffen und es gab nichts, was er tun konnte, um in den Genuss solcher Vorzüge zu kommen. Der Sklave nahm noch einen langen Schluck und legte dann die Kelle ab. Sie hatten ihm genug Zeit gelassen, in Ruhe zu trinken, und nun trieb ihn nur ein Befehl weiter, kein Stock, keine Peitsche. Es beunruhigte ihn eher, als dass er Erleichterung verspürte. Sie verließen die Stadt wieder durch das Haupttor und bei einem schnellen Seitenblick sah er, dass überall Sklaven vor die Mauern geführt wurden. Die Stadt lag auf einem sanften baum- und strauchlosen Hügel. Hin und wieder lugten Felskanten aus der dünnen braunen Grasdecke hervor. Sie liefen einige hundert Schritt weit unterhalb der Mauern entlang und dann ein Stück den Hang hinab, bevor er den Befehl zum Stehenbleiben vernahm. „Stad“. Das war kein bloßes Anhalten, das bedeutete absolutes Stillstehen, Bewegungslosigkeit, bei der schon ein heftigeres Atmen zu furchtbaren Strafen führen konnte.
Der Sklave schloss gehorsam die Augen und verbannte jeden Gedanken aus seinem Kopf. Was auch in den nächsten Minuten geschah, er würde sich nicht regen.
Kaltes Eisen legte sich um sein rechtes Fußgelenk und eine Kette klirrte. Dann spürte er Hände im Nacken und plötzlich war der Halsring fort, im nächsten Augenblick auch die Handschellen. Wieder ein Kampf? Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals außerhalb der Arena ohne Ketten gewesen zu sein.
Die Gorderley entfernten sich wortlos. Der Sklave hörte ihre Schritte verklingen, aber er wagte nicht, sich zu bewegen. Alles war ungewöhnlich, und das bedeutete selten etwas Gutes. Ein leichter Wind wehte über den Hügel und ließ ihn frösteln. Vorsichtig öffnete er die Augen. Um seinen rechten Fuß lag eine Kette, die im Gestein verankert war. Mehr konnte er nicht sehen, und ein unbestimmtes Gefühl im Nacken warnte ihn, den Kopf zu heben. Natürlich! Die Stadtmauer! Dort patrouillierten zweifellos Wachen, die ihn beobachteten und im Falles seines Ungehorsams schießen würden. Das war wieder ein so gewohntes Gefühl, dass er sich ein wenig entspannte. Von der Seite näherte sich jemand, dann erschien ein Schwert vor seinen Augen. „Nimm!“ Er griff die Waffe und ließ sie herabhängen. Der Gorderley entfernte sich. Der Sklave wartete geduldig zwanzig Atemzüge lang, bevor er endlich aufblickte.
Der Anblick traf ihn wie ein Schlag.
Vor ihm lag ein weiter Abhang, der an den Fuß eines neuen Hügels grenzte. Und dieser war nur der Auftakt zu einer ansteigenden Reihe von Höhenzügen, die in der Ferne die schroffen Gipfel eines Gebirges erahnen ließen.
Über ihm weißgrauer Himmel ohne Grenzen.
Soweit er blicken konnte, gab es keine Mauern, die Entfernung schmerzte beinahe in den Augen. Der Sklave rang krampfhaft nach Luft und sah langsam zur Seite. Links und rechts von ihm waren in regelmäßigen Abständen andere Sklaven an den Hügel gekettet. Er machte einige Schritte zur Seite bis die Kette spannte und überschlug die Entfernung. Es war kaum möglich, seinen Nachbarn zu erreichen, selbst wenn sie beide aufeinander zugehen würden. Offenbar galt dieser Kampf einem anderen Gegner. Er überlegte, ob er einen Blick zurück wagen sollte, um nach Tribünen auf der Stadtmauer Ausschau zu halten, aber das Risiko war zu groß, eine Wache anzusehen. Lieber ließ er die Augen über das Land streifen. Auf dem Hügel gegenüber bewegten sich Gestalten, aber der Morgendunst verhinderte, dass er sie genau erkennen konnte.
Schließlich setzte er sich auf den kalten Boden. Das Gras unter seinen Händen weckte eine undeutliche Erinnerung, die er sofort verscheuchte. Das Schwert zwischen den Knien wartete er ab.
Der Himmel hing voller Wolken und hin und wieder schwebten winzige Schneeflocken herab. Irgendwann verließ ihn auch die angenehme Wärme des Morgentrunkes und er sprang auf und hüpfte auf der Stelle, um nicht zu frieren. Plötzlich erklang ein Horn.
Es war ein klarer, weit tragender Ton, der ihn elektrisierte. Ein Schlachthorn.
Er packte sein Schwert fester und spähte den Hügel hinab. Dort kamen sie. Eine dunkle Linie bewegte sich den gegenüberliegenden Abhang hinab, zunächst langsam, dann immer schneller den Schwung ausnutzend. Wieder erklang das Horn, doch diesmal wurde es durch einen Ruf aus tausend Kehlen beantwortet. Der Sklave verstand den Schrei nicht, aber nun stürmte eine unüberschaubare Masse von riesigen, in zottige Felle oder lederne Rüstungen gehüllten Männern auf die Stadt zu. Noch bevor sie die angeketteten Sklaven erreichten, mähte ein Pfeilhagel die ersten Reihen nieder. Doch unaufhaltsam drängten die Nachkommenden vorwärts, während die Getroffenen die Pfeile aus ihren Wunden rissen, aufsprangen und ebenfalls vorwärts stürmten. Der Sklave hatte in der Arena häufig Barbaren aus den Bergen gegenübergestanden und sie als furchtbare Gegner kennengelernt. Er suchte einen festen Stand und hob sein Schwert, als es geschah:
Es war, als verschiebe sich sein Blickwinkel um eine Winzigkeit und plötzlich sah er nicht nur seinen Gegner brüllend auf sich zukommen, sondern er hörte gleichzeitig hunderte Schwerter aufeinander prallen, spürte die Luft erbeben, roch den dampfenden Blutgeruch des Krieges und er begriff: Dies war kein Schaukampf in der Arena. Dies war eine Schlacht, und er war ein Krieger in diesem Kampf.
Galen wischte mit seinem Schwert die Axt des Barbaren zur Seite und bohrte die Klinge in den Arm des Angreifers. Der wütende Schrei ging ihm ins Blut wie starker Wein. Mühelos wich er dem nächsten Hieb aus und traf seinerseits den Brustpanzer seines Gegners. Der Stahl durchschnitt das Leder und schabte über die Rippen.
Es war wie ein Tanz. Galen parierte, wich aus und fügte dem Barbaren eine Wunde nach der anderen zu, ohne einen einzigen Treffer hinzunehmen. Dauerte es Minuten oder Stunden, bis die Bewegungen des anderen schwächer wurden? Galens Schwert fand den Weg durch die langsame Abwehr und bohrte sich in den Hals. Keuchend riss er die Waffe wieder heraus, um erneut zuzuschlagen, aber der Barbar stand einen Sekundenbruchteil bewegungslos da und fiel dann beinahe erstaunt zu seinen Füßen nieder.
Galen blieb keine Zeit. Wieder drang ein Angreifer auf ihn ein, zu schnell für eine klare Abwehr. Er sprang zurück und musste einen weiteren Schritt vergeben, bevor er seinen festen Stand fand. Die Angriffe kamen schnell und mit ungeheurer Macht. Der Arm schmerzte ihm unter den Aufprall der Kriegsaxt des Barbaren. Noch einmal sprang er zurück, aber diesmal verließ ihn sein Glück. Die Kette spannte sich und er stürzte auf den felsigen Boden. Ehe er reagieren konnte, war sein Gegner über ihm und holte zum Schlag aus. Galen starrte in das verzerrte Gesicht und versuchte, sich abzurollen, obwohl er dem Schlag damit auch nicht mehr ausweichen konnte.
Die Schneide der Axt fiel klirrend gegen den Stein, als der Barbar zusammensackte. Galen starrte auf die bewegungslose Gestalt und benötigte einige Herzschläge lang, bis er begriff, dass er noch lebte. Er wälzte den Toten herum. Ein Pfeilschaft ragte seinem Auge. Unwillkürlich blickte Galen zu den Mauern hinauf und suchte nach seinem Retter. Ein zweiter Pfeil raste auf ihn zu und blieb federnd in der dünnen Grasnarbe neben ihm stecken. Er verstand und sprang auf, um sich dem nächsten Gegner zu stellen.
Die Schlacht dauerte den ganzen Tag. Unermüdlich rannten die Barbaren gegen die Stadtmauern an. An verschiedenen Stellen durchbrachen sie die Abwehrstellungen und erklommen mit Leitern und Wurfankern die Zinnen, doch die Gorderley leisteten erbitterten Widerstand und schlugen die Eindringlinge immer wieder zurück.
Vor der Stadt lichtete sich die Reihe der angeketteten Sklaven. Sie wateten in Blut und dampfenden Leibern und wer noch lebte, hatte keine Minute Pause, denn die Angriffslust der Barbaren unterschied nicht zwischen ihnen und den Gorderleykriegern. Galen schwang sein Schwert wie in einem Rausch. Noch immer war er ohne ernsthafte Verletzung und die endlosen Stunden des Ausdauertrainings machten sich bezahlt. Er spürte keine Müdigkeit in den Armen und blieb in einer unwirklichen Hochstimmung, die ihn von Kampf zu Kampf weiter trug.
Als am frühen Nachmittag das Licht nachließ, begannen auch die Angriffswellen schwächer zu werden. Einige Teile der Stadt brannten und aus den Breschen strömten die Barbaren zurück, teils bedrängt von den Verteidigern, teils aber auch beladen mit Beutegut. Doch der Preis war unendlich hoch gewesen. Hunderte lagen tot oder tödlich verwundet vor den Mauern. Galen gab einem leblosen Körper einen Tritt, damit er ein Stück den Hügel hinab rollte und ihm nicht im Weg lag. Wachsam blickte er sich um, aber für einen Augenblick nahte kein neuer Feind. Unter seinem feuchten Hemd blutete er aus einer tiefen Schnittwunde. Jetzt, im Moment der Ruhe spürte er den pochenden Schmerz. Das Blut durchtränkte sein schweißfeuchtes Hemd, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Er atmete scharf ein und unterdrückte gewohnheitsmäßig jeden Schmerzlaut während er seine anderen Verletzungen untersuchte. Einige Prellungen an den Beinen, einige Schnitte und eine ebenfalls tiefe zackige Wunde von einem Wurfstern, nichts lebensgefährliches. Aber nach der Anspannung des Tages überfiel ihn schlagartig ein Schwindelgefühl. Er taumelte und wollte sich auf sein Schwert aufstützen, als er aus den Augenwinkeln einen Schatten wahrnahm. Instinktiv warf er sich nach vorn und drehte sich noch im Fallen herum. Seine Klinge lenkte das Schlachtbeil haarscharf an seinem Oberkörper vorbei. Die Fußkette hinderte ihn am Abrollen, aber es gelang ihm dennoch, aufzuspringen. Wieder pfiff der mächtige Kopf des Schlachtbeils heran. Galen wartete bis zum letzten Augenblick, bevor auswich. Ein brennender Schmerz lohte in seiner Hüfte, als die Schneide einen blutigen Streifen zog. Der Barbar konnte seinen kraftvollen Hieb nicht schnell genug abfangen, und stolperte einen halben Schritt nach vorn. Galen sprang seitlich an ihm vorbei und zog dabei die Fußkette mit einem Ruck nach oben, so dass sich das Schlachtbeil darin verfing. Sein Gegner ließ die Waffe fallen, um nach seinem Dolch zu greifen, aber obwohl die Erschöpfung Galen langsamer reagieren ließ, blieb ihm genug Zeit für einem Hieb in die Seite des Barbaren. Die Klinge aus Gorderleystahl war auch nach diesem langen Tag scharf, wie in der ersten Minute und zerschnitt fast ohne Widerstand den dicken Fellumhang und drang zwischen Rippenbogen und Hüftknochen in den Körper ein. Er zog die Waffe hart nach oben und stieß noch einmal zu. Der Barbar heulte wie ein Tier auf und griff sich an die Seite. Dann brach sein Blick und er stürzte nieder. Galen wurde mitgerissen und der Schmerz beim Aufprall raubte ihm einige Sekunden den Atem. Als er wieder zu sich kam, lag er unter dem Körper seines toten Gegners begraben. Er unterdrückte seinen ersten Impuls, sofort hervor zu kriechen und blieb still liegen. Die Gorderley hatten jetzt genug mit dem endgültigen Abschlagen der Barbaren zu tun, also konnte er ein wenig ausruhen.
Nach und nach nahmen die Geräusche der Schlacht ab. Das gellende Kriegsgeheul verklang und mit dem Abend senkte sich Stille über den Hügel, nur unterbrochen von dem Stöhnen der Verletzten und Sterbenden.
Galen tastete nach der Hüftwunde. Sie war nicht tief und hatte schon aufgehört zu bluten. Langsam rutschte er unter dem Toten hervor und sah sich um. Das Dämmerlicht legte Schatten über das Grauen ringsum, dennoch konnte er erkennen, dass jeder Fußbreit des Hügels mit Leibern bedeckt war. Die Luft war geschwängert vom Geruch nach Blut und Brand. Erschüttert setzte er sich auf die zerwühlte Erde. Aber dann siegte sein Lebenswille: Er zerrte sich das Hemd vom Leib und riss es in Streifen, die er fest um den Oberkörper knotete, um die Brustwunde zu schützen. Mehr konnte er nicht tun, aber es war zu kalt, um einfach still zu verharren.
Galen kniete neben seinem letzten Gegner nieder und versuchte, den zottigen Fellumhang vom Leib des Toten zu ziehen. Schließlich nahm er das Schwert zu Hilfe und zerschnitt den Gürtel. Etwas klirrte auf einen Stein. Einen Moment lang war Galen zu beschäftigt damit, sich das wärmende Fell über den Kopf zu ziehen, bevor er registrierte, was zu seinen Füßen lag. Schwarzmatt war eine flache schmale Klinge aus dem Gürtel gefallen, kaum so lang, wie seine Hand, ohne Griff, aber auf einer Seite mit abgerundeter Kante. Gefahr! warnte eine Stimme in seinem Hinterkopf, als er danach griff. Sie war unwahrscheinlich scharf. Er strich über den Stahl und war nicht fähig, einen klaren Gedanken zu denken. Immer wieder berührte er das Metall so vorsichtig, als könnte es davon zerspringen. Sie würden es ihm ansehen. Sie würden ihn durchsuchen und die Klinge finden. Seine Phantasie reichte nicht aus, um sich vorzustellen, welcher Tod ihn erwartete, aber er würde lange dauern. Seine Hand ballte sich um den Griff, als er sich neben den noch warmen Körper des Barbaren legte und auf den Schlaf wartete.
Der Sklave erwachte von der Kälte, die aus der froststarren Erde in ihn hinein zog. Es dämmerte bereits und von den Mauern der Stadt drangen geschäftige Geräusche herüber. Die Gorderley hatten bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen. Er blickte suchend über den Boden und zog dann das Schwert zu sich heran. Galens Schert/sein Schwert. Gedankenfetzen, die aufblitzten und verschwanden. Mühsam richtete er sich auf. Sein ganzer Körper schmerzte unter den Nachwirkungen der Schlacht. Verletzungen und Überanstrengung forderten ihren Tribut. Trotzdem erhob er sich und humpelte einige Schritte den Hügel hinunter, wo er versuchte, das Schwert, in den Boden zu stecken, aber die Erdschicht war zu dünn, um die Klinge aufrecht zu halten. Schließlich lehnte er sie gegen einen der starren Körper und schlurfte zu seinem Platz zurück. Es dauerte nicht mehr lange, bis er unter den gesenkten Lidern zwei Gorderley näher kommen sah. Sie bewachten mehrere Sklaven, die aneinander gekettet vor ihnen her gingen. Der Sklave sprang auf, als sie vor ihm anhielten. Auf den bekannten Befehl streckte er die Hände aus und spürte gleich darauf das vertraute Gewicht der Ketten. „Runter mit dem Fell!“
Hastig warf er den Fellumhang von sich. Die Kälte biss sich in seine nackte Haut, als einer der beiden Gorderley ihn schnell aber gründlich untersuchte. Als er über den notdürftigen Verband strich, sog der Sklave heftig die Luft ein, denn der Schmerz trieb feurige Punkte vor seine Augen.
Dann bückte sich der Krieger, hob das Fell auf und schüttelte es. Nachdem er beide Seiten abgetastet hatte, warf er es vor die Füße des Sklaven und bedeutete ihm, es wieder über zu streifen.
Der Sklave hüllte sich dankbar in den wärmenden Umhang. Die wenigen Minuten in der frostigen Morgenkälte hatten gereicht, seine Haut gefühllos werden zu lassen.
Nun reihte er sich hinter die anderen Sklaven ein und sein Halsring wurde an dem seines Vordermannes befestigt. Sie umwanderten die halbe Stadt und sammelten die restlichen überlebenden Sklaven ein. Zwei waren zu schwer verletzt, um aufzustehen. Das Schwert des Gorderley machte ihnen ein schnelles Ende.
Schließlich lenkten die beiden Krieger sie durch eine Bresche in der Stadtmauer zu einem kleinen Platz und befahlen ihnen, sich niederzulegen. Der Sklave überschaute die Gruppe und erschrak, denn es waren höchstens dreißig Männer, die die Schlacht überlebt hatten.
Nach wenigen Minuten erschienen einige bewaffneter Städter und die Sklaven wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und davon geführt. Der Sklave fand sich bei einem Aufräumtrupp, der die Trümmer eines abgebrannten Hauses zur Seite schaffte. Keuchend schleppte er verkohlte Balken und Steine und schaufelte mit den Händen Erde und Asche in einen Holzkarren, den er durch den Schutt zu einer Halde schob.
Es gab nur wenige Wachen, die die Arbeit kontrollierten. Kaum einer der Sklaven wies keine schwereren Verletzungen auf und musste nicht hin und wieder einige Atemzüge lang pausieren. Aber sogar als sich der Sklave bei einem plötzlichen Schwindelanfall an eine Hauswand lehnte, schritten die Gorderley nicht ein. Sie schienen damit zufrieden, dass die Sklaven überhaupt arbeiteten.
Gegen Mittag erschienen auf der Baustelle einige Frauen mit einem Wagen, auf dem ein Kessel stand. Die Sklaven stellten sich in einer Reihe auf und erhielten jeder eine Kelle voll Brühe. Man gönnte ihnen noch eine eine Ruhepause, bevor sie erneut zur Arbeit getrieben wurden.
In den Abendstunden brachte man sie zu dem Platz ihrer Ankunft und kettete sie rund um den Brunnen aneinander. Der Sklave konnte das Wasserbecken nicht erreichen, aber als die näher liegenden Kameraden begannen, mit den Händen Wasser zu schöpfen und weiterzugeben, ließen die Wachen es geschehen.
Auch am nächsten Tag wurden sie zu Aufräumarbeiten eingesetzt. Sie erhielten morgens einen Becher des bitteren Getränkes und am Abend einen kalten dicken Brei, der den Hunger vertrieb.
Am dritten Tag wurden sie vor die Stadt gebracht um die Leichen einzusammeln und in einer Grube zu verbrennen. Die Kälte hatte bisher verhindert, dass die Toten stark verwesten, aber der Gestank des sengenden Fleisches brachte den Sklaven beinahe zum Erbrechen. Stunde um Stunde schleppte er die steifen Körper heran, schleuderte sie in das Feuer und floh wieder auf das Schlachtfeld hinaus. Irgendwann stieß er auf seinen letzten Gegner. Er bückte sich, um den riesigen Körper hoch zu hieven, als sein Fuß auf etwas Hartes trat.
Ohne nachzudenken, griff Galen nach der Klinge und schob sie unter seinen Verband, während er mit der anderen Hand bereits den Arm des Toten packte. Schwankend schleppte er seine Last den Hügel hinab. Sein Kopf war ganz leer, kein Gedanke, kein Gefühl fand sich darin. Er stolperte und fiel hin. Automatisch kam er wieder auf die Beine und zerrte den Körper weiter, bis ein anderer Sklave ihm zu Hilfe kam.
Abends war er völlig erschöpft. Sein Kopf brannte im Wundfieber und seine Muskeln schmerzten unter der furchtbaren Anspannung. Doch es geschah nichts. Die Wachen ließen eher aus Gewohnheit hier und da die Peitsche kreisen und keiner schenkte dem kranken Sklaven besondere Aufmerksamkeit.
In dieser Nacht schlief er unruhig und schreckte immer wieder auf. Die Klinge lag glatt an seiner Haut und weckte unterschiedlichste Gefühle. Ein Teil von ihm spürte die Kraft, die sie darstellte, der andere Teil schrie lautlos auf, vor der tödlichen Gefahr. Wenn er wach in den wolkenverhangenen Nachthimmel starrte, wünschte er sich, er könnte sie loswerden, aber genauso wusste er, dass er sie nicht mehr von sich geben würde.
Er würde sterben.
Der Gedanke war erstaunlich ungewohnt. Er lebte in ständiger Gegenwart des Todes, aber niemals hatte er ihn wirklich für sich als möglich angenommen. Er hatte das Stück Leben, das man ihm ließ mit allen Kräften verteidigt. Aber diesmal würde er sterben.
Die Wachen hier mochten das Messer übersehen, die Stimme würde nicht einmal danach suchen müssen. Sie würde wissen, dass er etwas verbarg, sobald sie ihn sah. Eine seltsame Ruhe zog in ihn ein, als er erkannte, dass er nichts dagegen tun konnte und er schlief endlich ein.
Sie verließen die Stadt im Morgengrauen, sechs müde Sklaven bewacht von fünf Gorderley. Der Rückweg dauerte länger als ihr Hermarsch, denn sie waren nicht in der Lage, über längere Zeit ein hohes Tempo einzuhalten.
Die Behandlung durch die Wachen wurde wieder schärfer, so dass sie auf ihre Blicke achten mussten. Dennoch war das Regiment milde im Vergleich zu ihrem Leben in den Verliesen der Burg. Der Sklave versuchte so oft wie möglich, einen Blick auf die Landschaft ringsherum zu werfen, raue kahle Hügel, Schluchten und dunkelgrüne Tannenwälder, überall Weite ohne Begrenzungen.
Die Bergbäche perlten eiskalt um die Waden und schienen für Sekunden jedes Gefühl aus den Fußgelenken zu vertreiben. Fast immer rasteten sie nach der Überquerung eines Wasserlaufes und die Sklaven durften trinken oder ihre Verletzungen versorgen, bevor sie wieder aufbrachen.
Des Abends wurden sie eng aneinander geschlossen und eine zusätzliche Kette, wurde durch die Handschellen gezogen, so dass sie die Arme oberhalb des Kopfes ausstrecken mussten. In dieser Stellung war es nicht einmal möglich, sich umzudrehen, aber sie schliefen dennoch tief und fest.
Es verging ein weiterer eintöniger Tag von wenigen Pausen unterbrochenen Wanderns. Manchmal vertrieb die Hitze des Fiebers die Kälte des Windes, dann wieder trottete der Sklave zitternd und halb blind vor Schwindel hinter den anderen her. Er spürte kaum die Stockhiebe, die ihn antrieben, wenn er das Tempo zu sehr verlangsamte. Die Brustwunde pochte heiß unter dem Verband, aber zumindest der tiefe Stich in der Seite verheilte bereits, die leichteren Schnitte und Abschürfungen waren größtenteils schon vernarbt.
Sie bewegten sich seit einigen Stunden auf einem schmalen felsigen Weg durch eine Gebirgslandschaft. Auf der einen Seite reckte sich ein steiler Geröllhang den Berg hinauf, auf der anderen Seite lag hinter einer Kante das Nichts.
Plötzlich ertönten an der Spitze des Zuges laute Rufe und sie hielten an. In solchen Situationen galt es, möglichst keine Neugierde zu zeigen. Der Sklave heftete den Blick auf die Hacken seines Vordermannes und atmete betont ruhig ein und aus.
Die Gorderley sprachen schnell und aufgeregt miteinander, dann ritten sie zu den wartenden Sklaven zurück und schlossen die Fußketten auf. Als sie vorwärts hasteten, erkannte der Sklave, was sie aufgehalten hatte. Vor ihnen versperrte ein Steinschlag den Weg. Ein unbekannter Gorderley stand vor den Felsblöcken und unterhielt sich mit einem ihrer Bewacher, der sie anwies
die Steine fort zu wälzen. Offenbar lagen Reste eines Gefährtes darunter. Sie hatten keine Hilfsmittel, keine Brechstangen oder Hebel und die scharfen Kanten des Felsgesteins rissen ihnen die Hände blutig, doch hier wurde keine Nachlässigkeit geduldet, schnell und sicher traf die Peitsche jeden, der auch nur für einen Atemzug in seinem Bemühen inne hielt.
Stunde um Stunde stemmte sich der Sklave gegen Felsbrocken und schaufelte Geröll zur Seite,die größeren Steine warfen sie in die Schlucht. Endlich hatten sie den zerschmetterten Wagen freigelegt und die Gorderley zogen vorsichtig einen Körper hervor. Es fielen keine Worte, während sie den kaum noch kenntlichen Toten betrachteten.
Der Sklave schleppte einen Brocken an der Gruppe vorbei und ließ ihn über die Kante in den Abgrund fallen.
Kein Aufprall. Er registrierte den Gedanken, ohne ihn zu verstehen und grub weiter. Als er den nächsten Stein ablud, spähte er nach der anderen Seite der Schlucht, erhaschte aber nur einen Ausblick auf schwarze Wände unter einer dunkelgrünen Baumkante.
Kein Fluß, sagte eine Stimme in ihm ohne Zusammenhang.
Die Gorderley hatten inzwischen die Überreste des Wagens untersucht und warfen den Sklaven die zersplitterte Deichsel als Hebel zu. Immer mehr Steine polterten nun die Schlucht hinab, und als der Abend herein brach, war der Weg bis auf einen letzten, übermannshohen Felsen geräumt. Der Sklave stemmte sich mit der Schulter gegen den kalten Stein und spannte die Muskeln an. Ein weiterer Sklave eilte ihm zu Hilfe. Für einem atemlosen Augenblick sah es aus, als könnten sie ihn nicht bewegen, aber dann hob sich der Fels handbreit für handbreit aus der Mulde, die sein Aufprall gedrückt hatte. Schwitzend und keuchend stemmten sie den Block langsam vorwärts. Die Gorderley hatten ihre Unterhaltung unterbrochen und sahen ihnen mit Interesse zu. Mit Hilfe der übrigen Sklaven wäre es ein Leichtes gewesen, die Arbeit zu vollenden, aber die Gorderley hielten sie mit einem Wink ihrer Peitschen zurück. Der Sklave freute sich darüber. Mit wütendem Ehrgeiz wollte er es allein schafften und hörte am verbissenen Atmen seines Kameraden, dass dieser genauso dachte. Unter der Anstrengung zog ein feuriger Streifen Schmerz seinen Rücken hinab, dennoch gab er nicht nach und plötzlich löste sich der Widerstand und sie stolperten mit dem Stein nach vorn.
Galen hörte sich triumphierend aufschreien. Im nächsten Augenblick stürzte der andere Sklave von seinem Schwung getrieben über die Kante. Galen fing sich an einer kleinen Bodenerhebung ab. Einen Herzschlag lang kämpfte er um sein Gleichgewicht. Ein Ruf der Gorderleywachen drang an sein Ohr, ohne dass er ihn wirklich wahrnahm, dann warf er sich nach vorn in das Nichts.
Die Kerzen im Raum waren herunter gebrannt. Einmal hatte der Fürst sie bereits ersetzt, ohne den Waffenmeister in seiner Erzählung zu unterbrechen.
Noch war es draußen vor den Fenstern dunkel, aber schon bald würde das diffuse Licht der beginnenden Dämmerung zwischen die Häuser kriechen. Roman schenkte dem Waffenmeister Wein nach. Dieser trank, gefangen von seiner Erinnerung, ohne es überhaupt zu bemerken. Seine Schilderungen wurden jetzt grober, sprunghafter. Er berichtete von dem tiefen Fall in einen See, von der Strömung, die ihn mitgerissen hatte. Er schilderte die Flucht durch die Berge, erwähnte mit kaum einem Satz den Schürfer, den er zwang, seine Ketten aufzubrechen und anschließend tötete.
Die Suchtrupps der Gorderley hätten ihn vielleicht trotz allem gefunden, wenn er nicht einer Horde Bergbarbaren in die Hände gefallen wäre. Wieder legte man ihm Ketten an und noch einmal verlebte er vier lange Monate unter dem Joch der Sklaverei, bis ihm erneut die Flucht gelang. Es war diese Zeit, die den Fürsten interessiert hätte. Wie konnte ein Mann, kaum bewaffnet und offensichtlich ein entlaufener Sklave ganz Gorderley durchqueren, ohne dass er eingefangen wurde?
Aber er unterbrach Galen nicht mit Fragen, sondern ließ ihn zuende berichten.
„Schließlich erreichte ich Brandai. Bei den Unsterblichen, ich war zehn Jahre verschollen gewesen und niemand erkannte mich. Und dann wollten sie einen Helden aus mir machen.“ Er schüttelte den Kopf, „meine Familie verstand mich nicht mehr, und ich konnte sie nicht mehr verstehen. Es hat lange gedauert, bis ich wieder begann zu leben.... Und nun kommt Ihr.“
Roman betrachtete den Waffenmeister, der mit den letzten Worten aus seiner Erinnerung empor tauchte. Es war weder Anklage noch Bitterkeit in seiner Stimme, keine Spur von Hass gegenüber seinen Peinigern.
Der Fürst konnte nichts anderes, als die Arbeit des Stockmeisters von Witstein bewundern. Selbst nach all diesen Jahren hatte der Waffenmeister noch immer nicht begriffen, wie das System aus Schmerzen, Erniedrigung und Willkür ihn zu einem perfekten Kampfsklaven geformt hatte. Und sein ungebrochener Lebenswille war nicht der Grund seines Entkommens, sondern die Voraussetzung für seine Versklavung gewesen.
Nüchtern dachte er, dass Galen seine erfolgreiche Flucht nur einer Reihe sehr glücklicher Umstände verdankte. Der verfrühte Einfall der Barbaren hatte damals für große Unruhe im Fürstentum gesorgt. Qualinn wurde gehalten und die Barbaren so vernichtend geschlagen, dass sie sich bis heute davon nicht erholt hatten, aber ohne diese Ereignisse wäre das Aufbegehren des Sklaven rechtzeitig bemerkt worden. Es kam gerade bei den Kampfsklaven hin und wieder vor, dass ein scheinbar gezähmter Geist noch einmal erwachte und ein zweites, endgültiges Mal gebrochen werden musste.
Für Roman bestand die Leistung Galens weniger im Entschluss zur Flucht, als in deren erfolgreicher Beendigung. Aber obwohl der Waffenmeister die Verliese von Burg Witstein verlassen hatte, war der Sklave mit ihm nach Brandai gekommen. Neben seinen überragenden Waffenkünsten waren auch seine Zurückhaltung, seine Ruhe, sein Urteilsvermögen, die ungeteilte Aufmerksamkeit, die er seinen jeweiligen Handlungen zumaß, selbst seine Nachsicht gegenüber unfähigen Schülern, erwachsen aus den Lektionen, die der Sklave Galen gelernt hatte.
„Und nun komme ich“, wiederholte der Fürst den letzten Satz.
Galen blickte über die flackernden Flammen in das ernste Gesicht des Gorderley und suchte nach einer Antwort auf seine unausgesprochene Frage.
„Bin ich frei?“, flüsterte er schließlich.
Roman schüttelte den Kopf. „So wie Ihr es wollt? Niemals.“
Galen zuckte zusammen. Lange wartete auf eine Erklärung, aber der Fürst fuhr nur fort, ihn unbewegt anzusehen. Eine Kerze verlosch mit einem leisen Zischen und der Raum versank in grauem Schatten.
„Bleibe ich denn immer ein Sklave?“, fragte er zweifelnd.
„Das ist Eure Entscheidung, nicht meine, Robert Galen.“
Der Waffenmeister blieb reglos sitzen und ließ die Worte in sich eindringen. Als der Fürst in Undidor auftauchte, hatte er sich bereits entschieden, wenn er überhaupt eine wirkliche Entscheidung hatte fällen können. Er war bereit gewesen, sich dem Urteil des Gorderley zu unterwerfen. Aber der Fürst gab ihm diese Chance nicht.
Oder tat er es doch?
Es war schmerzlich gewesen, die Jahre des Leidens noch einmal zu erleben, wieder die dumpfe Unbewusstheit seines elenden Sklavenlebens zu spüren, an die verlorenen Jahre seines Lebens erinnert zu werden. Und doch schien ihm die Erinnerung plötzlich erträglicher. Näher wieder und nicht abgeschlossen, aber dennoch weniger bedrückend.
Er erhob sich und deutete mit einem Kopfnicken eine Verbeugung an. „Ich bin Robert Galen,“ sagte er fest und sicher, „Waffenmeister des Königs von Brandai.“
Auch der Fürst stand auf. „Das seid Ihr.“
„So wie Ihr der Fürst von Gorderley seid!“
Roman wich ihm nicht aus. „Genau so.“
Der Waffenmeister musterte seinen Gegenüber. „Ja, genau so“, wiederholte er, „genau so.“
Ohne ein weiteres Wort griff er nach seinem Umhang, den Tore über eine Stange neben dem Kamin gehängt hatte und ging hinaus.