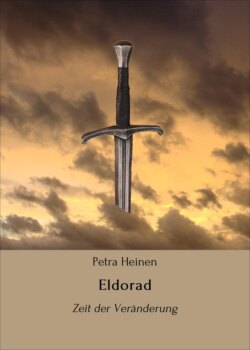Читать книгу Eldorad - Petra Heinen - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gespräche und Gefechte
ОглавлениеScheumond/Wandermond
Curfeld ließ sich nicht lange Zeit und besuchte schon in der folgenden Woche mehrfach den Fürsten. Er wusste, dass der Umbau der Armee Brandais alle seine Kräfte und vor allem seine Diplomatie verlangte, um die störrischen Adligen im Reich von seinen Maßnahmen zu überzeugen. Trotzdem fiel es ihm schwer, die Kritik des Fürsten hinzunehmen. Anfangs war Roman von Gorderley nur auf Nachfrage zu Kommentaren oder Vorschlägen zu bewegen, aber nach und nach packte ihn die Herausforderung der Materie und sie diskutierten bei jedem Treffen lebhafter – nun, gestand sich Curfeld ein, so lebendig wie es möglich war, wenn er selbst sich mühsam zurückhielt und versuchte, den gemessenen Tonfall zu finden, der ihn damals, als er gefangen im Zelt des Fürsten saß, so beeindruckt hatte.
Roman von Gorderley wies schonungslos auf die Mängel in Struktur und Organisation des brandaianischen Heeres hin und bestand darauf, bestimmte Anführer einfach abzusetzen, oder Befehlshierarchien zu verändern. Der Fürst akzeptierte nicht, dass es so unendlich viele Rücksichten zu nehmen galt. Die Adligen hatten dem König Treue geschworen und standen weitgehend zu ihren Eiden, aber untereinander gab es ein vielschichtiges Spiel um Einfluss, Gold und Positionen. Curfeld hatte zwar die volle Unterstützung des Königs, aber nicht unbedingt die der einflussreichen Familien, auch wenn das dem gordischen Fürsten schwer zu vermitteln war.
Überrascht hörte er deshalb zu, als der Fürst eines Tages eröffnete: „Ich habe über Eure Argumente nachgedacht und vielleicht muss man die Sache anders angehen. Von unten.“ Curfeld saß aufrecht auf dem einfachen Holzstuhl im Haus des Fürsten. Lieber wäre ihm für ihre Gespräche die komfortable Atmosphäre seiner eigenen Gemächer in der Burg gewesen, aber er konnte schlecht den Fürsten dorthin zitieren, ohne dass es einer Beleidigung gleichkam. Er hatte Roman von Gorderley angeboten, angemessenere Räumlichkeiten zu besorgen, aber der Fürst hatte abgelehnt.
Gespannt sah Curfeld ihn an und Roman fuhr fort: „Die einzelnen Ritter sind durchaus motiviert und ihr Stolz auf Brandai treibt sie an. Die Schwierigkeit ist, dass sie nur für sich handeln. Das gilt noch mehr für Eure Anführer, die zwar gute Krieger sind, aber nur selten strategische Talente.“
„Terweg war der Beste“, rutschte es Curfeld heraus, aber der Fürst stimmte nüchtern zu: „Ja, Terweg behielt stets die Übersicht, ein gefährlicher Gegner.“ Er erinnerte sich noch gut an seine Befriedigung, als er den brandaianischen Anführer in der Schlacht bei Langweiler tötete. Fast wäre Gorderley dort gescheitert, doch mit Terwegs Tod wendete sich das Blatt. Die Brandai verloren den Mut und flohen planlos vom Schlachtfeld. Nur das Erscheinen des Königs hatte einen glorreichen Sieg Gorderleys vereitelt. Melgardon konnte seine Truppen wieder bündeln und einen geordneten Rückzug organisieren. Der König war ohne Zweifel ein Pluspunkt auf der Seite Brandais, möglicherweise ein gleichwertiger Gegner für Elder von Gorderley. Berücksichtigte man die erschwerten Umstände, unter denen Melgardon sein Heer führen musste, war er wahrscheinlich der beste König aller Zeiten für das Reich.
„Eure einfachen Kämpfer sind nicht mehr als Bauern, denen man ein Schwert in die Hand drückt. Soweit ich gesehen habe, haben sie oft nicht einmal Schuhe an den Füßen. Ihre Ausbildung besteht darin, sie in den Kampf zu schicken. Ihr einziger Vorteil ist ihre große Zahl“, fuhr er fort, „wenn Ihr Eure Adligen dazu bringt, ihre Bauern zu schulen, erreicht Ihr gleich mehrerlei: Erstens sterben sie nicht so schnell. Zweitens lernen die Kommandeure die Stärken und Schwächen ihrer Krieger kennen. Drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, entsteht Vertrauen auf beiden Seiten. Die Anführer werden Männer, die sie kennen, nicht mehr sinnlos in den Tod schicken, und wenn die einfachen Krieger das spüren, werden sie besser und stolzer kämpfen, und verlässlicher.“ Roman verstummte und studierte Curfelds aufmerksames Gesicht. „Wenn es so schwer ist, wie Ihr sagt, Eure höchsten Ritter zum Umdenken zu zwingen, dann fangt unten an. Lasst die Bauern drillen von den einfachen Rittern und sorgt dafür, dass diese nicht gefürchtet, sondern respektiert werden.“
„Ihr kennt alle Eure Krieger persönlich?“, staunte Curfeld.
Roman schüttelte den Kopf. „Nicht alle namentlich, aber doch viele von ihnen. Und von meinen Kommandeuren verlange ich..“, er brach ab und korrigierte sich, „von meinen Kommandeuren habe ich verlangt, dass sie über ihre Männer Bescheid wissen. Je tiefer in der Befehlskette jemand steht, desto besser muss er die ihm unterstellten Männer kennen. Die kleinste Einheit in Gorderley ist ein Paar, machmal ein Doppelpaar. Jeweils zwei bis vier Krieger bilden eine Gruppe, die füreinander verantwortlich ist. Sie werden befehligt von einem Dom, der bis zu zwanzig Paare führt. Über dem Dom steht ein Gruppenführer, der 3-5 Einzelgruppen unter sich hat, und wiederum den Hauptleuten untersteht, die für größere Einheiten zuständig sind. Die höchsten Ränge haben die Unterführer, zur Zeit meiner Abreise gab es sieben, und meine beiden Anführer Rascal und Timbermeyn, die mir direkt unterstellt waren.“ Er lehnte sich zurück und ließ die neuen Informationen auf Curfeld wirken.
Der seufzte innerlich. Die Regelungen waren beneidenswert klar. In Brandai bestimmte der Reichtum eines Adligen die Größe des Kontingentes an Rittern, die mit ihm in die Kriege zogen, und nicht minder seine persönliche Bereitschaft, die Männer der eigenen Dörfer zum Kriegsdienst zu zwingen. Zudem galt es, die eigene Familie mit Positionen im Heer zu versorgen, dieses Recht würde keine Familie aufgeben wollen. Geradezu utopisch schien die Vorstellung, dass ein Ritter für sein Fußvolk verantwortlich sein sollte. Die Landknechte mussten gehorchen und mit ihren Körpern den Feind aufhalten, bis ein Ritter den Kampf aufnahm, dafür waren sie da. Curfeld wäre nie einfallen, sie als Krieger zu betrachten und er überlegte mit einem Anflug von Schuldgefühl, dass er von den Feldknechten, die seine Familie dem König stellte, keinen einzigen kannte. Es waren wahrscheinlich immer andere, da die Bauern, wenn sie erst einmal heirateten, nur ungern ihre Höfe verließen und man gewöhnlich die ungebundenen jungen Männer zum Dienst heranzog.
„Ich habe keine Zeit, mich mit ein paar Bauern durch die Felder zu schlagen“, wandte er vorsichtig ein. Ernst entgegnete der Fürst: „Aber Ihr könnt dafür sorgen, das es jemand anderes macht, dem wiederum Ihr vertraut. Ach, Ihr solltet sie außerdem ausreichend verpflegen.“
„Die Landknechte müssen von ihrem Heimatdorf versorgt werden“, erklärte Curfeld, und verstummte, denn er begriff plötzlich, was der Fürst sagen wollte. Das Versorgungssystem des Heeres war Teil des langen Gespräches beim König gewesen, Zollberg hatte immer wieder in diesem Punkt nachgefragt. Die Feldknechte in Brandai bekamen nur einfache Kost und litten oft Hunger, wenn sie aus der Heimat nicht genug Nahrung erhielten, was in Kriegszeiten eher die Regel war. Aber sollte ein Bauer speisen wie ein Ritter? Der Gedanke war absurd und dennoch lag es auf der Hand, dass ein wohlgenährter Kämpfer sich nicht nur besser schlug, sondern auch motivierter war. „Wollte Ihr wirklich sagen, dass die gordischen Krieger so gut kämpfen, weil sie gut essen können?“, fragte er trotzdem ungläubig.
„Was erhält ein brandainischer Bauer, wenn er einen Feldzug überlebt?“, stellte der Fürst eine Gegenfrage.
Curfeld sah ihn verwirrt an. „Was sollte er erhalten? Er kehrt zurück in sein Dorf. Mit dem Plünerlohn, wenn es etwas zu plündern gab.“
„Genau“, nickte Roman, aber als Curfeld schwieg, schüttelte er verwundert den Kopf. „Ist das denn so schwer zu begreifen? Ihr holt Eure Bauern aus ihren Dörfern und schickt sie in den Krieg für das Reich. Sie erhalten keine Ausbildung, keine anständige Kleidung, nicht einmal genug zu essen und kaum Aussicht auf Lohn. Wenn Eure Götter sie überleben lassen, schickt man sie heim. WOFÜR sollen sie kämpfen? Wisst Ihr, dass wir bei Eurem Fußvolk mit einem Verhältnis von 5 zu 1 rechnen? Ein gordischer Krieger, ich spreche nicht von den Rittern, sondern von den einfachen Kriegern, kann es mit fünf Eurer Bauern aufnehmen. Ist Euch das nie aufgefallen?“
Curfeld senkte den Blick auf seine gefalteten Hände. Doch, natürlich war der Umstand auch den Anführern in Brandai nicht entgangen. Aber es war bisher nicht von Bedeutung gewesen, es gab ja so viele. Die Unfreien gebaren genug Kinder, um das Heer immer wieder aufzufüllen. Manche höheren Adligen behaupteten sogar, dass ohne die ständigen Kriege die Armen überhand nehmen würden. Doch der Fürst hatte recht: Ihre zahlenmäßige Überlegenheit brachte den Brandai keinen Vorteil im Krieg gegen das Fürstentum. Aber wie sollte man das ändern? Was der Fürst forderte, kostete Zeit und vor allem Gold, viel Gold.
Plötzlich schien ihm seine Aufgabe unlösbar. Nicht nur Zeit und Gold waren nötig, sondern ein vollständiges Umdenken. Es war eine Ironie des Schicksals, das ausgerechnet ein Gorderley ihm zu mehr Menschlichkeit riet! Curfeld stützte den Kopf in die Hände und starrte eine Weile auf die blanke Tischplatte. Dann atmete er tief durch und sah auf. „Ich spreche heute noch mit den König und reite morgen nach Großfellen, dem Stammsitz meiner Familie. Wer anders als ich selbst könnte den Anfang machen.“ Er stöhnte: „Schuhe, Kleidung, gutes Essen… man wird Anwerber überrennen.“
„Wäre das nicht in Eurem Sinn?“, lächelte der Fürst spöttisch.
Curfeld erhob sich. „Wenn Ihr erlaubt, beenden wir unser Gespräch für heute. Es ist alles nicht so einfach, wie Ihr vielleicht denkt.“
Der Fürst begleitete den Brandai zur Türe. „Ihr wollt Berge versetzen, nicht ich.“
„Die Schwierigkeit ist nicht der Berg, Fürst Gorderley. Jeder kann Berge versetzen, wenn er sich nur entschließt, anzufangen. Das Problem ist die Zeit.“
Nachdenklich musterte Roman den Ritter. Der Brandai hatte ihn schon damals beeindruckt, als er in aussichtsloser Lage so stolz seine Haltung wahrte. Curfeld würde nicht aufgeben für sein Ziel zu arbeiten, egal wer oder was sich ihm entgegen stellte. „Wenn jemand einen Weg findet, die Zeit anzuhalten, seid Ihr es“, antwortete er knapp und entließ den erstaunten Curfeld mit einer angedeuteten Verbeugung in den Vormittag.
Wenige Stunden später machte er sich auf den Weg in die Burg. Roman hatte den König seit der Aussprache nicht mehr gesehen und das zweite Treffen immer wieder hinausgezögert. Diese letzte Beichte war die schwerste und erst Curfelds verzweifelte Entschlossenheit brachte ihn dazu, sich auf seine Aufgabe zu besinnen. In den königlichen Audienzräumen bat man ihn zu warten, dann wurde er weiter vorgelassen und musste beim königlichen Sekretär nochmals sein Anliegen vorbringen. Er wusste, dass man ihn schikanierte und blieb gelassen, als die Zeit verstrich. Man hatte ihn in ein kleines Zimmer geführt, dessen Wände mit Seidentapeten ausgekleidet waren. Eine gepolsterte Bank mit einem Bezug im gleichen Muster lud zum Sitzen ein, aber Roman ging langsam hin und her, blieb manchmal an dem hohen Fenster stehen, um in einen kleinen Hof hinab zusehen, wo der Schatten eines kümmerlichen Baumes langsam voran schlich, ohne dass etwas geschah. Schließlich nahm er doch Platz und lehnte sich zurück. Er bezweifelte, dass er auf Veranlassung des Königs warten musste, aber seine Stellung erlaubte ihm keinen Protest, obwohl ihn verärgerte, nicht einmal etwas Wasser angeboten zu bekommen. Die Brandai missachteten die grundlegenden Formen von Höflichkeit und Gastfreundschaft, wie sie in Gorderley sogar einem Feind entgegen gebracht wurden.
Die Sonne hatte ihren ihren höchsten Stand längst überschritten als der Sekretär erschien und verkündete, der König sei bereit, ihn zu empfangen. Wortlos folgte Roman dem Hofbeamten durch verschiedene Vorzimmer bis zu einer Tür, vor der ein Wachposten stand. Der Sekretär öffnete die Türe und wich zur Seite, so dass Roman an ihm vorbei die Arbeitsräume des Königs betreten konnte.
König Melgardon saß an einem mit Schriftrollen und Pergamenten bedeckten Tisch und blickte bei seinem Eintreten auf. Auf sein Zeichen zog sich der Sekretär zurück und schloss die Türe. Roman lauschte einen Moment auf das Klacken, mit dem das Schloss einrastete und hoffte, dass er in diesen Räumen vor Lauschern sicher war. Sein letztes Geständnis war nur für den König bestimmt. Als er niederknien wollte, erhob sich Melgardon und kam ihm entgegen.
„Das ist nicht notwendig.“
Roman hielt inne und sah ihn fragend an. In Gorderley war es unüblich, dass die Ritter vor dem Regenten knieten, doch in Brandai gehörte es zum angemessenen Verhalten jedes Untereren gegenüber seinem Herrn und er war willens, sich diesem Brauch zu fügen. Melgardon jedoch schüttelte den Kopf: „Spart Euch das für die offiziellen Anlässe, Fürst Gorderely. Ich bedaure, dass es dort unverzichtbar bleibt.“
Noch immer schien Melgardon die Wendung der Geschicke wie ein Traum und vor den Augen des Hochadels würde der Fürst seine Ergebenheit bezeugen müssen, um den fragilen Frieden innerhalb Brandais Ritterschaft nicht zu sprengen, aber er hatte nicht vor, den Gorderley mehr zu demütigen als notwendig. Mit einer einladenden Handbewegung geleitete er den Fürsten zu einem Sessel am Fenster, nahm in einem zweiten Platz und schenkte selbst aus einer Karaffe Wasser in zwei geschliffene Gläser. „Wein?“
Roman von Gorderley schüttelte den Kopf und der König lehnte sich zurück. „Fürst Gorderley, was führt Euch zu mir?“, fragte er ohne lange Einleitung.
Roman drehte das Wasserglas in der Hand und betrachtete einige Herzschläge lang die Lichtreflexe der Sonne im glitzernden Kristall. Obwohl es unhöflich war, nicht sofort zu antworten, brauchte er noch einen Augenblick, um Kraft zu sammeln für das Geständnis. Er trank einen Schluck und nach einer Pause einen weiteren, bevor er das Glas zurück stellte und den König ansah. „Herr“, begann er, „es gibt noch etwas, das Ihr wissen müsst.“
Als er endete, schwieg der König lange, bevor er ruhig fragte: „Elder von Gorderley benutzt also dunkle Magie. Ist das der Grund für Eurer Hiersein?“
Das Gesicht des Gorderley war eine starre Maske. Die Preisgabe dieser Wahrheit musste ungeheuer schmerzlich für ihn sein. Seine Stimme war tonlos, als er antwortete: „Der Fürst verrät Gorderley und alles, wofür das Fürstentum steht. Wir haben schon immer die dunklen Kräfte in Eldorad bekämpft. Fürst Elder gibt Gorderleys Seele preis. Ich verrate das Land, aber wenn Brandai das Fürstentum erobert, wird es frei untergehen und die Menschen können ihren Stolz bewahren auf das, was gewesen ist.“
Roman von Gorderley gab sich keine Mühe, die Abscheu vor seiner eigenen Tat zu verbergen. Die Wiedereingliederung Gorderleys in das Reich war eine Niederlage, das Ende eines fast tausendjährigen Ringens um Eigenständigkeit. Statt den Thron von Brandai zu erobern und das Reich unter seiner Herrschaft zu vereinen, wie es noch vor wenigen Monaten möglich schien, gab er seine Heimat in die Hände und Gnade des Königs, den er Zeit seines Lebens bekämpft hatte. Melgardon bedauerte, dass der junge Fürst nicht in der Lage war, darin die Chancen für einen Neuanfang zu sehen. Aber darum konnte man sich später kümmern, zunächst musste die Schlacht geschlagen werden. Er trommelte mit den Fingern auf der Armlehne. „Es wird nicht leichter werden. Aber vielleicht bringt es uns auch einen Vorteil, mit dem der Fürst nicht rechnet.“ Nachdenklich legte er die Hände zusammen: „Die Stärke Eurer Armee war immer ihr Zusammenhalt, über die kämpferischen Eigenschaften hinaus. Elder von Gorderley kann die Magie nicht offen nutzen, das würde seinen Wahnsinn jedem deutlich machen.“
Roman folgte seinen Gedanken: „Es wird Verunsicherung geben, früher oder später. Aber Gorderleys Kampfkraft ist dennoch zu groß.“
Der König stand auf. „Ich bin mir sicher, dass Fürst Elder einen großen Fehler gemacht hat. Ich weiß noch nicht, wie wir das nutzen können. Aber ich bin Euch dankbar, für Eure Offenheit.“ Er machte eine Pause. Auch Roman von Gorderley hatte sich erhoben und wartete auf ein Zeichen, sich entfernen zu dürfen.
„Fürst Gorderley, ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um das Fürstentum zu retten, Brandai und Gorderley brauchen einander. Wir werden einen Weg finden“, erklärte Melgardon fest.
Überrascht blickte Roman auf die ausgestreckte Hand des Königs und ergriff sie schließlich, dabei senkte er den Blick. „Zu Eurem Befehl, mein König.“
Melgardon blickte ihm noch lange gegen die geschlossene Türe nach. Vielleicht war das eine der größten Schwächen Romans von Gorderleys: Für ihn gab es stets nur eine Seite: Gut oder schlecht, Freiheit oder Knechtschaft, ohne einen Spielraum für Zwischenlösungen.
Und dann kam ihm der Gedanke, dass Elder von Gorderley noch einen weiteren Fehler begangen hatte: Die absolute Integrität seines Sohnes zu unterschätzen, kam das Fürstentum nun teuer zu stehen. Der König setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und gönnte sich ein frohes Lächeln. Zwei Fehlurteile eines Feindes, der bisher unfehlbar schien - wenn er selbst klug und besonnen handelte, hatte Brandai vielleicht eine Chance.
Roman von Gorderley lief eine Weile ziellos durch die Stadt. Er fühlte sich nicht erleichtert, nur abermals beschämt und enttäuscht. Immer wieder hörte er Elder von Gorderley sprechen, ohne Schuldgefühl, ja, ohne sich der Ungeheuerlichkeit seines Tuns bewusst zu sein.… seit die Göttin ihm das Verbrechen offenbart hatte, war sein Vater für ihn gestorben und sein eigenes Leben zerbrochen. Er konnte nur die Schuld abtragen, die Elder von Gorderley über sein Volk gebracht hatte, die Schuld, deren ganzes Ausmaß er noch immer nicht hatte zugeben können.
Nach einer Weile lenkte er seinen Weg in das Viertel der Kleidermacher. Als er aufbrach, hatte er nur das Nötigste für den langen Ritt mitgenommen. Seine Zukunft schien in den Kerkern Brandais zu enden. Der König hatte anderes entschieden, so dass er sich langsam für ein Leben in Undidor einrichten musste. Gold besaß er genug, er trug nicht nur einen Beutel mit fast 400 Münzen bei sich, echte schwere Gorderley-Taler, von denen jeder das vierfache eines brandaianischen Goldstückes wert war, sondern noch ein Säckchen mit geschliffenen Edelsteinen, die hier in Brandai ein Vermögen darstellten, von dem er Jahre würde leben können.
Bei einem Schneider ließ er sich Hemden anmessen, dazu zwei Hosen aus Leder und feinem Wolltuch. Einen Schuster beauftragte er mit der Fertigung neuer Leisten für Stiefel. Zum Schluss erstand er noch einige Meter Baumwolltuch, das er bei einer Näherin ließ, um daraus Unterhemden und Hosen anzufertigen. In Gorderley kannte man keine Baumwolle, aber ihm gefiel die Luftigkeit des Materials. Zwar mochte der Stoff die Wärme weniger halten, als seine gewohnte wollene Wäsche, doch das spielte im Tiefland Brandais, wo selbst die die Winter warm waren, keine Rolle.
Für die meisten Dinge seines persönlichen Bedarfs beauftragte er gewöhnlich Tore, der sich halbwegs anstellig zeigte, doch heute besuchte er noch mehrere Läden und Handwerker um Rasierzeug, Schleifsteine, Papiere, Federn und Tinte zu erwerben. Alle Waren ließ er in sein Haus schicken. Oft staunte er über die Preise. Scheinbar alles, was in Gorderley teuer und selten war, war hier in vielfältiger Form zu Spottpreisen erhältlich. Luxusgüter wie Glas, bunte Stoffe aus unbekannten Materialien, Papier, sogar vollständige Bücher fand er in den Auslagen einiger Händler für wenig Geld. Dagegen waren Gegenstände aus Metall jeder Art unbegreiflich teuer, schon einfache Messer für den Küchengebrauch kosteten bis zu zehn Silberstücke. Geschirr bestand in erster Linie aus Holz oder Glas, Zinnteller fand er überhaupt nicht, ebensowenig Becher. Nach einer Lampe suchte er ebenfalls vergebens, die Brandai benutzen scheinbar nur Kerzenlicht und hatten die Vorteile von Petroleum noch nicht erkannt. Die letzten Worte des Königs schossen ihm in den Sinn: Gorderley und Brandai brauchen einander, tatsächlich mochte ein Handel zwischen den Ländern Nutzen für beide bringen. Dass es in Brandai irgendetwas Brauchbares mit Ausnahme von Sklaven für Gorderleys unersättliche Bergwerke geben könnte, war neu und überraschend.
Zum Schluss schlenderte Roman über einen der Märkte, auf denen Bauern der Umgebung täglich ihre Feldfrüchte feil boten. Die Vielfältigkeit des Angebots war faszinierend und Roman kannte kaum die Hälfte des Obstes und Gemüses auf den Tischen und Karren. Von Anfang an hatte er Tores Küche erstaunlich abwechslungsreich empfunden, obwohl sein Diener sicher kein Meister der Kochkunst war. Inzwischen wunderte er sich nicht mehr, gab es doch allein mindestens vier verschiedene Sorten Kartoffeln, Rüben in allen Farben und Formen, Gartenfrüchte, grüne und blaue Trauben, Zitronen und Orangen, die er nur vom Hörensagen kannte – Brandais Boden kam an Fruchtbarkeit der Ebene von Eloi gleich, nur dass die Brandai offenbar bedeutend einfallsreicher in seiner Nutzung waren, als die Einwohner der gordischen Provinz.
Feldfrüchte und Brot kosteten zudem nur einen Bruchteil dessen, was er aus Gorderley gewohnt war. Er fragte sich, wie die Bauern unter diesen Bedingungen überleben konnten, bis ihm einfiel, dass es in Brandai statt freier Bauern nur Leibeigene gab, ein an Sklaverei angelehnter Status, der auf die Lebensumstände der Betroffenen kaum Rücksicht nahm.
Gegen Abend begab er sich zurück zur Burg. Der Waffenmeister hatte um ein Treffen gebeten und Roman freute sich auf die Aussicht eines guten Waffenganges. Die Spätsommersonne sandte ihre Strahlen über die polierten Marmorlöwen, als er die Stufen zu der Trainingshalle hinauf stieg. Der Waffenmeister lehnte mehrere Meter von der Türe entfernt an der Wand und sah ihm entgegen, ansonsten war die Halle leer. Hinter ihm fiel die Türe ins Schloss, als er als aus den Augenwinkeln ein Aufblitzen wahrnahm. Sofort riss er den linken Arm hoch und fing den fliegenden Shuriken mit dem bloßen Unterarm ab. Scharfe Zacken bohrten sich in den Muskel, doch er ignorierte den Schmerz. Automatisch rief er sein Schwert in die Hand, statt es umständlich zu ziehen und wehrte einen zweiten Kampfstern ab. Dann war der Waffenmeister vor ihm. Galen trug keine Rüstung, war aber mit Schwert und Dolch bewaffnet und warf sich ohne ein Wort in den Kampf. Sein Angriff drängte den Fürsten bis zur Türe zurück. Roman konnte die blitzschnell aufeinander folgenden Hiebe zunächst nur parieren und den Stichen des Dolches ausweichen, doch schließlich verschaffte ihm ein Konterschlag genug Bewegungsspielraum, um zur Seite zu weichen und seinerseits anzugreifen. Der Waffenmeister beherrschte den beidhändigen Kampf perfekt. In einer Bewegung wehrte er Romans Klinge mit dem Parierdolch ab und griff gleichzeitig mit dem Schwert an. Er kämpfte ohne Rücksicht auf sich selbst und auch als Roman ihn das erste mal traf, beeinträchtigte die blutende Armwunde seine Zielstrebigkeit nicht. Mit der tödlichen Konsequenz des Kampfsklaven gab er keine Sekunde nach, selbst als er durch eine weitere Attacke an der Hüfte verletzt wurde.
Roman von Gorderley war von dem Angriff überrascht worden, aber langsam stellte er sich auf den Waffenmeister ein. Dies war offensichtlich kein Übungskampf. Galen setzte gnadenlos sein ganzes Können und die Erfahrung seiner Jahre ein, um ihn zu verletzen oder zu töten, zumindest um jeden Preis nieder zu ringen. Mehrfach unterlief er die Deckung des Fürsten und schlitzte mit der Schwertspitze die Kleidung bis zur Haut auf, konnte aber keinen entscheidenden Treffer landen.
Darauf drang er immer wilder und heftiger auf den Fürsten ein, doch diesem gelang es zunehmend besser, die Hiebe abzulenken und mit geschickten Paraden die Wucht des Angriffs am Ziel vorbei zuleiten. Je länger der Kampf dauerte, desto flüssiger und schneller bewegte er sich. Es gab selbst in Gorderley nicht viele auch nur annähernd gleichwertige Gegner für ihn und trotz der Gefahr erfüllte ihn feurige Erregung. Sein Schwert wurde zu einer Wand aus kurzen Hieben und Stichen und dann sprang er aus dem Stand in die Luft, wechselte die Richtung und schlug Galen bei der Landung mit einem Drehschlag den Parierdolch aus der Hand. Der Waffenmeister änderte sofort seine Taktik und wehrte die Angriffe des Fürsten mit dem Schwert ab, doch nun erhöhte Roman das Tempo. Er fühlte sich jetzt völlig in seinem Element. Galen wollte den Kampf? Er sollte ihn bekommen! In einer Reihe von Abwehrbewegungen bereitete er seinen nächsten Ausfall vor und verschob seine Position solange, bis Galen die Chance auf einen tief angelegten Hieb auf den rechten Schwertarm des Fürsten sah. Im gleichen Moment wechselte Roman sein Schwert in die linke Hand und sprang vor. Sie prallen gegeneinander und er packte die Hand des Waffenmeisters und presste sie zusammen Mit einem Seitschritt schwang er sich in Galens Rücken und drückte ihm die Klinge gegen die Kehle: „Lasst los!“, rief er und zog gleichzeitig den Schwertarm des Waffenmeisters nach hinten. Galen wehrte sich noch einen Augenblick, dann spürte Roman wie er sich entspannte und seine Waffe fallen ließ. Er stieß ihn von sich und behielt sein Schwert wachsam erhoben, bereit, den Kampf fortzusetzen, doch Galen lehnte sich keuchend gegen die Wand.
„Was sollte das?“, fragte Roman wütend, „das ist kein Spiel!“
Galen presste die Hand auf die Hüfte, wo das Blut seine Kleidung rot verfärbte. „Ich musste es wissen“, keuchte er, „ich wollte wissen, ob ich Euch schlagen kann.“
Roman fühlte das Blut an seinen Arm entlang rinnen. Der Wurfstern war durch die Kampfbewegungen heraus gefallen und hatte eine zackige Wunde hinterlassen. Galen hatte auf den Hals gezielt, bei einem Treffer wäre der Kampf schnell zu Ende gewesen. Roman trat einen Schritt zurück und schob das Schwert in die Scheide. „Und was hätte es Euch gebracht? Zu siegen gegen einen Mann, der Euch nicht töten darf?“
„Ich habe ja verloren.“ Galen legte den Kopf gegen die Wand und schloss die Augen. Sein Atem ging schwer und nun, wo die Spannung des Kampfes vorbei war, spürte er die Schmerzen der Verletzungen.
„Und ich habe Glück, dass Ihr noch lebt.“ Roman hielt seinen Ärger nur mühsam im Zaum.
Galens öffnete die Augen und wies mit dem Kinn auf den kleinen Tisch neben dem Kampfpodest am anderen Ende der Halle. „Dort ist alles aufgeschrieben. Dass ich Euch gefordert habe. Falls ich dabei sterbe.“
Roman trat auf ihn zu und zog ihm die Hand von der Hüftwunde. Galen ließ es geschehen. Ein tiefer glatter Schnitt, der keine inneren Organe verletzte. Daran würde der Waffenmeister nicht zu Grunde gehen in einer Stadt, wo Heilmagier ihre Kunst sogar auf Marktplätzen anpriesen. Roman schüttelte den Kopf: „Und so wolltet Ihr mich entlasten? Wenn Euer Leben Euch nichts gilt, sucht Euch einen anderen Henker. Ich habe genug Schwierigkeiten, ohne den Waffenmeister von Brandai zu erschlagen.“ Er wollte sich abwenden, aber Galen stieß sich von der Wand ab und richtete sich sich auf. „Fürst Gorderley, bitte! Könnt Ihr mich nicht verstehen?“
Roman hielt inne und musterte den Brandai, der ihn beinahe flehend ansah. Seine Wut fiel in sich zusammen. Er hätte schon nach ihrem ersten Zusammentreffen wissen müssen, dass für ein Kämpferherz wie den Waffenmeister ein unverbindlicher Übungskampf nicht ausreichte. Seit seiner Flucht aus Gorderley hatte er wahrscheinlich nie mehr sein Potential wirklich ausschöpfen müssen, für einen echten Krieger war diese Herausforderung unvermeidlich gewesen. Galen hatte ihn zwar ohne Warnung angegriffen und sich damit einen Vorteil gesichert, aber wie sonst hätte er den Fürsten in einen ungehemmten Kampf verstricken sollen? Sanft entgegnete er: „Doch, ich verstehe Euch. Ihr seid ein hervorragender Kämpfer. Beim nächsten Mal könnte es nicht so gut für mich ausgehen.“
Der Waffenmeister lachte bitter auf. „Ihr seid sehr freundlich, Fürst Gorderley. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Wenn Ihr trotzdem noch einmal erwägt, mit mir zu fechten, würde ich es als eine Ehre betrachten. Ist Euch mein Wort genug?“ Obwohl Galen ihn geradeheraus ansah, spürte Roman seine Zerrissenheit.
„Das Wort des Waffenmeisters von Brandai ist immer genug“, antwortete er ernst. Galen blieb schweigend stehen und Roman begriff erst nach einer Weile, dass der Brandai ihm das Vorrecht einräumte, die Begegnung zu beenden. „Ihr solltet Euch um Eure Wunde kümmern“, sagte er schließlich. Galen presste wortlos die Hand auf die Hüfte und humpelte schwerfällig durch die Halle zu seinen Privaträumen.
Draußen spielten die letzten Sonnenstrahlen auf den Giebeln der Häuser. Die Gassen lagen bereits in abendlicher Dämmerung und hinter den Glasfenstern leuchteten Kerzen auf. Nachdenklich schritt der Fürst durch die Straßen und tastete dabei über die Schnitte und Kratzer, die er davongetragen hatte. Nur die Wunde am Arm, die der Wurfstern gerissen hatte, war bedenklich. Sie blutete nicht mehr, aber die Haut fühlte sich heiß an und schmerzte bei der Berührung. Zurück in seinen Räumen ließ er sich warmes Wasser bringen und wusch den tiefen Schnitt sorgfältig aus. Mit einem Messer entfernte er lose Hautlappen und drückte die auseinander klaffenden Ränder mit einem Verband zusammen, wobei er unterdrückt fluchte. Die Hand blieb beweglich, unter Schmerzen zwar, aber es schienen keine wichtigen Muskeln betroffen. Wenn die Wunde ohne Entzündung verheilte, würde er keine Beeinträchtigungen zurückbehalten. Er hatte Glück gehabt. Wieder einmal.