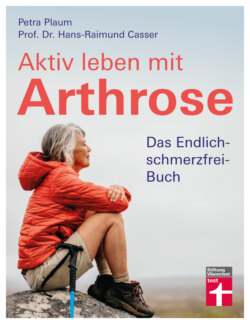Читать книгу Aktiv leben mit Arthrose - Petra Plaum - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWas passiert beim Facharzt?
Der Termin bei einem Facharzt ist ein positives Ereignis – er kann dazu beitragen, dass es Ihnen bald viel besser geht.
Wenn Sie sich in Arztpraxen so wohlfühlen wie in Ihrer Lieblingsgaststätte, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Bei einigen Menschen steigt jedoch schon der Blutdruck, sobald sie nur den typischen Praxisgeruch aus Putz- und Desinfektionsmittel in die Nase bekommen. Fremde Menschen, fremde Räume, die Sorge, dass doch eine schlimme Diagnose gestellt wird: Nicht jeder steckt das locker weg.
Haben Sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, ist die Anspannung womöglich groß. Doch jeder Arztbesuch ist eine neue Chance, auf Verständnis und Hilfe zu stoßen. Wenn Sie schon jahrelang keinen Facharzttermin mehr hatten, werden Sie sich vermutlich wundern: Die Atmosphäre ist in vielen Praxen heute entspannt und gemütlich, das ärztliche Selbstverständnis ist ein anderes geworden.
Wie die Untersuchung beim Orthopäden abläuft
Schildern Sie dem Arzt, was genau Ihre Beschwerden sind und was Sie am meisten belastet. Ihr Orthopäde wird sich die betroffenen Gelenke anschauen, abtasten und wissen wollen, wie häufig diese angeschwollen sind. Hier sollten Sie aufzählen können, wann die Gelenke besonders weh tun – morgens, abends, in Ruhe, nach einer Belastung – und ob Sie manchmal weitere Symptome verspüren, z. B. ein Schwächegefühl oder Zittern. Ihr Schmerztagebuch dient Ihnen dabei als Gedächtnisstütze.
Auf dem „Laufsteg“
Wenn Sie auf Arthrose im Rückenbereich oder der Hüfte, im Knie, Sprunggelenk oder einer Großzehe hin untersucht werden, erfolgt häufig eine Gangbeobachtung, bei der Sie ein paar Mal vor Ihrem Orthopäden hin-und herlaufen, damit er eine eventuelle Fehlstellung erkennen kann. Denn angeborene oder später erworbene Fehlstellungen der Hüfte oder der Beinachse sind gar nicht selten und können dazu beitragen, dass die Arthrose schnell voranschreitet. Werden diese ausgeglichen, kann bereits das zu einer Linderung der Beschwerden führen.
Vorsicht Gelenkerguss
Vor allem Arthrose im Kniegelenk löst oft Ergüsse aus. Das betroffene Gelenk schwillt an, die Haut spannt sich, die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Ihr Orthopäde wird in diesem Falle erst das Gelenk abtasten und gegebenenfalls auch eine Punktion durchführen. Diese schafft sofort eine Entlastung Ihres Gelenks und zeigt auf, ob sich wirklich nur im Übermaß gebildete Gelenkflüssigkeit im Erguss befindet oder ob Blut infolge einer Verletzung oder Eiter infolge einer Infektion beigemengt sind. Mit Blut oder Eiter werden Sie sofort weiterbehandelt. Bei Gelenkergüssen infolge der Arthrose dienen Kühlen, Schmerzmittel und Schonung der Heilung, später folgt Bewegung, um dem Voranschreiten der Arthrose mit neuen Gelenkergüssen vorzubeugen.
Stellen Sie Fragen!
Fragen Sie Ihren Orthopäden, worauf er an Ihrem Gang besonders achtet und was er aus Ihrer Haltung und Ihrem Schritt ableitet. Wenn er Ihre Gelenke und Muskeln abtastet, haken Sie freundlich nach, was er dabei erkennen kann.
Vermutlich testet er auch Ihre Muskelkraft, Beweglichkeit und Stabilität mithilfe einfacher Übungen. Bitten Sie ihn um eine Einordnung, ob alles altersgemäß oder eher ungewöhnlich ist. Haben Sie Arthrose in den Fingern oder Zehen, ist keine Gangbeobachtung nötig. Je aufgeregter Sie bei der Untersuchung sind, desto mehr hilft Ihnen nun Ihr „Spickzettel“ oder Ihre Begleitperson.
Wenn die Chemie nicht gleich stimmt
Bleiben Sie ruhig, falls Ihr Arzt Allgemeinplätze von sich gibt, wie: „Wenn Sie abnehmen würden, hätten Sie weniger Beschwerden“ oder „Mit regelmäßigem Sport ginge es Ihnen besser“. Denn erstens könnte da durchaus etwas dran sein (siehe S. 73), zweitens sind das statistische Zusammenhänge, die jedem Medizinstudenten sehr früh im Studium vermittelt werden – das ist also nicht persönlich gemeint. Auch wenn es netter verpackt sicher angenehmer wäre. Aber Ihr neuer Orthopäde kennt noch nicht Ihre ganze Geschichte. Später würde er womöglich anders urteilen und auch sensiblere Aussagen machen.
Nicht alles dulden
Sie sollten skeptisch werden, wenn Sie sich von oben herab behandelt fühlen oder allzu schnell eine Diagnose bekommen – ohne körperliche Untersuchung, ohne dass Sie auf- und abgehen und Ihre Muskelkraft unter Beweis stellen mussten. Haken Sie in diesem Fall unbedingt nach.
Bildgebung: Eile mit Weile
Wundern Sie sich nicht, wenn Sie zunächst nicht geröntgt werden und auch keine Überweisung in die Röhre für ein MRT (siehe S. 38) erfolgt: Für die Diagnose Arthrose ist das anfangs nicht unbedingt wichtig. Früher wurde sehr schnell eine Bildgebung durchgeführt, das hat sich aber nicht bewährt. Da das Stadium des Verschleißes und die individuellen Beschwerden oft auseinanderklaffen (siehe S. 54), reichen Bilder allein nicht aus, um sinnvolle Therapievorschläge zu machen. Bildgebung ist nur in Kombination mit anderen Untersuchungen aussagekräftig. Wenn sich abzeichnet, dass eine Physio-, Wärme- oder Kältetherapie, eine Einlagenversorgung oder ein gewisses Medikament Ihnen guttäte, kann auch vor einer Bildgebung die Therapie beginnen und Ihr Gelenk im späteren Verlauf mit Röntgen, Sonografie oder MRT kontrolliert werden.
Fragen Sie nach! Bilder allein sagen Nicht-Medizinern wenig. Fragen Sie darum Ihre Ärztin, was an Ihrem Befund auffällig ist und woher Ihre Schmerzen kommen könnten.
Welche Bildgebung zeigt was?
Röntgen und Sonografie genügen oft für die Erstdiagnose, aufwendigere Bildgebungen folgen, wenn das Ihrem Orthopäden wichtig erscheint oder die ersten Behandlungen keine Linderung bringen. Röntgen funktioniert heute meistens digital und mit viel geringerer Strahlenbelastung als früher. Im Röntgenbild zeigen sich jedoch nur Knochenveränderungen und der verringerte Zwischenraum zwischen den Knochen. Schmerzhafte Ergüsse und frühe Knorpelschäden bleiben unerkannt. Die Sonografie, also der Ultraschall, erlaubt kaum Aussagen über den Zustand von Knorpel und Knochen, aber über oberflächliche Strukturen des Gelenks sowie den Zustand der Sehnen und Schleimbeutel. Auch Frühsymptome, wie die Entzündung der Gelenkschleimhaut oder ein Gelenkerguss, werden sichtbar. Viele Facharztpraxen können sofort ein Ultraschallbild machen und so einen ersten Eindruck vom Gelenkzustand gewinnen.
Aufwendigere Bildgebung
Wenn die grundlegenden Untersuchungen keinen eindeutigen Befund ergeben haben, stehen weitere bildgebende Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihnen Ihr Arzt verordnet. Auch bei einer Verschlimmerung der Beschwerden im Verlauf einer Behandlung oder vor einer Operation können sie hilfreich sein:
Kontrolltermin nicht vergessen! Ergreifen Sie noch in der Praxis die Initiative, und vereinbaren Sie einen Termin für die nächste Untersuchung. Denn Sie möchten ja eine Einschätzung, ob die Physiotherapie und/oder Lebensstiländerungen etwas gebracht haben. Und vielleicht brauchen Sie auch gleich das nächste Rezept für die Physiotherapie. Mehr dazu verrät Kapitel 4 ab S. 79.
Skelettszintigrafie: Sie trägt unter anderem dazu bei, unerkannte Frakturen auszuschließen oder sichtbar zu machen, in welchen Gelenken Entzündungen vorliegen. Der Patient bekommt eine schwach radioaktive Substanz in eine Armvene gespritzt, die dann zwei bis drei Stunden Zeit hat, sich in den Knochen einzulagern. Anschließend untersucht der Arzt mit einer sogenannten Gammakamera den Knochenstoffwechsel. Entzündliche Prozesse werden dabei ebenso sichtbar wie andere Auffälligkeiten. Damit die radioaktive Substanz schnell über die Nieren wieder ausgeschieden wird, sollten Sie rund um Ihren Termin viel trinken. Bei Schwangeren und stillenden Müttern kommt die Skelettszintigrafie nur in Ausnahmefällen zum Einsatz.
Kernspin- oder Magnetresonanztomografie, kurz MRT: Sie arbeitet mit starken Magnetfeldern und Radiowellen, ohne radioaktive Strahlung. Auch Knorpelschäden, entzündliche Veränderungen der Bänder und der Sehnen, Knochenschäden und Tumore können so festgestellt werden. Sie ist sinnvoll, wenn Röntgenbild und Ultraschall allein nicht erklären, woher die Schmerzen kommen, sowie vor geplanten Gelenk-OPs.
Computertomografie (CT): Weil die CT mit Röntgenstrahlung arbeitet, besteht eine höhere Strahlenbelastung als bei der MRT (Magnetresonanztomografie). Dafür ermöglichen CT-Aufnahmen deutlich mehr als normale Röntgenbilder: Der Körper wird aus allen Winkeln schichtweise fotografiert, darum können Knochen und Gelenke hinterher dreidimensional dargestellt werden. Die CT stellt die Knochensubstanz, die anatomischen Verhältnisse und gelenknahe Deformierungen sehr eindrücklich dar. Darum ist sie für spezielle knöcherne Veränderungen die beste Diagnostik. Allerdings braucht es für die Abbildung des Knorpels, der Sehnen und Bänder entweder zusätzlich die Vorbehandlung mit Kontrastmittel oder gleich eine MRT.
Keine Schnitte mehr nötig
Rein diagnostische Arthroskopien – also Untersuchungen mit einem dafür entwickelten Endoskop, das ins Gelenk eingeführt wird – braucht es heute nicht mehr. Denn die im CT und MRT ermittelten Aufnahmen sind sehr aussagekräftig, und es ist kein Eingriff nötig. Eine Arthroskopie erfolgt zur Behandlung bestimmter Schäden, zum Beispiel des Meniskus.
Die Bilder sind da, und jetzt?
Wenn Sie die Bildgebung durchlaufen haben, lassen Sie sich von der Ärztin oder einem Assistenten unbedingt erklären, was darauf zu sehen ist. Haken Sie nach, wo es Zusammenhänge mit Ihren Schmerzen geben könnte, was altersgemäß ist, was auffällig. So lernen Sie Ihr Gelenk und dessen Umgebung kennen und zu verstehen.
Bevor Sie nun die Überweisung zum Physiotherapeuten entgegennehmen, können Sie Ihren Arzt fragen, welche Behandlung Sie dort erwartet und was Sie im Alltag tun können, damit es Ihnen besser geht. Die meisten Ärzte informieren Sie gerne, wenn sie erkennen, dass Sie interessiert sind.
Besonderheiten in der Rheumatologie
Wenn Ihr Hausarzt oder Orthopäde Sie zum rheumatologischen Internisten überwiesen hat, durchlaufen Sie auch hier eine intensive Diagnostik. Weil entzündlich-rheumatische Erkrankungen oft mehrere Organe und auch die Haut in Mitleidenschaft ziehen, dauert die Erstuntersuchung in der Rheumatologie recht lang. Für die Anamnese sollte der Rheumatologe sich Zeit nehmen und danach Ihre Gelenke auf ihre Funktion, ihr Aussehen und darauf, wie sie sich anfühlen, hin überprüfen. Sie werden umfassend von Kopf bis Fuß untersucht – ein Blutbild gehört auch dazu. Manchmal sind jedoch alle Entzündungswerte und Rheumafaktoren negativ, und dennoch besteht eine entzündlich-rheumatische Erkrankung. Deshalb werden alle Ergebnisse dieser umfangreichen Untersuchung wie ein Puzzle aus vielen Anhaltspunkten zusammengesetzt. Wird eine entzündlich-rheumatologische Erkrankung diagnostiziert, besteht auch ein erhöhtes Risiko für Arthrose. Sollte Ihre Diagnose also entsprechend ausfallen und haben Sie noch keinen Gelenkverschleiß, können Sie mit den Tipps zur Prävention aus Kapitel 1 dieses Risiko mindern.