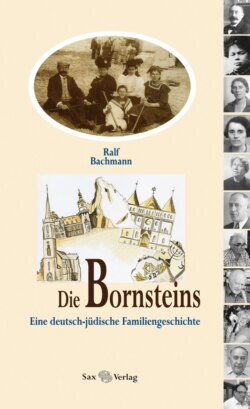Читать книгу Die Bornsteins - Ralf Bachmann - Страница 9
Vier Kinder aus Falkenstein – vier jüdische Schicksale in Deutschland
ОглавлениеDie idyllische Bergstadt ist nie eine jüdische Hochburg geworden. Doch immerhin überschritt deren Zahl in der »Blütezeit«, den Zwanzigerjahren, die 100. Fast alle flohen vor Judenverfolgung und Holocaust im Nazireich. Ihre Nachkommen sind heute u. a. in Israel, in der Schweiz, in den USA, aber auch in München, Hamburg und Berlin zu Hause. Mancher hält zumindest sporadisch Kontakt zu der Stadt, in der seine Vorfahren lebten. Bleiben wir bei den Bornsteins, deren Schicksal typisch für die Mehrzahl jener Juden war, die sich eigentlich vor allem als Deutsche und dann erst als Juden gefühlt und denen die Nazis ihre Herkunft wieder in die aus Palästina stammende Haut gegerbt hatten, um es frei nach Heinrich Heine zu formulieren.
Am 28. Januar 1890 wurde Röschen und Max mit Elsa Regina die älteste Tochter geboren. Sie heiratete den Leipziger Kaufmann Siegfried (Fred) Samuel Urbach, der von SA-Mob überfallen und auf offener Straße zusammengeschlagen wurde. An den Folgen ist er 1935 in Leipzig gestorben. Tante Elsa ist mir als ernst, gebildet und sehr zurückhaltend in Erinnerung. Sie überlebte, zeitweise im Untergrund oder im Exil, und starb 1969 in Frankfurt am Main. Etwas über das Schicksal ihres Sohnes, meines Cousins Karli, kann man in meinem Buch »Ich habe alles doppelt gesehen« (Sax-Verlag, Beucha 2009, S. 259 ff.) anhand eines Artikels von Walter Janka nachlesen. Tante Elsas Enkel und Urenkel wohnen in der Schweiz.
Die nächste Tochter und damit das zweite in Falkenstein geborene jüdische Kind, Jahrgang 1892, nannten Max und Röschen Alma. Sie wanderte 1936 gerade noch rechtzeitig mit ihrem Mann Julius Samter, der in der Nachbarstadt Reichenbach ein Konfektionsgeschäft leitete, und Sohn Herbert, von dem in einem der nächsten Kapitel zu sprechen sein wird, nach Haifa aus. Für die zahlreichen Nachkommen der Familie, die wenigsten von ihnen sprechen Deutsch, ist Israel zur Heimat geworden.
Annonce aus dem Falkensteiner Anzeiger vom 27. Mai 1911
Die jüngste im Bornsteinschen Dreimäderlhaus wurde 1893 meine Mutter Hertha. Das Nesthäkchen heiratete als einzige einen Nichtjuden, was ihr praktisch das Leben rettete. Sie überlebte das KZ Theresienstadt, starb 1978 in Leipzig und hat dort auf dem jüdischen Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ihr ist vor allem das Kapitel »Der weiße Traum und die Kette mit dem Magen David« gewidmet.
Das tragischste Schicksal ereilte in der Zeit der Judenmorde Wilhelm, das Söhnchen, Großvaters ganzen Stolz. Geboren ist er zu Falkenstein im Jahre 1897. Nach Ableistung des Wehrdienstes im Ersten Weltkrieg wurde er Vertreter einer Thüringer Porzellanfirma und zog mit seiner Frau, einer Winzertochter aus dem Rheinland, die wie seine ältere Schwester hieß, nach Leipzig.
Laden in der Hauptstraße um 1910. Am Fenster: Elsa und Hertha
Dort kam 1933 Tochter Ruth zur Welt. Der Lebensweg von Onkel Willy, Tante Alma und Cousine Ruth spielt in meiner Erinnerung und deshalb auch in diesem Buch eine bedeutende Rolle. Von Anfang an traf sie die Naziverfolgung am härtesten.
Willy, der sich in Leipzig in der jüdischen Loge B’nai B’rith (Söhne des Bundes) engagiert hatte, wurde nach der so genannten Reichskristallnacht viereinhalb Monate im KZ Buchenwald eingekerkert und anschließend verpflichtet, Deutschland sofort zu verlassen.
Von seinen Erlebnissen bei der Odyssee der St. Louis, die mit über 900 Juden an Bord bis in den Hafen von Havanna kam, aber nach Europa zurückgeschickt wurde, handelt das Kapitel »Die Odyssee der St. Louis«. Frau und Tochter konnten noch kurz vor Kriegsbeginn nach Belgien fliehen. Dort überlebten sie, während Willy Bornstein in Auschwitz ermordet wurde.
Ähnlich dramatisch war das Schicksal der anderen jüdischen Familien Falkensteins, der Lewins und Verlegers, der Levys und Korytowskis, der Chojnackis und Gumpels. Über manche konnte man in den Dokumenten der Ausstellung Details erfahren, von anderen existieren nur noch ein paar Quittungen, ein Briefumschlag mit dem Stempel »Empfänger im Getto nicht auffindbar«.
Auch einen Schindler hat Falkenstein: Alfred Roßner wurde 2002 in Yad Vashem als »Gerechter unter den Völkern« geehrt. Er hatte im Krieg in Bẹdzin im besetzten Polen als Treuhänder einer Firma, die der Familie Verleger gehörte und später Uniformschneiderei der SS wurde, mehreren 100 jüdischen Arbeitern das Leben gerettet, indem er sie durch »UK«-Stellung (im Kriegsbürokratenjargon für »Unabkömmlich«) vor der Deportation bewahrte. Wie er das machte, wie er dabei die SS-Leute hinters Licht führte, welchen Mut er bewies – all das könnte Stoff für einen Spielberg-Film sein. Die Antwort der SS ließ nicht lange warten. Roßner wurde im Dezember 1943 im Gefängnis von Sosnowitz zu Tode gequält. Ein weiterer Nothelfer war der Falkensteiner Apotheker Dr. Hans Scherner, der im März und April 1945 das Ehepaar Klemperer auf der Flucht vor den Nazis (Victor Klemperer hat darüber in seinem große Literatur gewordenen Tagebuch geschrieben) aufnahm und versteckte.
Die finsterste Zeit der Falkensteiner Juden begann mit einem Aufruf des Nazi-Bürgermeisters Lenk und des NSDAP-Ortsgruppenleiters Hainig vom 26. August 1935 an die Einwohnerschaft mit selbst für damalige Verhältnisse unglaublichen Drohungen: »Kein deutscher Volksgenosse kauft oder verkehrt mehr bei Juden, Judengenossen, reaktionären und marxistischen Geschäftsleuten. Er geht auch nicht mehr zu jüdischen Rechtsanwälten und Ärzten usw. Wer dies nicht beachtet, läuft Gefahr, öffentlich gebrandmarkt und unter Umständen wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zur Rechenschaft gezogen zu werden.« (siehe Anhang S. 140/141)
Mein Großvater hat das nicht mehr erlebt. Er hatte sich lange vorher nach Leipzig zurückgezogen, wo wohlhabende Verwandte wie die Joskes und die Nordheimers wohnten, mit denen er sich gut verstand, und wo er im November 1931 in seiner Wohnung in der Reitzenhainer Straße 43/45 an Krebs erkrankte und verschied. Großmutter Röschen schenkte zwischen 1880 und 1887 sechs Kindern das Leben, außer den genannten noch zweien, denen nur wenige Monate beschieden waren, und starb selbst schon 1913. Die Bücher deuten darauf hin, dass Max Bornstein als Geschäftsmann sagen wir trickreich war. Vielleicht zwang ihn auch die wirtschaftliche Lage dazu, ein wenig zu manipulieren.
Ich weiß alles nur aus den Gesprächen der Eltern, Schriftstücken und Falkensteiner Zeitungsinseraten. Denn als er starb, war ich knapp zwei Jahre alt. Im Adressbuch 1907/08 war aus der Firma schon »Max Bornstein Nachf.« geworden. Aber man inserierte vollmundig als »Größtes und ältestes Spezialhaus für Herren-, Damen- und Kinderkonfektion sowie Schuhwaren«. Die Nachfolger waren engste Verwandte des Großvaters, Schwester Rosa, von deren Existenz ich erst aus den alten Papieren erfuhr, da von ihr zu Hause nie die Rede war, und ihr Ehemann Paul Lewin. 1935, als in Falkenstein Nazis wie die oben zitierten Bürgermeister Lenk und NSDAP-Ortsgruppenleiter Hainig das Sagen hatten, kamen Haus und Geschäft unter den Hammer, damit der Besitz in »arische Hände« übergehen konnte.
Für Hoelz war er ein »anständiger Kerl«
Falkenstein hat nicht so viele berühmte Söhne und Töchter. Einer gehört in die Geschichtsbücher, ein Spross der Familie von Trützschler, der einstigen Herren des Schlosses, in dem die erwähnte Ausstellung stattfand: Wilhelm Adolph von Trützschler hätte sich über sie gefreut. Er wurde 1848 als Vertreter des Vogtlands in die erste Deutsche Nationalversammlung gewählt, die in der Frankfurter Paulskirche tagte. Unerschrocken trat er für die deutsche Einheit und die Abschaffung der Monarchie ein, focht als linker Demokrat für Presse- und Glaubensfreiheit. Am 14. August 1849 töteten ihn die Kugeln eines preußischen Exekutionskommandos in Mannheim. Bis heute bleibt ihm außerhalb Falkensteins die verdiente Anerkennung weitgehend versagt.
Schlagzeilen machte von hier aus ein anderer. Er setzte ganze Reichswehreinheiten in Bewegung und verleitete noch das DDR-Fernsehen zu einem nicht nur historisch misslungenen Spielfilm. Der umstrittene Revolutionär Max Hoelz, einer der Köpfe des örtlichen Arbeiter- und Soldatenrates, Organisator des vogtländischen Widerstandes gegen den Kapp-Putsch, sah sich als Kommunist und nannte seine Arbeiterwehr »Rote Garde«. Er war aber wegen seiner eigenwilligen, individuellen Terror nicht ausschließenden Kampfmethoden zeitweise sogar aus der KPD ausgeschlossen und galt vielen als ein klassischer Anarchist. Andererseits wurde er wegen seines Mutes und seiner Ehrlichkeit von den Arbeitern geliebt und wegen seines Aussehens von Frauen umschwärmt. Die Meinungen über ihn gingen immer auseinander. Die DDR tat sich schwer mit dem ungebändigten Revolutionär, ließ aber doch das Erscheinen einer in den Zwanzigerjahren geschriebenen Autobiografie und einer von einem DDR-Journalisten geschriebenen geglätteten Würdigung seines Lebens zu. Kaum einen wird es wundern, dass der Streit um seinen Platz in der Geschichte nach der Wende neu entflammte und wohl auch heute nicht beendet ist.
Unter den Episoden aus dem Leben von Opa Max, die im Familienkreis die Runde machten und die vor allem meine Mutter als Lieblingstochter nicht müde wurde zu erzählen, nahmen seine Begegnungen mit diesem Mann den ersten Platz ein. Max Hoelz ertrank 1933 in Russland. Angeblich als er die Oka an einer Stelle auf einem primitiven Ruderboot zu überqueren versuchte, wo der russische Strom fast 1000 Meter breit und besonders gefährlich war. Als meine Mutter von seinem rätselhaften, bis heute unaufgeklärten Tod erfuhr, erinnerte sie sich an das Urteil von Opa Max über ihn:
»Natürlich kannte ich Hoelz Max«, sagte mein Großvater zu ihr. »Jeder in Falkenstein hat ihn gekannt. Die einen bekamen was von ihm, die anderen mussten ihm etwas geben, vor allem Geschäftsleute. Ich auch, ein paar Mal. Er nahm nichts für sich, verteilte alles an Arme. Der Hoelz war kein Kommunist wie die heute, eher fühlte er sich als eine Art Stülpner Karl (die sächsische Variante des Robin Hood – R. B.), der die Reichen berauben und die Elenden beschenken wollte. Der Hoelz war ganz gewiss kein gewöhnlicher Ganew (jiddisch für Gangster – R. B.), aber ein recht meschuggener Fisch war er schon.« Nicht sehr fortschrittsgläubig kommentierte Opa die revolutionären Programme der Hoelzianer mit den dank meiner Mutter in der Familie geflügelt gewordenen Worten: »Alles wird sich neu gestalten, nur der Toches bleibt gespalten.«
Vor der großen Brandstiftungsaktion gegen fünf Kapitalistenvillen, die Max Hoelz gewiss zu Recht angelastet wurde, obwohl er sich nicht schuldig bekannte, suchte Hoelz seinen »kapitalistischen Freund Max Bornstein« auf und vertraute ihm an: »Hör zu, Max, hier in Falkenstein wird in den nächsten Tagen etwas passieren, wovon die ganze Welt reden wird. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Dir tun wir nichts. Du bist ein anständiger Kerl.«
Falkensteiner Adressbuch 1907
Dabei war mein Opa ein absolut unpolitischer Mensch. Er blieb, was er war, ein deutscher Jude, sehr deutsch und sehr jüdisch, bis zu seinem Tode, der rechtzeitig kam, um ihm die ganze nazistische Schreckenszeit zu ersparen.