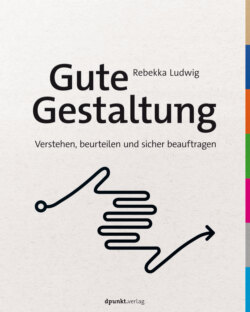Читать книгу Gute Gestaltung verstehen, beurteilen und sicher beauftragen - Rebekka Ludwig - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеExkurs: Gestaltgesetze der Wahrnehmung
Es ist nicht alles so, wie es scheint. Und dabei spielen die Gesetze unserer Wahrnehmung eine Rolle. Unser Gehirn macht sich seinen eigenen Reim auf das, was unsere Augen sehen. Es kann dabei durchaus einmal passieren, dass plötzlich Flächen anders wahrgenommen werden, als sie eigentlich »objektiv« betrachtet abgebildet sind, dass wir Linien automatisch fortführen oder auch ganze Elemente ergänzen. Darum sollte man bei der Gestaltung auch immer die Gestaltgesetze der Wahrnehmung im Hinterkopf behalten, um ihre Wirkung auf das Gegenüber besser steuern zu können.
Denn unsere Wahrnehmung wird stets beeinflusst. Man könnte fast sagen, dass so, wie wir von Werbung beeinflusst werden, auch unser Gehirn das, was wir sehen, beeinflusst. Vom Auge kommen nur Impulse, die unser Gehirn weiterverarbeitet. Unser Gehirn versucht dann, das Gesehene zu interpretieren, basierend auf unseren Seherfahrungen und unserem Wissen.
Aus diesen Erkenntnissen entstand Anfang des 20. Jahrhunderts die Forschungsrichtung der Gestaltpsychologie. Sie formulierte die Gestaltgesetze der Wahrnehmung und erklärt uns so, warum wir sehen, wie wir sehen. Gutes Design folgt diesen Gestaltgesetzen, damit das Gezeigte optimal – im Sinne der beabsichtigten Wirkung – wahrgenommen werden kann.
Die vier Prinzipien der Gestaltung, S. 8f
Das Gesetz der Nähe besagt, dass wir Elemente, die räumlich nahe beieinander liegen, als zusammengehörig interpretieren. Wenn Sie in dem Beispiel oben die Kreise betrachten, dann werden Sie nebeneinander liegende Spalten erkennen, nicht aber Reihen von Punkten, da die Abstände zwischen den Punkten übereinander geringer sind als die Abstände der nebeneinander liegenden Punkte. Wenn etwas in der Gestaltung also inhaltlich zusammengehört, sollte man diese Elemente auch nah beieinander platzieren.
Das Gesetz der Einfachheit oder auch Prägnanz sagt aus, dass wir in einer Gestalt immer die einfachste Form wahrnehmen. Im Beispiel oben links sind zwei Quadrate abgebildet, wovon eines um 45 Grad gedreht ist und über dem anderen liegt. Vielleicht denken Sie dabei auch an einen Stern. Aber sicherlich nicht an mehrere Dreiecke, so wie im rechten Bild hervorgehoben.
Das Gesetz der durchgehenden Linie oder guten Fortsetzung besagt, dass Linien immer so wahrgenommen werden, als folgten sie dem einfachsten Weg. Im Beispiel oben hieße dies, dass man der geschwungenen Linie aus dem linken Bild folgt, wie in der Mitte gelb hervorgehoben. Knicke erschweren nun die Wahrnehmung. Wäre das Bild rechts ein Diagramm, würden auf der gleichen, aber nun farblich unterbrochenen Linie angeordnete Elemente nicht sofort als zusammengehörig wahrgenommen.
Dem Gesetz der Kontinuität zufolge ergänzt unsere Wahrnehmung Formen und Linien und setzt sie dabei auch fort, um ein einfacheres Gesamtbild wahrnehmen zu können. Daher muss man zum Teil Formen nicht immer komplett verbinden oder durchgehende Linien ziehen, damit der Betrachter eine Form wahrnimmt, wie Sie im Beispiel oben gut erkennen können.
Das Gesetz der Geschlossenheit besagt, dass wir eine Gruppe von Elementen bevorzugt als geschlossene und nicht als offene Struktur wahrnehmen. Dabei tendiert unsere Wahrnehmung sehr stark zum Erkennen von Objekten, die vielleicht im ersten Moment so nicht gleich sichtbar waren, wie das Quadrat oben links oder das »F« im Bild oben rechts. Dieses Gesetzes bedient man sich sehr häufig bei der Logoentwicklung.
Das Gesetz der Parallelität sagt aus, dass wir parallel zueinander verlaufende Elemente als eine Einheit sehen, sodass etwa aus zwei Linien gleich eine zusammengehörende Form entsteht. Setzt man als Gestaltungselement Linien ein, so sollte man diese Wirkung berücksichtigen.
Laut dem Gesetz der Änhlichkeit (Gleichheit) werden ähnliche oder gleiche Objekte vom Gehirn gruppiert. Das kann sowohl durch die Form oder Größe, aber auch durch Farbe, Helligkeit und Struktur erreicht werden.
Das Gesetz der Symmetrie besagt, dass Elemente in symmetrischer Anordnung besser wahrgenommen werden. Das kann die Lesbarkeit unterstützen und wird daher oft für Formulare, Tabellen etc. genutzt.
Das Gesetz der Erfahrung besagt, dass wir undefinierte Elemente auf Grundlage unserer Erfahrung als eine bekannte Gestalt wahrnehmen – wie im Bild links, in dem wir aus verschiedenen miteinander verbundenen Linien einen Würfel erkennen. Das Gesetz besagt aber auch, dass wir derart gelernte Elemente deuten können und so genau »wissen«, dass ein Dreieck in einem Kreis, das nach rechts zeigt, das Symbol für das »Abspielen« von Musik ist. Dieses Gesetz beschreibt auch unsere Tendenz, etwas dreidimensional zu interpretieren. Damit kann man mit dunklen Bereichen, die wie ein Schatten wirken, Elemente auf der Fläche erhaben oder vertieft wirken lassen, wie im Beispiel rechts oben mit dem Buchstaben »H« demonstriert.
Das Gesetz der Figur-Grund-Trennung besagt, dass der Mensch grundsätzlich immer zwischen wichtigen Informationen im Vordergrund und unwichtigen im Hintergrund unterscheidet. Dabei wird eine geschlossene Form eher als Vordergrund wahrgenommen, und eine offene Form, die von Objekten überlagert wird, als Hintergrund. Schauen Sie sich auch noch einmal das Cover dieses Buches an: Auch hier wird mit dem Gesetz der Figur-Grund-Trennung gespielt.
Abb. 1–19 Das Visual des Covers dieses Fachbuches bedient sich ebenso des Gesetzes der Figur-Grund-Trennung.
Zusätzlich wird unsere Wahrnehmung davon beeinflusst, wie wir in der westlichen Welt lesen: Dass z. B. eine Überschrift oben und nicht unten auf dem Flyer steht, dass alles, was oben steht, als erstes wahrgenommen wird – eben weil unsere Blickführung von oben nach unten und von links nach rechts geht. Mit diesen Erfahrungswerten und Gewohnheiten ist z. B. auch ein Wort aus Buchstaben, die übereinander stehen, nur schwer lesbar, so wie es oft auf Schildern z. B. an der Außenwand von Hotels oder Restaurants zu sehen ist. Diese Darstellung für einen Flyer oder einen Text zu verwenden wäre nicht praktikabel. Auch ist es nicht immer sinnvoll, nur Großbuchstaben im Text zu verwenden, weil wir diese viel schlechter lesen können.
Eine Website etwa sollte ihre Navigation immer im oberen Bereich haben, da die Nutzer dies so erlernt haben und sie dort auch suchen. Wenn sie sie dort nicht finden, werden sie die Seite schnell verlassen.
Vor allem im Bereich der User Interface-Gestaltung greift man auf diese Gesetze zurück. Als 2007 das iPhone und 2010 das iPad eingeführt und damit auch Apps zum direkten Bedienen am Bildschirm entwickelt wurden, musste erneut umgedacht werden.
Bei all diesen Gestaltgesetzen darf man auch die optischen Täuschungen nicht vergessen, derer man sich ebenfalls bedienen kann.
Im Bild oben vermutet man, dass der Kreis in der Mitte links, der von größeren Kreisen umgeben ist, kleiner ist, als der in der Mitte der Kreise rechts. Fakt ist, dass beide die gleiche Größe haben.
Abb. 1–20 Abbildung aus dem Buch »Experimentelle Typografie« von Teal Triggs: Alle Linien sind waagrecht, wirken aber gebogen, dadurch, dass sie im Muster immer leicht versetzt sind.
Genauso ist es auch bei diesen Linien mit den unterschiedlichen Pfeilrichtungen. Bei einer Gestaltung kann man demnach nicht immer nach korrekten Millimeterangaben gehen, sondern muss teilweise optisch ausgleichen.
Es gibt zahlreiche optische Täuschungen, daher sollte man gerade bei Mustern aufpassen, dass man hier keine ungewollte Unruhe erzeugt.
Gestaltung steht immer im Dienst einer Aussage oder Botschaft. Eine Gestaltung, die den Gestaltgesetzen folgt, überlässt nicht dem Zufall, wie sie beim Betrachter wirkt und welche Botschaft bei ihm ankommt.
Unterstützen können in der Gestaltung auch Gesetze, die Proportionen beschreiben. Sie können das Format des Flyers oder der Visitenkarte betreffen, aber auch die einzelnen Layoutelemente können zueinander in einer bestimmten Proportion gesetzt werden. Dabei bedient sich auch der Satzspiegel bestimmter Regeln. Das wohl bekannteste Proportionsverhältnis nennt sich Goldener Schnitt. Dabei wird ein Format in einem bestimmten, als harmonisch empfundenen Seitenverhältnis angelegt. Doch gerade was Formate für Flyer, Visitenkarten, Broschüren u. ä. angeht, muss man beachten, dass es viele Standardformate gibt, wie die DIN-Formate, und dass gerade die Druckbranche sich nach diesen richtet. Weichen Sie davon etwa bei einer Gestaltung nach dem Goldenen Schnitt ab, kann das zwar den Vorteil haben, sich abzusetzen und deshalb eher wahrgenommen zu werden, aber auch den Nachteil, dass es kostenaufwendiger produziert werden muss und z. B. nicht in Ihren Aufsteller für Werbemittel passt (der für DIN-Maße gebaut ist). Wo der Goldene Schnitt meines Erachtens am meisten zum Tragen kommt, ist in der Gestaltung selbst: Beim Anordnen der Layoutelemente, beim Gestalten eines Logos oder beim Komponieren eines Fotos. Hier werden die Elemente, die ins Auge stechen sollen, am Goldenen Schnitt ausgerichtet.
Als Satzspiegel wird der Bereich bezeichnet, in dem alle Elemente liegen, wie Text, Formen und Bilder, und der für die Gestaltung so eine Art Rahmen bildet. Er wird v. a. in Publikationen, Büchern und Magazinen verwendet – aber auch ein einseitiger Flyer, eine Visitenkarte oder eine Website kann mit einem Satzspiegel angelegt werden.
Der Goldene Schnitt beschreibt eine Aufteilung von Proportionen, bekannt aus Architektur und Kunst. Eine Proportion im Goldenen Schnitt wird vom Menschen als harmonisch und ästhetisch wahrgenommen.
DIN-Formate haben ein Seitenverhältnis von 1:1,414. Immer wenn man sie halbiert, erhält man die nächstkleinere DIN-Größe. Aus DIN A0 wird so DIN A1 und daraus halbiert DIN A2 usw. Die DIN-Norm 476 gibt es seit 1922 und in 3 Reihen: A, B und C. DIN lang entspricht 110 x 220 mm.
Auch wenn wir eine Symmetrie in der Anordnung von Objekten als harmonisch empfinden, so ist gerade die Anordnung nach dem Goldenen Schnitt nicht symmetrisch, wirkt aber dennoch harmonisch auf den Betrachter. Es kommt immer darauf an, welche Harmonie wir erzeugen möchten. Symmetrie schafft eine gewisse Ruhe und kann daher auch oft als langweilig empfunden werden, zum Beispiel beim Layouten eines mehrspaltigen Textes. Hat eine Seite eine gerade Anzahl an Spalten, also zwei oder vier Spalten, wirkt dies oft langweilig – wählt man eine ungerade Anzahl, wie drei oder fünf Spalten, wirkt dies spannender.
Die Formate nach dem Goldenen Schnitt, S. 61
Zu Symmetrie und Asymmetrie gibt es folgenden schönen Test, von dem Sie sicherlich schon einmal gehört haben: Man teilt das Gesicht eines Menschen vertikal in der Mitte und spiegelt die eine Gesichtshälfte, wodurch man eine totale Symmetrie herstellt. Aber ist das schön? Zum einen zeigt dies, dass Asymmetrie Spannung erzeugt und auch als schön empfunden wird. Zum anderen sehen wir, dass wir absolute Symmetrie in dieser Form nicht gewohnt sind und sie als seltsam und nicht passend empfinden. Natürlich lässt sich dieser Effekt in der Werbung gezielt einsetzen, um Betrachter zu fesseln und zum Nachdenken anzuregen. Nur weil etwas unserem Gewohnheits- und Wahrnehmungsmuster entspricht, heißt das nicht, dass wir den Blick des Betrachters nicht auch mal auf andere Weise führen können.