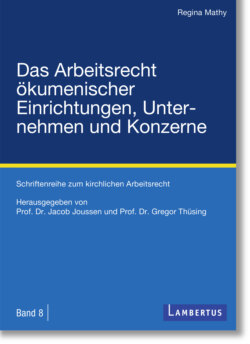Читать книгу Das Arbeitsrecht ökumenischer Einrichtungen, Unternehmen und Konzerne - Regina Mathy - Страница 12
D. Gang der Darstellung
ОглавлениеDie Arbeit gliedert sich inhaltlich in drei Teile: Der erste Teil widmet sich in § 2 dem Begriff der Ökumene und der Geschichte der Ökumenischen Bewegung. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen einer interkonfessionellen Zusammenarbeit – von Kooperation bis hin zu Fusion bzw. Neugründung – aufgezeigt. Hierauf folgt § 3, in dem es um die Grundlagen des kirchlichen Arbeitsrechts im Vergleich zum staatlichen Arbeitsrecht geht. Die Regelungsbefugnis der Kirchen zum Erlass eigener arbeitsrechtlicher Ordnungen beruht auf dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht gemäß Art. 4 Abs. 1, 2 GG, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV, das Teil des Religionsverfassungsrechts ist. Zunächst erfolgt eine Darstellung des Religionsverfassungsrechts im Allgemeinen und des Selbstbestimmungsrechts im Speziellen. Hierauf folgen die Voraussetzungen der Zuordnung ökumenischer Einrichtungen zu einer bzw. mehreren Kirche(n). § 4 setzt sich mit der kirchenrechtlichen Anerkennung ökumenischer Einrichtungen auseinander. Dabei geht es neben den kirchenrechtlichen Grundlagen um die Vereinbarkeit der Anwendung vorhandener Ordnungen des kirchlichen Arbeitsrechts in ökumenischen Einrichtungen mit geltendem Kirchenrecht.
Der zweite Teil der Dissertation widmet sich in § 5 dem Vergleich des kirchlichen Arbeitsrechts der katholischen Kirche mit dem der evangelischen Kirchen. Vergleichsgrundlage sind die (Rahmen-)Ordnungen der Deutschen Bischofskonferenz bzw. der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen die Loyalitätsanforderungen sowie das Mitarbeitervertretungsrecht. Kurz dargestellt werden ebenso wesentliche Unterschiede der Arbeitsrechtsregelung auf dem sog. Dritten Weg sowie des (kircheneigenen) Rechtsschutzes.
Nach der Darstellung der rechtlichen und theologischen Grundlagen einer Gestaltung des Arbeitsrechts in ökumenischen Einrichtungen beschäftigt sich der dritte Teil der Arbeit mit den Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsrechts in ökumenischen Einrichtungen (§ 6). An dieser Stelle werden Modelle einer Arbeitsrechtsgestaltung – insbesondere mit Blick auf die in § 5 gewonnenen Erkenntnisse – näher untersucht. Dabei geht es auch um spezifische Fragen, wie einen Betriebsübergang von bzw. auf einen ökumenischen Rechtsträger und die Konzeption ökumenischer Unternehmen und Konzerne. Ein Regelungswerk für den „ökumenischen Dienst“ existiert bis dato nicht. Im Rahmen eines Ausblicks sollen Richtlinien für eine solche gemeinsame Ordnung aufgezeigt werden (§ 7). Abschließend werden die in der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse thesenartig zusammengefasst (§ 8).
____________
1Hierold, in: Hdb kath KR, S. 1458; s. auch Isensee, in: Hdb StKR, Bd. II S. 665 (665) m.w.N.
2Frank, RdA 1979, 86 (88 f.); Kaminsky, in: Abschied von der konfessionellen Identität?, S. 18 (19); Richardi, ZevKR 23 (1978), 367 (373 ff.).
3Wird im Rahmen der Arbeit auf Einrichtungen der „Caritas“ Bezug genommen, sind hiervon Einrichtungsträger umfasst, die Mitglied im Deutschen Caritasverband bzw. den Diözesancaritasverbänden sind.
4Wird im Rahmen der Arbeit auf Einrichtungen der „Diakonie“ Bezug genommen, sind hiervon Einrichtungsträger umfasst, die Mitglied im Diakonischen Werk – Evangelischer Bundesverband bzw. den Diakonischen Werken der Landeskirchen sind.
5Demel, Hdb Kirchenrecht, S. 113; Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 51; Die Diakonie beschäftigte hauptamtlich 525.700 Menschen (Stand September 2018), s. im Einzelnnen Diakonie Deutschland (Hrsg.), Jahresbericht 2018, S. 7; für rd. 24.800 Einrichtungen der Caritas sind rd. 660.000 hauptberufliche Mitarbeiter tätig. Darüber hinaus engagieren sich mehrere hunderttausend Menschen ehrenamtlich im Bereich der Caritas, Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 37.
6Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.
7Diakonie und Caritas beschäftigen somit gemeinsam etwa 1,185 Mio. hauptamtliche Mitarbeiter.
8Die Caritas betreibt in Deutschland rd. 24.780 Einrichtungen, die Diakonie Deutschland hat rd. 31.500 Angebote. Sowohl bei Caritas als auch Diakonie stellen Tageseinrichtungen (bzw. teilstationäre Einrichtungen) den größten Anteil dar (bei der Caritas etwa nahezu die Hälfte, bei der Diakonie etwa ein Drittel aller Einrichtungen), etwa ein Fünftel entfällt auf stationäre Einrichtungen. Die meisten Einrichtungen stellen die der Kinder- und Jugendhilfe dar (bei der Caritas sind in rd. 11.600 Einrichtungen rd. 151.000 Mitarbeiter tätig; bei der Diakonie für über 12.300 Angebote 128.600 Mitarbeiter). Auch der Bereich der Altenhilfe stellt ein wichtiges Betätigungsfeld dar: bei der Caritas sind hier in rd. 2.900 Einrichtungen rd. 119.400 Mitarbeiter tätig; bei der Diakonie sind in fast 5.800 Einrichtungen rd. 153.000 Mitarbeiter beschäftigt). Im Bereich der Krankenhilfe sind bei der Caritas in rd. 2.550 Einrichtungen rd. 273.000 Mitarbeiter, bei der Diakonie in 3.800 Einrichtungen rd. 110.000 Mitarbeiter tätig; Zahlen jeweils bezogen auf hauptamtliche Mitarbeiter; s. für die Caritas (Stand Juli 2019) Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 39; s. für die Diakonie (Stand Januar 2016) Diakonie Deutschland (Hrsg.), Einrichtungsstatistik, S. 79.
9Der Jahresumsatz beider Wohlfahrtsorganisationen betrug zusammen ca. 62 Mrd. Euro, s. Vortrag Bangert/Sasserath-Alberti, Wie stellen wir uns auf?, Vortrag anlässlich der ConSozial 2017.
10Marktanteil freigemeinnütziger Krankenhäuser von 33,5%, wobei sich der größte Anteil in kirchlicher Trägerschaft befindet, vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Grunddaten der Krankenhäuser 2017, S. 8. Zahlen spezifisch für die kirchlichen Träger liegen derzeit nicht vor.
11Marktanteil freigemeinnütziger Träger von 33%, wobei sich der größte Anteil in kirchlicher Trägerschaft befindet, vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Pflegestatistik 2017, S. 10.
12Marktanteil freigemeinnütziger Träger von 53%, wobei sich der größte Anteil in kirchlicher Trägerschaft befindet, vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Pflegestatistik 2017, S. 10.
13Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen bilden bei der Caritas mit 46,7% den größten Anteil der Einrichtungen (Stand Juli 2019), s. Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 39; Unter den freien Trägern im Bereich der Kindertagesstätten haben Träger des DCV bzw. sonstige katholische Träger einen Anteil von 14,8% und Träger des DW bzw. sonstige der EKD angeschlossene Träger einen Anteil von 36,3%, s. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2016, S. 12. Bei diesen Trägern sind zusammen 41,5% der bei freien Trägern tätigen Mitarbeiter beschäftigt, s. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2016, S. 24.
14Ca. 13 Mio. Menschen werden in Deutschland jährlich in Einrichtungen der Caritas betreut, gepflegt und beraten (Stand Juli 2019), s. Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 37; ca. 10 Mio. Menschen erhalten von der Diakonie Betreuung, Beratung, Pflege und medizinische Versorgung, s. Diakonie Deutschland (Hrsg.), Jahresbericht 2018, S. 7.
15Tück, in: Konfessionelle Identität und Kirchengemeinschaft, S. 11.
16Ebd., S. 11.
17Vat. II UR 1.
18Vat. II UR 5.
19Kasper, Ökumene des Lebens, Vortrag auf dem Katholikentag 2004 in Ulm.
20Vgl. Hatzinger/Schnaben, in: Hdb ev KR, § 15 Rn. 46; vgl. Kasper, in: Grundkonsens - Grunddifferenz, S. 98; Kirchenamt der EKD (Hrsg.), Texte 124, S. 13; Sekretariat der DBK (Hrsg.), Caritas als Lebensvollzug der Kirche, S. 26.
21Vgl. Vat. II UR 12; vgl. auch Isensee, in: Hdb StKR, Bd. II S. 665 (668); Jung/Armbruster, in: Fusion und Kooperation in Kirche und Diakonie, S. 9 (22).
22Wird von katholischer und evangelischer Kirche gesprochen, handelt es sich um eine Verkürzung. Sofern nicht ausdrücklich gekennzeichnet, sind hiermit sowohl die verfassten Kirchen als auch ihre Wohlfahrtsorganisationen gemeint.
23Vgl. auch Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen (Hrsg.), Nachkonziliare Dokumentation Bd. 56, S. 99; Thüsing, in: FS Listl 2004, S. 811 (812); ders., Kirchliches Arbeitsrecht, S. 79.
24Rd. 21,14 Mio. Menschen sind Angehörige der Evangelischen Kirche in Deutschland; 23 Mio. Menschen sind Angehörige der röm.-kath. Kirche, s. EKD (Hrsg.), Gezählt 2019, S. 4 (Stand Dezember 2018).
25Im Jahr 2018 rd. 216.000 Austritte aus der katholischen Kirche, s. Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 72; rd. 197.200 Austritte aus der evangelischen Kirche im Jahr 2018, s. EKD (Hrsg.), Gezählt 2019, S. 12.
26Die Anzahl der Taufen in der katholischen Kirche ging von 2003 mit fast 206.000 Taufen auf rd. 167.800 2018 zurück. Noch drastischer ist die rückläufige Zahl der Erstkommunionen von rd. 282.000 in 2003 auf rd. 171.300 im Jahr 2018, s. Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 70. In der evangelischen Kirche ging die Zahl der Taufen von 2004 mit rd. 227.000 auf rd. 176.200 in 2018 zurück. Ebenfalls drastisch sank die Zahl der Konfirmationen von 273.000 in 2004 (2003 269.000) auf 174.100 in 2018, s. EKD (Hrsg.), Gezählt 2019, S. 12.
27Kirchenamt der EKD (Hrsg.), Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert, S. 21 f.
28Günther, Diaspora Deutschland, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 28.12.2014; Isensee, in: FS Listl 1999, S. 67 (80 f.).
292003 gab es noch fast 13.000 katholische Pfarrgemeinden, 2018 waren es nur noch 10.045, s. Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 58; im Bereich der EKD gibt es 13.792 Kirchengemeinden (Stand 2018), s. EKD (Hrsg.), Gezählt 2019, S. 8.
30Im Jahr 2000 empfingen 154 Männer die Priesterweihe, 2018 lediglich 60. Die Zahl der Priester in der katholischen Kirche hat sich 2003 mit 16.532 Priestern auf 13.285 im Jahr 2018 verringert, s. Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 306, S. 76; ähnlich im Bereich der EKD, derzeit stehen rd. 21.000 Theologen im Dienst der Kirche (Stand 2018), s. EKD (Hrsg.), Gezählt 2019, S. 22.
31Konrad, Der Rang und die grundlegende Bedeutung des Kirchenrechts, S. 456.
32Eingehend Fischer, Das konfessionelle Krankenhaus, S. 55 ff.; Köstler, Die religionsverfassungsrechtliche Zuordnung, S. 20 f.
33Vgl. hierzu Fischer, Das konfessionelle Krankenhaus, S. 26 ff.; Konrad, Der Rang und die grundlegende Bedeutung des Kirchenrechts, S. 456; Paeger, in: Konfessionelle Krankenhäuer, S. 167 (167).
34Isensee, in: Hdb StKR, Bd. II 665 (672 f.).
35Fischer, Das konfessionelle Krankenhaus, S. 30.
36Ebd., S. 77 ff.
37Ebd., S. 31.
38Köstler, Die religionsverfassungsrechtliche Zuordnung, S. 23.
39Sekretariat der DBK (Hrsg.), Arbeitshilfen Nr. 209, S. 12 f.
40Fischer, Das konfessionelle Krankenhaus, S. 31.
41Falterbaum, Caritas und Diakonie, S. 104; Fischer, Das konfessionelle Krankenhaus, S. 31.
42Eurich/Hädrich, in: Fusion und Kooperation in Kirche und Diakonie, S. 27 (30).
43Vgl. Negwer, in: Rechtsformen kirchlich-caritativer Einrichtungen, S. 156; a.A. Glawatz, Die Zuordnung privatrechtlich organisierter Diakonie, S. 128.
44So auch Fischer, Das konfessionelle Krankenhaus, S. 31; s. auch Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 78.
45Bietmann, Betriebliche Mitbestimmung im kirchlichen Dienst, S. 20 f.