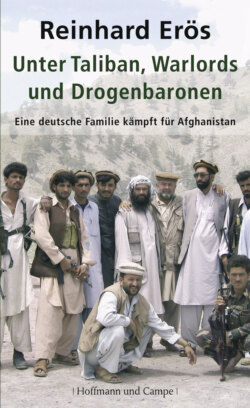Читать книгу Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen - Reinhard Erös - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Sterben in den Bergen
ОглавлениеEs ist heutzutage ein Leichtes, in den Gästehäusern der Millionenstadt Peschawar auch ohne Reservierung Zimmer zu finden. Noch vor wenigen Jahren war das ganz anders. In Peschawar – auf Persisch die »Stadt an der Grenze« und in Sanskrit die »Stadt der Blumen« – wimmelte es während des sowjetischen Afghanistan-Krieges regelrecht von Ausländern: Mitarbeiter der zahllosen Hilfsorganisationen und UN-Behörden, Schwärme von Journalisten aus aller Welt, unauffällige Geheimdienstler und überauffällige war groupies – Kriegstouristen – beherrschten damals das Leben auf den Basaren und in den Hotels dieser immer noch mittelalterlich anmutenden Stadt. In den Wochen nach dem 11. September 2001 ließ man sich auch von den horrenden Preisen im Pearl Interconti, dem einzigen westlich geprägten Fünf-Sterne-Hotel, nicht abschrecken: Selbst für ein Notbett in der Abstellkammer zahlten Journalisten locker und gern 250 US-Dollar pro Nacht ohne Frühstück.
Tempi passati. Jetzt sieht man in der »Hauptstadt von Paschtunistan« kaum noch Ausländer. Die Karawane der Hilfsorganisationen und ihre journalistischen Marketender sind längst weitergezogen. »See you at the next desaster«, lautet sinnigerweise der Abschiedsgruß in dieser Welt der »humanitären Helfer«.
Alem, der natürlich zunächst bei seiner Familie nach dem Rechten sieht, kommt noch in der Nacht zurück in unser Gästehaus, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Bis Mitternacht sitzen wir drei – Annette, Alem und ich – zusammen und beraten, ob und wie wir im Erdbebengebiet helfen können. Der Eigentümer unseres Gästehauses stammt aus der Region um Balakot, einer Stadt, die von dem Beben besonders schwer betroffen ist. Sie liegt etwa 250 Kilometer nordöstlich von Peschawar, nahe der Grenze zu Kaschmir. Von dem Mann erfahren wir, dass in der Nähe seiner Heimatstadt viele afghanische Flüchtlinge leben. Wie er uns berichtet, gibt es dort schon seit zwanzig Jahren ärmliche Flüchtlingslager, wo Paschtunen untergebracht sind. Sie stammen aus den afghanischen Provinzen, in denen wir in den vergangenen Jahren Schulen gebaut haben. Diese Information erleichtert uns die Entscheidung: Wir beschließen, in Pakistan zu bleiben und diesen Flüchtlingen zu helfen. Noch in der Nacht starten die Planungen zu der Aktion »Kinderhilfe Erdbeben«.
Die Medien liefern in den nächsten Tagen erste Zahlen und Angaben über die Opfer. Von mehreren Zehntausend Toten ist die Rede, Millionen seien betroffen und hätten Hab und Gut verloren. Das Fernsehen zeigt erste Luftbilder von zerstörten Städten und Dörfern. Die Zeitungen berichten von Flüchtlingstrecks, die sich aus den Bergregionen nach Süden bewegen. Die Regierung warnt vor Nachbeben.
Auch bei akuten Katastrophen ist es notwendig, vor Beginn von Hilfsaktionen möglichst umfassende Informationen einzuholen, denn »vorschnelle« Hilfe ist nicht immer zweckdienlich. Um wirkungsvoll und nachhaltig helfen zu können, brauchen wir mehr und genauere Erkenntnisse. Mit einem geländegängigen Kleinlaster wollen wir möglichst bald zu einer ersten Erkundung nach Balakot aufbrechen. Um dort nicht mit völlig leeren Händen anzukommen, beschaffen wir uns auf den Basaren zunächst diejenigen Hilfsgüter, welche in der Dritten Welt grundsätzlich benötigt werden: Milchpulver, Proteinkekse und Zucker. Um unmittelbare Notfallhilfe leisten zu können, kaufen wir in einer Großapotheke Medikamente und Verbandsmaterial. Auf dem Sadar-Basar, der mittelalterlichen Händlerstraße im Zentrum der Stadt, erstehen wir Taschenlampen, batteriebetriebene Weltempfänger, regendichte Jacken und Planen sowie Wasserentkeimungstabletten. Wasser, das lebenswichtige Hilfsgut, gibt es in der gebirgigen Gegend hoffentlich ausreichend.
Annette und Alems ältester Sohn Mustafa verbleiben als Ansprechpartner in Peschawar, unserem vorläufigen »Gefechtsstand«. Alem und ich machen uns mit einem voll beladenen Pick-up auf den unsicheren Weg Richtung Karakorum Highway. In dieser Ecke Pakistans kennen wir uns beide nicht besonders gut aus. Als würde der Himmel mit den Menschen trauern, regnet es auf der zwölfstündigen Fahrt ohne Unterbrechung. Nach Norden werden die Straßen immer enger, der geteerte Belag zeigt erste, tiefe Risse. Spätestens jetzt wissen wir, dass wir uns dem Erdbebengebiet nähern. Immer wieder überholen uns schwer beladene pakistanische Militärlaster. Die Sicht – durch den Regen ohnehin schon behindert – wird noch schlechter, als die Dämmerung hereinbricht. Alem muss am Steuer höllisch aufpassen, um den Rissen im Asphalt auszuweichen. Ein zerfetzter Reifen oder gar ein Achsenbruch – nachts bei strömendem Regen, fernab der nächsten Werkstatt, in einer wildfremden Gegend – wäre ein Albtraum.
Die Distrikthauptstadt Balakot liegt in einem weiten Tal unter uns. Obwohl die Sicht von der kahlen Anhöhe einige Kilometer vor dem Ortseingang völlig frei ist, können wir die Stadt in der einsetzenden Dunkelheit nur schemenhaft erahnen. Es sind auch nirgends Straßenlaternen oder Lichter in den Häusern zu erkennen.
Wir fahren hinunter. Unser ursprünglicher Plan, die erste Nacht in einem Gästehaus zu verbringen, erweist sich als makabrer Witz: Geborstene Betonwände, wo vor wenigen Tagen noch der Basar stand, zerbröckelnde Ruinen und halbierte Hausdächer, halb umgekippte Strommasten, großflächige Blechteile und ineinander verkeilte Autowracks versperren uns wenig später die Weiterfahrt. Gespenstische Ruhe umgibt uns. Gibt es hier überhaupt noch Überlebende? Bevor uns die Dunkelheit völlig einhüllt, steuert Alem den Lastwagen rückwärts in eine Nebengasse. Aus den Ritzen einer verbeulten Blechhütte schimmert Licht. Bei strömendem Regen schließen wir unseren Wagen ab und klopfen an die Tür der Hütte. Drinnen verstummt das unverständliche Stimmengewirr, und die Tür öffnet sich. Der starke Strahl einer Taschenlampe blendet mich und wandert dann rasch zu Alem. Hinter dem Licht ertönt eine tiefe Stimme: »Salam, Alem Jana, good evening, doctor sahib.« Ich traue meinen Ohren nicht. Die Stimme ist mir altvertraut. Seit mehr als fünfzehn Jahren habe ich diesen dröhnenden Bass nicht mehr gehört und kann ihn doch schnell zuordnen: Ghul Aga, ehemaliger Polizeichef von Peschawar und guter Freund aus den achtziger Jahren. Wir fallen uns in die Arme, und der chief cop, wie ich ihn damals genannt habe, zieht uns mit seinen kräftigen Polizistenhänden rasch ins Trockene. Obwohl Alem und ich nach der langen Fahrt todmüde sind, kommen wir erst am frühen Morgen zum Schlafen. Die Kartusche des Gaskochers mit dem Teewasser muss zweimal gewechselt werden, so viel haben wir uns zu erzählen.
Transport unserer Hilfsgüter ins Erdbebengebiet
Ghul Aga, zuletzt Polizeidirektor der nordwestlichen Grenzprovinz, ist vor vier Jahren pensioniert worden und danach in seine Heimatstadt Balakot zurückgekehrt. Das Erdbeben hat ihn hart getroffen. Am Tag zuvor hat er noch mit seiner Familie in Islamabad ausgelassen die Hochzeit seiner jüngsten Tochter gefeiert. In der darauffolgenden Nacht wurde sein gesamtes Hab und Gut vernichtet. Sein Haus wurde dem Erdboden gleichgemacht, Freunde und Nachbarn kamen ums Leben. Mit stockender Stimme, die Tränen nur mühsam unterdrückend, schildert uns dieser einst so mächtige, unverwundbar wirkende Mann die Lage:
Balakot existiert nicht mehr. Eine Stadt mit 80000 Einwohnern ist in wenigen Minuten von der Landkarte verschwunden. Allah hat es gefügt, dass meine Familie und ich überlebt haben. Dafür stehe ich jetzt in der Pflicht. Obwohl ich schon pensioniert bin, habe ich der Regierung sofort meine Hilfe angeboten. Den Zerstörungen sind auch alle öffentlichen Gebäude zum Opfer gefallen, unsere Polizisten und Beamten sind tot oder verletzt. Der Innenminister hat mich zum Chef einer provisorischen Zivilverwaltung ernannt. Gemeinsam mit unserer Armee kümmere ich mich um die Toten und die Überlebenden. In den vergangenen Tagen haben wir die meisten Leichen geborgen und die Schwerverletzten in die weiter südlich gelegenen Krankenhäuser transportiert. Morgen zeige ich euch, was von Balakot übrig geblieben ist. Habt Dank, dass ihr gekommen seid und uns helfen wollt.
Die völlig zerstörte Stadt Balakot: Rund sechstausend Menschen liegen unter den Trümmern begraben
Der Regen vor der Hütte hat nachgelassen. Obwohl Ghul Aga mir sein Feldbett anbietet, verlassen wir unseren Freund und seine Mitarbeiter in der engen Behausung und kehren in das Führerhaus unseres Lastwagens zurück. Noch sind die Nächte auch hier in 1200 Meter Höhe erträglich warm.
Das Knattern von Hubschrauberrotoren weckt uns in aller Frühe, kaum dass wir eingeschlafen sind. Die goldene Sonne erhebt sich wie zum Hohn über dieser Trümmerlandschaft. Ghul Aga führt uns stundenlang durch die Ruinen seiner Heimatstadt. An den Mauerresten der ehemaligen Mädchenschule bleiben wir stehen. Eine älter wirkende Frau kauert neben dem Schutt, bewegt ihren Kopf hin und her und singt leise ein Kinderlied. Ich will mich zu ihr hinabbeugen und sie ansprechen, doch Ghul Aga hält mich zurück: »Seit dem Tag des Bebens sitzt diese Frau jetzt hier vor der zerstörten Schule und wartet, dass ihre beiden kleinen Töchter herauskommen. Ihr Mann und die Söhne sind von den Trümmern ihres eigenen Hauses begraben worden. Die beiden Mädchen kamen in der Schule ums Leben. Wir haben die Leichname der Männer und der beiden Töchter schon vorgestern geborgen und begraben. Die Mutter hat das alles nicht verkraftet und ist verrückt geworden. Seither isst und trinkt sie nichts mehr. Wir suchen jetzt nach Überlebenden der Familie – einem Bruder oder Onkel –, um diese arme Frau in ihre Obhut zu geben.«
Unser weiterer Weg führt über Steintrümmer, Ziegelhaufen und Betonbrocken. Rauch und Nebelschwaden steigen aus dieser Wüstenei auf. Im Norden sind die Gipfel der Vier- und Fünftausender schon mit Schneehauben bedeckt. Eine Idylle wie in einem kitschigen Heimatfilm, läge nicht überall der Geruch des Todes in der Luft. Beim Klettern über die verbogenen Streben der Stahlbrücke im Stadtzentrum starre ich fassungslos auf den reißenden Fluss unter uns: Er ist blutrot gefärbt. »Nein«, erklärt Ghul Aga, der meine Frage schon ahnt, »das ist natürlich kein Blut. Unser Fluss führt im Herbst immer eisenerzhaltiges, rötliches Wasser. Daher nennen wir ihn auch den ›Roten Fluss‹.«
Jetzt, da es wärmer wird, begegnen wir endlich Menschen. Die Geisterstadt erwacht zum Leben. Unter den schräg stehenden Betondecken des einstigen Obstbasars preisen die Händler lautstark Gemüse, Äpfel, Orangen und Bananen an. Auf dem jetzt ebenerdigen Dach eines eingestürzten Hotels steht der Barbier hinter einem wackeligen, dreibeinigen Friseurstuhl, der das Erdbeben weitgehend unbeschadet überstanden hat. Er schneidet jungen Männern die Haare und stutzt den Älteren den Bart. Frauen und Kinder suchen in den Trümmern nach Brennmaterial und stopfen Papier, Pappe, Stoffreste und Holzstücke in Plastiksäcke. Soldaten in Uniform, unterstützt von kräftigen Männern in Zivil, entladen Militärlaster und schleppen Säcke voll Reis und Mehl, Bündel mit Decken und Zelten in ein Lager mit Wellblechdach. Die Stadt ist wieder erwacht und atmet. Die lebendigen Gesichter der Menschen und ihre zupackenden Arme zeugen vom Willen zu überleben.
Am späten Nachmittag sitzen wir mit Ghul Aga im Kommandozelt einer pakistanischen Infanteriebrigade. Dieser Großverband soll zusammen mit der improvisierten Zivilverwaltung die Trümmer beseitigen, den Überlebenden schnell ein Dach über dem Kopf verschaffen und die Grundversorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Einrichtungen sicherstellen. Eine Massenflucht in die südlicheren Distrikte, die ja ebenfalls vom Erdbeben betroffen sind, muss unbedingt verhindert werden.
Zelte und Blechhütten
Vom Kommandeur dieser Brigade erfahren wir erstmals Einzelheiten über die Katastrophe: Mit einer Stärke von 7,6 auf der Richterskala wurden der Norden Pakistans und Teile Nordwestindiens vom stärksten Erdbeben seit hundert Jahren getroffen. Für die nächsten Tage und Wochen werden Nachbeben erwartet. Die Zahl der Toten liegt schon jetzt bei über 50000, mehr als 3,5 Millionen Menschen haben ihren gesamten Besitz verloren. Die meisten Schäden und Opfer sind in den entlegenen Bergdörfern zu beklagen. Straßen und Wege dorthin sind teilweise verschüttet. Es wird Wochen dauern, sie wieder freizuräumen. Bis dahin können die Menschen nur aus der Luft versorgt werden.
Auf zwei entscheidende Fragen geht der General nicht ein: Wie sollen die Menschen in den abgelegenen Dörfern aus der Luft versorgt werden? Die pakistanischen Streitkräfte verfügen zwar über Hunderte von Kampfflugzeugen und Kampfhelikoptern, besitzen aber nur wenige geeignete Transporthubschrauber. Außerdem steht der Winter vor der Tür. Wie können Millionen von Menschen vor Kälte und Schnee geschützt werden?
In Kleingeländewagen der Armee und zu Fuß erkunden wir während der folgenden Tage zusammen mit Pionieroffizieren entlegene Dörfer, die an der Grenze zwischen Kaschmir und der pakistanischen Nordwestprovinz liegen. An den Abenden diskutieren wir mit den Militärs und Ghul Aga, welche Art von Hilfe wir im Raum um Balakot leisten können. Inzwischen laufen im benachbarten Kaschmir bereits die ersten Hilfsaktionen ausländischer Organisationen an.
Wir kehren zurück nach Peschawar. Dort hat Annette während der letzten Tage unsere Freunde in Deutschland per E-Mail und Telefon informiert und erfolgreich um Unterstützung geworben. Sie verlässt Pakistan und wird an der »Heimatfront« die Hilfe organisieren. Alem und ich bereiten die ersten Hilfslieferungen in Pakistan vor.