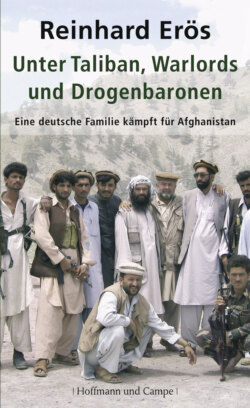Читать книгу Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen - Reinhard Erös - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
Kubaner im Schnee
Fünfzehntausend Kilometer von Havanna entfernt flattert an der Ausfahrt in eine Stichstraße eine blau-weiß gestreifte Fahne, darauf ein rotes Dreieck mit weißem Stern. Wenn ich es nicht sicher wüsste, würde ich es nie für möglich halten: Es ist die kubanische Nationalflagge! Auf einem zerfledderten, aufgeweichten Pappschild neben der Fahne entziffere ich – mit Filzstift geschrieben –: Cuban Medicel Unitt. Die kubanische Flagge, ein billiges Pappschild, falsches Englisch … Also wohl tatsächlich Kubaner. Aber was, um Himmels willen, machen kubanische Ärzte in einem Erdbebengebiet der verschneiten Bergwelt Pakistans?
Da heute die Zeit nicht drängt und wir am Vormittag ein Dutzend neue Häuschen übergeben haben – also in bester Stimmung sind –, beschließen wir nachzusehen, ob sich hinter dem Gatter in einem grauen Gebäudekomplex am Ende der Stichstraße tatsächlich Kommunisten aus Mittelamerika befinden. Ein einheimischer Wachposten öffnet freundlich das Tor und führt uns zu den »Doctores from America«, wie er die Unbekannten nennt. US-Amerikaner, die sich mit einer kubanischen Flagge tarnen? – Völlig unmöglich! »Eher schlüpft ein CSU-Funktionär unter die Burka …!«, erkläre ich Alem, der mit diesem Vergleich nichts anzufangen weiß, aber trotzdem lacht. Da hören wir auch schon spanische Stimmen. Meine Sprachkenntnisse sind hier eher dürftig, trotzdem erkenne ich üble Flüche mit religiösem Bezug wie puerco und dios. Als wir den Plastikwindschutz am Eingang zur Seite schieben, erblicken wir als Erstes eine hochgewachsene, breitschultrige, dunkelhäutige und kräftig geschminkte Schönheit in weißem Kittel. Sie bückt sich gerade nach den Scherben einer Kaffeetasse. Daher also das Fluchen! In ihrer Rechten glimmt eine dicke Zigarre: una Cubana autentica. Die Frau ist nicht allein. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen sitzt lachend an einem mit Tassen und Kaffeekanne gedeckten Tisch.
Feierliche Übergabe eines Blechhüttendorfes an die Erdbebenopfer
Als ich sie mit meinem holprigen Touristen-Spanisch anspreche, geraten sie regelrecht aus dem Häuschen. Umarmungen und Küsschen auf die Wangen für uns beide – auch von den Frauen. Der arme Alem ist völlig überrumpelt, doch er hat keine Chance, sich dieser gänzlich »unislamischen« Begrüßung zu erwehren. »Da kein anderer Moslem im Raum war und es gesehen hat«, vertraut er mir später verschmitzt an, »war es eigentlich ganz o.k.« Ein echter Fundamentalist wird mein afghanischer Freund wohl nie! Ich genieße den seit Wochen vermissten »Schwarzen ohne Milch und mit viel Zucker« und revanchiere mich mit dem Restbestand aus meiner Kiste Montecristo Nr. 4, die ich auch in den unwirtlichsten Gegenden dieser Welt bei mir zu tragen pflege.
»Man kann – auch in den übelsten Drecklöchern der Welt – auf alles verzichten, außer gelegentlich auf etwas Luxus«, hat mir vor vielen Jahren einer meiner Lehrmeister auf den Weg gegeben und mir dabei eine Zigarre überreicht. Und noch heute erinnere ich mich mit Lustgefühl daran, wie gut mir, dem ärztlichen Greenhorn, im knöcheltiefen Schlamm des überschwemmten Dhaka in Bangladesch seine geschenkte Havanna geschmeckt hat. Wenn Fachleute in Sachen Zigarren – afficionados – behaupten, eine Havanna könne man nur ab 20.00 Uhr in einem Nobelrestaurant zu teurem Cognac richtig genießen, so sage ich ihnen: »Falsch. Nach harter Arbeit und stinkend vor Schweiß, bei einem Glas heißem Tee auf dem Lehmfußboden einer afghanischen Hütte, schmeckt sie am besten.«
Unzählige Mal bitte ich die vor Freude übersprudelnden Kolleginnen und Kollegen aus der Karibik, langsamer zu sprechen. Vergeblich. Allem Anschein nach bin ich der Erste und Einzige hier, der sich mit ihnen – wenn auch nur mühsam – in ihrer Muttersprache verständigen kann. Nur einer der Kubaner, der Anästhesist, spricht etwas Englisch. Urdu oder Paschtu, die beiden Landessprachen in dieser Gegend, beherrscht keiner der Ärzte. Und Spanisch ist in Pakistan so verbreitet wie Kisuaheli in Wanne-Eickel. Es ist mir ein Rätsel, wie die Kollegen hier ohne qualifizierte Dolmetscher überhaupt tätig sein können. »Wir arbeiten bisher hauptsächlich chirurgisch«, erklärt mir ihr Chef, »da müssen wir kaum mit dem Patienten sprechen. Viel mehr Probleme bereitet uns die zunehmende Kälte. Sie behindert auch unsere Arbeit in den ungeheizten OP-Räumen. Wir sind mit unserer sommerlichen Kleidung aus Kuba angereist. Und Geld, um uns hier im Land Winterbekleidung zu kaufen, haben wir nicht. Wir verdienen im Monat 150 US-Dollar, und selbst diese werden an unsere Familien zu Hause ausbezahlt. Die 150 greenbacks« – diesen Ausdruck für US-Dollars kennen also selbst die Kubaner – »sind doppelt so viel, wie wir daheim verdienen würden. Deshalb haben wir uns gern für diese Mission gemeldet.«
Ich erinnere mich daran, dass Kuba seit Jahrzehnten seine gut ausgebildeten Ärzte – alles Staatsangestellte – als temporäre »Exportschlager« in Südamerika und Afrika einsetzt. Aber im streng islamischen Pakistan?! Beim Abschied verspreche ich, ihnen noch vor Weihnachten warme Winterkleidung zu besorgen. Außerdem will ich versuchen, das Sprachproblem zu beheben. Auf der langen Fahrt nach Peschawar kommt mir da ein guter Gedanke. Unser Sohn Urs hat wie seine drei Brüder vier Jahre lang mit uns in Pakistan gelebt. Obwohl er damals erst in die Schule kam, lernte er neben seiner Muttersprache und Englisch beim Spielen mit unseren pakistanischen Nachbarskindern auch etwas Urdu. Das ist nun zwanzig Jahre her. Seit 2002 begleitete er mich, inzwischen Student der Rechte, mehrere Male nach Pakistan und Afghanistan und hat dabei seine Urdu-Kenntnisse deutlich verbessert. Im vergangenen Jahr arbeitete er mehrere Monate bei einer Rechtsanwaltskanzlei in Argentinien und als Praktikant an der deutschen Botschaft in Quito, der Hauptstadt von Ecuador. Auch seine Spanischkenntnisse sind inzwischen also recht passabel.
Kinder vor einer Blechhütte im Schnee
Zurück in Peschawar, gelingt es mir am Abend dann endlich, eine Telefonverbindung nach Deutschland herzustellen. Urs sitzt gerade über seinen Büchern und bereitet sich auf sein Erstes Staatsexamen vor. Ich eröffne ihm meinen Plan: »Du verschiebst dein Staatsexamen – der Vater bezahlt ein weiteres Semester – und kommst stattdessen für einige Monate zu mir nach ›Kubanistan‹ in die Berge. Als unbezahlter ›Chefdolmetscher‹ sorgst du dafür, dass die kubanischen Ärzte sinnvoll arbeiten und ihre Fähigkeiten zum Wohl der Kranken und Verletzten voll einsetzen können.«
Ich habe nicht erwartet, dass Urs ablehnen würde. Aber mit einem so begeisterten »Ich fliege gleich morgen!« habe ich auch nicht gerechnet. Es dauert dann doch einige Tage, bis er ein Visum erhält und sich in der »Holzklasse« des Billigfliegers PIA (Pakistan International Airlines) auf den Weg machen kann. Die pakistanische Fluglinie ist nicht umsonst die preisgünstigste; technische Probleme und häufige Verspätungen haben ihr bei Pakistan-Kennern auch zum Namen PIA – Perhaps It will Arrive verholfen.
Urs kommt wohlbehalten bei uns an und bleibt bis wenige Tage vor Weihnachten. Während dieser sieben Wochen hat er ausgiebig Gelegenheit, sich in verschiedenen kubanischen Krankeneinrichtungen nützlich zu machen: Er übersetzt in der Ambulanz und im OP. Mit einem Sanitätsrucksack auf dem Rücken begleitet er die frierenden Medizinerteams in tief verschneite, entlegene Bergdörfer. Zweimal wöchentlich versorgen Alem und ich die kubanischen Kollegen mit Medikamenten aus Islamabad. Auch die Lieferungen von Metallhütten, Winterkleidung und Lebensmitteln nach Balakot gehen unvermindert weiter. Regen, Schnee und Schlamm erschweren inzwischen die »Fußtransporte« der Blechteile in steilere Regionen. Daher gehen wir gern auf das Angebot des Generals ein und fliegen bei halbwegs guter Sicht mit pakistanischen Hubschraubern die lebensrettenden Häuschenteile auf Paletten in große Höhen.
Urs Erös beim Dolmetschen in der chirurgischen Ambulanz des kubanischen Lazaretts
Einige Tage vor Heiligabend sitzen wir auf zweitausend Meter Höhe gemütlich mit unseren kubanischen Freunden um den rot glühenden Kanonenofen in der zigarrenrauchgeschwängerten Luft des Aufenthaltsraums und genießen wieder einmal den wunderbaren »Schwarzen mit viel Zucker ohne Milch«. Draußen ist es bitterkalt. Der knöchelhohe Schnee auf dem gesamten Krankenhausgelände dämpft wohltuend den Dauerlärm des Generators. »Jetzt, zu Weihnachten, haben wir schon etwas Heimweh«, gesteht der Chef der siebenköpfigen Gruppe, »seit mehr als zwei Monaten sind wir nun schon hier und wissen nicht, wie lange wir noch bleiben müssen. Das gilt nicht nur für uns hier in Balakot, sondern für alle Kubaner im Erdbebengebiet.«
Der vorweihnachtliche Abend in Nordpakistan entwickelt sich dann zu einer Vorlesung zum Thema »Medizin im sozialistischen Kuba«. Der junge, dynamische Unfallchirurg erklärt: Zurzeit bilden wir auf Kuba 10000 junge Männer und Frauen zu Ärzten aus. Die meisten entstammen ärmeren Familien aus Lateinamerika und der Karibik. 25000 kubanische Ärzte und medizinische Hilfskräfte sind jährlich rund um den Erdball im Einsatz. Trotz des jahrzehntelangen US-Embargos ist die medizinische Versorgung in unserem Land für alle Bürger gesichert und kostenlos. Das kubanische Gesundheitssystem gilt als das beste in ganz Lateinamerika.
Ich kann die Zahlen und Daten, die er uns nennt, zunächst gar nicht glauben.
Mehr als zweitausend Ärzte, Krankenschwestern und technisches Fachpersonal hat unser bekanntlich nicht besonders wohlhabendes Land schon wenige Tage nach dem Beben auf den Weg geschickt. Mit etwa achthundert Ärzten stellen wir das mit Abstand größte Medizinerkontingent aller Länder hier in den Bergen; sogar Pakistan selbst hat nur sechshundert Ärzte im Einsatz. Unsere dreißig Lazarette sind für hiesige Verhältnisse sehr gut ausgestattet – mit Röntgengerät, Ultraschall und EKG. Unsere mobilen ›Pudelmützenteams‹ dringen als Katastrophenhelfer mit ihren Rucksäcken zu Fuß auch in die entlegensten Dörfer vor. Inzwischen haben wir über 200000 Patienten behandelt. Dein Sohn Urs hat uns einige Male begleitet. Kein anderes Land der Welt, insbesondere keiner der reichen kapitalistischen Staaten, leistet Ähnliches. Darauf sind wir sehr stolz. Umso mehr ärgert es uns, dass wir und unsere Arbeit in den westlichen Medien totgeschwiegen werden. Unsere Bezahlung kennst du ja: 150 US-Dollar im Monat! Trotzdem sind wir kubanischen Ärzte und Krankenschwestern glücklich, diesen armen Menschen – egal ob Moslem oder nicht – helfen zu können.
Seine Geschichte wühlt mich auf, vielleicht, weil der Kollege sie so sachlich erzählt. 150 US-Dollar Monatsgehalt für einen qualifizierten Chirurgen, der bei eisiger Kälte unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen hier in den Bergen seit Wochen Leben rettet! Denselben Betrag bezahlt der NATO-Stab in Islamabad für eine Übernachtung eines einzigen Offiziers im First-Class-Hotel. Ich schäme mich als ehemaliger Offizier eines NATO-Landes. Man muss das kommunistische, die Menschenrechte im eigenen Land häufig missachtende System Kubas wirklich nicht lieben; doch die humanitären Leistungen seiner »medizinischen Botschafter« hier auf der anderen Seite des Globus sind wahrhaft bewunderns- und berichtenswert.
Dass »Reisen bildet«, ist allgemein bekannt. Aber dass ich, durch ein Erdbeben von meiner eigentlichen Arbeit in Afghanistan in die winterliche Bergwelt an der Grenze zu Kaschmir verschlagen, kubanischen Ärzten begegne und aus ihrem Munde höchst erstaunliche Dinge über das Gesundheitswesen der kommunistischen Karibikinsel erfahre – das grenzt an ein Wunder. Alem, vor zwanzig Jahren Mudschahed und Todfeind aller afghanischen Kommunisten, trifft den (moslemischen) Nagel auf den Kopf, als er beim Abschied zu den Cubanas und Cubanos sagt: »Ich danke und bewundere euch, dass ihr so großartige Hilfe leistet. Schade, dass ihr Kommunisten seid. Ihr würdet wunderbare Moslems abgeben. Überlegt es euch. Dann würden wir uns spätestens im Paradies wiedersehen.«