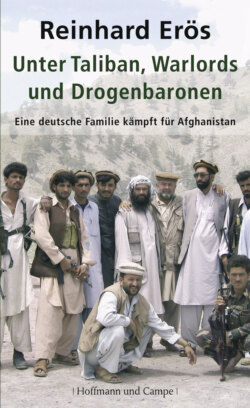Читать книгу Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen - Reinhard Erös - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vertreibung aus dem Paradies
ОглавлениеDer Tag beginnt wie ein Märchen aus »Tausendundeiner Nacht«. Es ist erst 8.00 Uhr morgens, und schon wärmt die afghanische Sonne das tiefgrüne Gras der Felder. Wir warten. Hunderte von Mädchen, sehr kleine und schon halb erwachsene, warten mit uns seit über einer Stunde ungeduldig zwischen graubraunen Lehmhütten am Westrand der Paschtunenstadt Jalalabad.
Die Kleinen kichern und albern herum. Sie stecken in festlichen, gold- und silberbestickten Brokatkleidchen. Ihre glänzend schwarzen schulterlangen Haare spitzen unter den weißen Kopftüchern hervor. Die älteren Mädchen unterhalten sich dezent mit der Würde der Beinahe-Erwachsenen – züchtig im schwarzen Schülergewand, das Haar vollständig unter einem weißen Schleier versteckt. Heute ist ein besonderer Tag für die Kinder. Ein Tag, um zu feiern. Viele Mädchen sind aus Jalalabad und den umliegenden Dörfern hierhergekommen. Sie haben schulfrei, und darüber freuen sich nun mal alle Kinder auf der Welt. Für die anderen Mädchen, die hier leben, ist dieser Tag der Beginn einer neuen Zeit. Denn heute wird der Grundstein für eine Schule gelegt. Für ihre neue Schule! Darauf haben sie, ihre Eltern und die Lehrerinnen seit vielen Jahren gewartet. Während der Herrschaft der Taliban*[1], deren Sturz ja erst wenige Jahre zurückliegt, waren alle Mädchenschulen geschlossen worden. Damals war es Mädchen strengstens verboten, zur Schule zu gehen, und Lehrerinnen erhielten Berufsverbot. Nur wenige Mutige haben heimlich und unter Lebensgefahr in ihren privaten Häusern Mädchen unterrichtet.
Seit dem Sturz der Taliban können Mädchen wieder zur Schule gehen – aber natürlich nur, wenn es Schulen gibt. Bislang fehlte es an Geld. Nun aber kann die ersehnte Schule endlich gebaut werden. Das verdanken wir der Großzügigkeit des bekannten Schauspielers Walter Sittler, der seinen 65000-Euro-Gewinn bei der Quizsendung »Wer wird Millionär« unserer Organisation gespendet hat. Deshalb sind wir nun alle hier: die aufgeregten Mädchen, meine Frau Annette und ich sowie unsere Freunde Sigrid und Walter Sittler. Wir stehen auf einem staubigen Feldweg, der zu einer riesigen, herbstbunten Wiese führt, und erwarten die Ankunft hoher Gäste aus Kabul, die uns die Ehre geben wollen, der Grundsteinlegung beizuwohnen.
Wir Ausländer werden in Afghanistan almani genannt. Das bedeutet ganz sachlich »Deutsche«, hat hier im Osten des Landes aber seit Jahrzehnten einen überaus positiven Klang. Weniger freundlich ist für nicht moslemische Ausländer die Bezeichnung farangi. Das Wort stammt vermutlich aus der britischen Kolonialzeit und ist eine Verballhornung von foreigners – »Fremde«.
Im Unterschied zu den jungen Einheimischen rinnt uns ob der ungewohnten Hitze schon am frühen Morgen der Schweiß von der Stirn. Der lockere, leichte Shalwar-Kamez – die Baumwollbekleidung der Paschtunen* mit Pluderhose und weitem, knielangem Hemd – klebt uns sichtbar am Rücken.
Plötzlich kommt geordnete Bewegung in die Grüppchen der schwatzenden Mädchen. Wie auf Kommando nehmen sie zu beiden Seiten des Weges Aufstellung. Aus ihren Schultaschen ziehen sie Stofffähnchen hervor, reißen die Arme hoch und winken. Schwarz-rot-grüne Fähnchen – die afghanischen Nationalfarben – flattern links des Weges, die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold auf der rechten Seite. Zwischen den Fähnchen nähert sich ein Kleinbus. Annette und Sigrid ziehen den ungewohnten seidenen Schal auf ihren Köpfen zurecht, streichen die zerknitterten Pluderhosen und weiten Baumwollblusen glatt und gehen auf eine Gruppe von Frauen zu, die nun dem Bus entsteigen. Sie tragen knöchellange, bis zum Hals hochgeknöpfte Mäntel von edlem Grau: die typische Kleidung der liberalen Lehrerinnen Afghanistans. Keine dieser gebildeten Frauen, weder die jungen noch die älteren, trägt hier in der Öffentlichkeit die Burka* – dabei befinden wir uns im Herzen des Paschtunengebietes! Nun heißen sie unsere Frauen herzlich willkommen. Die Afghaninnen unterrichten an der Allaei- und der Bibi-Hawa-Mädchenoberschule, die in den vergangenen Jahren von unserer Organisation gebaut wurden. Meine Frau, selbst Lehrerin, kennt die meisten von ihnen mit Namen und unterhält sich auf Englisch über Kinder und Familie, denn das sind für afghanische Akademikerinnen wichtige Themen.
Währenddessen treffen weitere Gäste ein: Zusammen mit Walter und unseren männlichen afghanischen Mitarbeitern begrüße ich – in gebührendem Abstand zu den Frauen – den Gouverneur und den Schulminister der Provinz Nangahar sowie den Bürgermeister von Jalalabad. Er war einst ein berüchtigter Taleb, ist aber inzwischen »bekehrt«. Dann stellt uns der Gouverneur den Rektor der Universität von Nangahar vor. Dieser ist erst vor wenigen Monaten aus den USA zurückgekehrt, wo er an einer renommierten Südstaaten-Universität fünfundzwanzig Jahre als Professor für Rechtsmedizin tätig war. Er trägt einen dunklen, westlichen Anzug mit weißem Hemd und blau gestreifter Krawatte, eine elegante Brille, aber keinen Bart. Wie er uns in bestem Texanisch erläutert, will er jetzt seiner »patriotischen Pflicht« nachkommen und die unter den Taliban daniederliegende Hochschule wieder zum Leben erwecken. Etwas abseits von uns steht eine schweigsame Gruppe würdiger alter Männer mit Vollbärten und gewaltigen Turbanen. Kritisch beäugen sie den »Amerikaner« und die anderen Ausländer. Es sind die Maliks*, Khans und Mullahs* – Dorfbürgermeister, noble Herren und Religionsgelehrte aus den Nachbardörfern. Auch ohne Musikkapelle und roten Teppich herrscht auf dem Acker eine Atmosphäre wie bei einem Staatsempfang. Stil und äußere Formen spielen bei den Afghanen, besonders auf dem Land, eine wichtige Rolle.
Endlich nähert sich, flimmernd wie eine Fata Morgana, ein langer Autokonvoi aus Richtung Kabul. Der Erziehungsminister des Landes beehrt uns mit der in Afghanistan üblichen Entourage. Kein Wunder, dass alle hier aufgeregt sind. Der Konvoi aus noblen Geländefahrzeugen biegt jetzt in den Feldweg ein und fährt, eine gewaltige Staubwolke hinter sich herziehend, durch die Reihen der Fähnchen schwingenden und jubelnden Mädchen. Der Ranghöchste unter uns, der Gouverneur, eilt zum Fahrzeug an der Spitze und begrüßt den Rais. Das ist ein ursprünglich arabischer Ehrentitel für besonders hochgestellte Persönlichkeiten, der auch von den Afghanen benutzt wird. Der Minister fährt einen Landcruiser, das neueste Modell mit Ledersitzen, Klimaanlage, Autotelefon und Funkantenne. Ein halbes Dutzend uniformierter, mit Maschinenpistolen bewaffneter Männer springt von der Ladefläche des begleitenden Pick-ups. Mit finsteren Blicken umringen sie uns Umstehende, halten den »Chef« im Auge und die Gewehre im Anschlag. Minister leben auch in Afghanistan gefährlich, besonders in den östlichen Provinzen. Beflissen stellt der Gouverneur dem hohen Gast aus Kabul zunächst seinen Stab und die beiden männlichen Ausländer vor. Mit etwas Abstand folgen dann die Frauen. Eine Rang- und Reihenfolge, an die sich Ausländer in diesem zumindest äußerlich männlich dominierten Land immer wieder gewöhnen müssen. »Wir Männer präsentieren in der Öffentlichkeit – unsere Frauen regieren im Haus und von zu Hause aus«, hat mir einst ein alter Paschtunenfürst augenzwinkernd anvertraut.
Nun kann der Festakt beginnen. Afghanen sind großartige und begeisterte – meist auch begeisternde – Redner und Schauspieler. Heute geben sie mit Walter Sittler erstmals einem deutschen Schauspieler eine Probe ihrer Talente. Der Mullah, ein würdiger Alter mit grauem Vollbart und weißem Turban, leitet den Festakt mit einem Gebet ein. Er erbittet und ersingt mit einem bühnenreifen Bariton den Segen Allahs für den Bau und alle, die daran mitwirken. Die eben noch vor Aufregung übersprudelnde Schar der Mädchen ist jetzt mucksmäuschenstill und lauscht den Rednern mehr als zwei Stunden lang.
Mädchen bei der festlichen Grundsteinlegung ihrer neuen Schule
Der Minister aus Kabul schreitet natürlich als Erster an das Mikrofon. Wie in jedem streng islamischen Land üblich, beginnt er seine Rede auf Arabisch mit der basmala, der Eröffnungsformel aller Suren: Bismillah ir-rahman ir-rahim – »Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Erbarmers«. Ganz Staatsmann, dankt er zunächst überschwänglich uns Deutschen, die den weiten Weg aus Europa nach Afghanistan gewagt haben, um am heutigen Tag mit der Grundsteinlegung für eine weitere Mädchenschule die fast einhundertjährige Freundschaft zwischen beiden Völkern fortzusetzen. Aufgrund der weitsichtigen Politik des Präsidenten Karzai sei in den vergangenen Jahren dem Wiederaufbau des von den Taliban zerstörten Bildungssystems besonderes Augenmerk geschenkt worden, und vor allem mit der Hilfe aus Deutschland könnten inzwischen wieder Hunderttausende Kinder eine Schule besuchen.
Der Gouverneur und sein Schulminister danken wiederum dem Minister aus Kabul, dass auch er den beschwerlichen Weg nicht gescheut habe. Nicht ohne Stolz weisen sie darauf hin, dass mit dem »Doktor Sahib« aus Deutschland ein alter Freund der Paschtunen zurückgekehrt sei, der schon während des Dschihad gegen die sowjetischen Besatzer an ihrer Seite stand. Mit Unterstützung der »Kinderhilfe Afghanistan« – dieses deutsche Wort geht beiden inzwischen geläufig über die Lippen – sind in Nangahar während der letzten vier Jahre sieben Schulen gebaut und modern eingerichtet worden. Und heute wird diese Arbeit sichtbar fortgesetzt. Mit strengem Blick zu den Kindern erläutern die Redner die Bedeutung von Schule, Bildung, Erziehung und fleißigem Lernen für den Wiederaufbau des Landes, »denn sonst wird das Unheil kein Ende nehmen«.
Nach den Reden hat wiederum der Mullah das Wort und beginnt mit der Sure 58 aus dem Koran: »Allah wird diejenigen erhöhen, die nach Wissen streben.« Und an die Mädchen gewandt, zitiert er zwei Sätze aus den Hadith, den Berichten von beispielhaften Aussprüchen und Taten des Propheten Mohammed: »Sich Wissen anzueignen, ist die Pflicht von Mann und Frau.« Und: »Wissen ist das verlorene Erbe der Muselmanen. Bewahrt es, wo immer ihr es findet.«
Nun stimmt eine Gruppe blumengeschmückter Erstklässlerinnen der Bibi-Hawa-Mädchenoberschule paschtunische Volkslieder an, in denen die Schönheit der Heimat mit ihren ewig schneebedeckten Bergen, dem saftigen Grün der Wiesen und Weiden und den köstlichen Früchten der Felder besungen wird.
Nach mehr als zwei Stunden Reden, Beten und Singen überreicht unser langjähriger, bewährter Bauleiter Haji Ashraf dem Mullah, dem Minister, dem Gouverneur und uns beiden männlichen Deutschen einen sicher fünfzehn Kilogramm schweren Feldstein. Die »Grundsteinlegung« nimmt man in Afghanistan wörtlich: Gemeinsam legen wir fünf den Stein an der Stelle ab, wo schon am nächsten Tag der erste Spatenstich erfolgen wird. Wir umarmen uns und durchschneiden ein buntes Band. Dieses Ritual hat in Afghanistan etwa die Bedeutung des Handschlags, mit dem Bauern und Viehhändler in Deutschland ein für beide Seiten einträgliches Geschäft besiegeln: Nachdem das Band durchschnitten ist, gibt es kein Zurück mehr.
Den Kindern und Gästen werden Bonbons gereicht, die afghanischen Ehrengäste umarmen sich und uns – und dann geht es endlich »zu Tisch«, genauer gesagt, auf Teppiche und Bodenkissen. Für uns Ausländer hat der fürsorgliche Gastgeber extra zwei bunt bemalte tschapoi vorbereitet: bettähnliche, mit Lederstreifen bezogene Gestelle. Walter – zum ersten Mal in Afghanistan – verschmäht diesen Komfort und setzt sich zu den Afghanen auf den Boden. Annette und ich feixen, denn wir wissen aus schmerzhafter Erfahrung, dass er bald keinen Muskel mehr wird rühren können. Aber noch sind wir frisch und genießen auf echten Turkmann-Teppichen den Festschmaus unter luftigen Zeltdächern im Schatten dicht belaubter Maulbeerbäume. So stelle ich mir das Paradies vor.
Begrüßung der Gäste durch einen Mädchenchor
Junge Burschen aus dem nahe gelegenen Dorf servieren riesige Schüsseln mit dampfendem kofta tschalau – Reis mit Fleischklößchen, Kichererbsen und Pflaumen –, schwere Platten mit knusprigen Hähnchenschlegeln und dicken, saftigen Brocken von fettem Hammelfleisch in dunkler, schwerer Soße und schließlich große Teller mit kabab-e-tekka, den köstlichen Lammfleischspießchen mit Zwiebeln und Paprika. Dazu reicht man uns kleine Schüsseln mit tschhatni-mast, der berühmten afghanischen Joghurtsauce mit viel Knoblauch und Zitronensaft. Zum Nachtisch gibt es zartgelbe kleine Bananen, kupferfarbene Granatäpfel, geteilt in kleine Stückchen, und unvergleichlich süße Weintrauben aus Nuristan – die besten Trauben, die Allah auf dieser Welt wachsen lässt. Die Afghanen essen gern, viel und gut – sofern sie es sich leisten können. Wer als Ausländer sein Gewicht reduzieren möchte, sollte seinen Urlaub also besser nicht bei den Paschtunen verbringen.
Wie überall auf der Welt haben Minister und andere Amtsträger auch in Afghanistan eine Unmenge von Verpflichtungen. Und so ist niemand gekränkt, als Minister und Gouverneur sich frühzeitig verabschieden. Der Politiker aus Kabul verspricht uns feierlich, zur Schuleröffnung im Frühjahr wieder in den Osten zu kommen; dies sei er schon allein den Gästen aus Deutschland schuldig. Ich danke ihm, obgleich ich mir keineswegs sicher bin, ob wir uns wiedersehen werden. Die Fluktuation im Kabinett von Präsident Karzai gilt als eine der höchsten weltweit. Auch der Gouverneur versichert mir bei der herzlichen Abschiedsumarmung, dass er sich persönlich regelmäßig über die Baufortschritte informieren wird. Faulheit der Arbeiter oder Materialmängel werde er nicht dulden. Als die Schule dann ein halbes Jahr später eröffnet wird, sind beide Politiker nicht mehr im Amt.
Der Festschmaus ist für unsere Freunde aus Deutschland eine Premiere der besonderen Art. Bei stolzen fünfunddreißig Grad im Schatten hocken sie mit angewinkelten Beinen auf dem Boden; Mücken sitzen auf Gesicht, Kopf und Beinen; Käferchen krabbeln über Platten und Teller. Und nun soll man sich ohne Löffel, Gabel und Messer feinkörnigen Reis und daumengroße, fetttriefende Fleischbrocken zum Munde führen. Das ist nicht jedes Europäers Sache. Darüber hinaus müssen Sigrid und Walter Sittler ihre afghanischen Nachbarn ständig daran hindern, ihnen Fleisch, Gemüse und Reis nachzureichen. Die Afghanen sind die gnadenlos besten Gastgeber des Mittleren Ostens.
Am späten Nachmittag und nach vielen Gesprächen über unser Heimatland, die deutsch-afghanische Freundschaft und die »komplizierte Politik der Amerikaner« brechen wir auf. In unserem alten Pick-up, einem Relikt aus Talibanzeiten, fahren wir zurück zu unserem kleinen Büro, einem einfachen Lehmhaus in einem kleinen Vorort im Süden von Jalalabad. Ein paschtunischer Freund, der jetzt im pakistanischen Peschawar lebt, hat es uns vor einem Jahr für umgerechnet 120 US-Dollar im Monat vermietet.
Wir haben uns ganz bewusst für dieses einfache Häuschen entschieden, weil wir die schwindelerregenden Mietpreise für Ausländer in Kabul weder uns noch unseren Spendern in Deutschland zumuten wollten. In der Hauptstadt wimmelt es seit dem Sturz der Taliban im Winter 2001 von Hilfsorganisationen. Angeblich sind in Kabul mehr als zweitausend sogenannte NGOs (Nichtregierungsorganisationen) registriert, die von dort seit über drei Jahren zusammen mit Dutzenden UN-Organisationen den Wiederaufbau »planen und organisieren«. Mit mäßigem Erfolg, wie man hört und liest – und wie wir es im Osten leider live erleben müssen. Wir meiden Kabul, wo immer es geht. Seit dem Sturz der Taliban hat sich die Einwohnerzahl dort versechsfacht. Rund um die Uhr quälen sich Kolonnen von Autos durch die Straßen und Gässchen der Metropole und verpesten die früher so wunderbar frische Luft der Hochebene. Abwässer fließen zum Teil offen und stinkend am Straßenrand entlang. Kabul ist zu einem typischen »Dritte-Welt-Moloch« verkommen. Natürlich lebt es sich in der Hauptstadt trotzdem bequemer und angenehmer, zumindest für die wohlhabenden Afghanen und natürlich für die »reichen« farangi.
Die meisten Ausländer residieren in den Nobelvierteln von Wazir-Akbar-Khan und der Shar-E-Now. Inzwischen gibt es in der Hauptstadt Hunderte exzellente Restaurants – Lokale für Ausländer haben oft auch eine Alkohol-Lizenz –, Fünf-Sterne-Hotels mit Butler-Service, luxuriöse Gästehäuser mit Kabelfernsehen und hundert Kanälen sowie Internetzugang via WLAN, Videotheken mit Edelpornos und »Härterem«, Feinkostgeschäfte, die Schweizer Schokolade und englisches Roastbeef führen, blau verglaste, mehrstöckige Kaufhäuser mit Rolltreppen und Parkplatzproblemen, Golfclubs, bei denen man zwei Jahre auf seine Mitgliedschaft warten muss, und seit Kurzem auch Hundefriseure. Von anderen »Etablissements« ganz zu schweigen. Aber: Wir spielen weder Golf, noch haben wir einen Hund – und schon gar keinen, der im Fachgeschäft gegen harte Dollars gewaschen und geföhnt werden müsste. Videos könnten wir auch zu Hause ansehen, und auf original bayerisches Bier, schwäbische Spätzle, chinesische oder italienische Küche können wir – zumindest einige Wochen lang – gern verzichten, zumal diese exotischen Einrichtungen nichts Wesentliches zum Wiederaufbau Afghanistans beitragen.
Unser Häuschen war etwas heruntergekommen, doch wir haben es in mühsamer Eigenarbeit mit einer Dusche und einer komfortablen, sauberen Küche mit Gaskocher und kleinem Kühlschrank ausgestattet. Auf den Lehmböden der vier Zimmer haben wir einfache, dunkelrote Teppiche ausgelegt, wie sie in Afghanistan üblich sind. Dagegen ist es, zumindest außerhalb von Kabul, noch völlig unüblich, dass wir unser heißes Wasser über eine Solaranlage auf dem Dach beziehen – und mit einer kleinen Fotovoltaik-Anlage auch genügend Strom für die Beleuchtung der Zimmer, die Deckenventilatoren, unseren Weltempfänger und einen Schwarz-Weiß-Fernseher der Marke Grundig produzieren. Für 300 Afghani, also weniger als 10 Euro, haben wir dieses Monstrum von Röhrenfernsehgerät auf dem Basar erstanden. Der Oldtimer ist vermutlich ein Überbleibsel aus den Siebzigern, als deutsche Entwicklungshelfer hier in einem paradiesisch friedlichen Umfeld die Gastfreundschaft der Paschtunen genießen durften.
Deutsche Pädagogen haben viele Jahre lang an der Dar ul-Malemin, einer Art pädagogischer Hochschule, die Lehrerausbildung geleitet und dafür deutsche Curricula eingeführt. Ein bayerischer Professor baute an der Universität von Nangahar die erste zahnmedizinische Fakultät auf, und auf der Strecke nach Kabul haben Siemens-Ingenieure Wasserkraftwerke errichtet. In den vergangenen Kriegsjahrzehnten sind diese Kraftwerke schwer beschädigt, aber nicht völlig zerstört worden. Jetzt, beim Wiederaufbau des Landes, wäre billiger Strom lebenswichtig, auch um »Licht zu den Menschen zu bringen«. Niemand kann hier verstehen, warum die beliebten Deutschen nicht endlich wiederkommen und die benötigten Ersatzteile liefern und einbauen. »Haben die Deutschen Angst vor uns?«, werde ich immer wieder gefragt. Für unsere kleine »Kinderhilfe Afghanistan« ist ein solches Projekt allerdings einige Nummern zu groß. Und die leistungsstarken und fachlich kompetenten Organisationen sitzen eben alle in Kabul. Tempora mutantur … Wie sich doch die Zeiten geändert haben.
Als wir unser Haus übernahmen, wucherte im völlig verwahrlosten Garten nur Unkraut. Inzwischen blühen dort liebevoll angelegte Rosenbeete. Unser Koch, ein begeisterter Hobbygärtner, hat für seine Küche einen umfangreichen Kräutergarten sowie Tomaten-, Gurken- und Kartoffelfelder angelegt. Ein Orangenhain trägt dieses Jahr erstmals Früchte, und die Limonen hat Pacha Sahib, unser Buchhalter und Hausverwalter, vor wenigen Tagen geerntet. Meterhohe, uralte Maulbeerbäume bieten uns Schutz vor der im Sommer unerträglich brennenden Sonne im Kabul-Tal, einer der heißesten Gegenden des Landes. Die Herbstabende bringen jedoch rasch eine angenehme Abkühlung. Der Himmel über Nangahar wird nie richtig schwarz; er behält auch in tiefer Nacht sein dunkles Lapislazuliblau mit unzähligen Sternen und Sternschnuppen, die wie Goldstreifen glitzern und funkeln.
Unser Koch Taraki bleibt heute arbeitslos, denn nach einigen Gläsern chin-chai, dem mit Kardamom gewürzten grünen Tee, begeben sich die deutschen Gäste zur Ruhe. Vor dem Schlafengehen genießen wir die Annehmlichkeit unserer blitzsauberen Dusche mit Wasserreservoir auf dem Dach, waschen uns den Staub des Tages vom Körper und sinken um Mitternacht todmüde auf unsere afghanischen Betten. Ob der 1,95 Meter lange Walter allerdings auf der viel zu kurzen, brettharten Liege im Nachbarzimmer sofort einschlief, habe ich nie erfahren.
Mitten in der Nacht werde ich von einem Albtraum heimgesucht. Alles um mich herum schwankt. Noch im Halbschlaf klammere ich mich mit beiden Händen an die Rundhölzer meiner Liege. Die Erde bebt! Ich bin schweißgebadet. Sand aus der Lehmdecke rieselt mir ins Gesicht. Ich richte mich auf, reibe mir den Sand und Staub aus den Augen und sehe, wie sich über mir die Holzbalken biegen und seltsam hin und her bewegen. Es knirscht an Decke und Wänden. Plötzlich beginnen auch die Wände bedrohlich zu wanken. Eine Fensterscheibe zerspringt mit lautem Knall. Jetzt bin ich hellwach und springe hastig vom tschapoi auf. Das ist kein Albtraum, das ist Realität! Die Erde bebt! Ein solches Beben kann verheerend sein. Das habe ich in dieser Gegend vor vier Jahren schon einmal erlebt. Unser Buchhalter, der sonst für seine Überkorrektheit bekannte Pacha Sahib, stürzt ohne anzuklopfen in mein Zimmer: »Doktor Sahib, aufstehen, aufstehen!«, brüllt er mich wild gestikulierend an; völlig überflüssigerweise, denn ich stehe ja bereits. »Stehen« ist allerdings das falsche Wort: Wir wanken beide wie Betrunkene, und dies im »alkoholfreien« Paschtunengebiet. Nur halb angezogen stürze ich mit Pacha zusammen ins Freie. Walter, Sigrid und meine Frau torkeln ebenfalls aus dem Gebäude.
Für einige Minuten steht die Erde wieder im Lot. Wir atmen auf. Doch dann beginnt das Beben erneut: mal schwächer, dann wieder stärker. Dieses Horrorspiel geht minutenlang weiter. Unser kleines Lehmhaus wird mehrmals durchgeschüttelt, bleibt aber erstaunlicherweise stehen. Hilflos wie Kinder und starr vor Schreck halten wir Deutschen uns wortlos an den Händen. Pacha ist in sein Büro zurückgelaufen und schleppt Computer, Akten und Kisten ins Freie. Unsere drei anderen afghanischen Mitarbeiter haben im Garten ihre patu, die typisch afghanischen Wollumhänge, als provisorische Gebetsteppiche ausgebreitet und beten. Sie wirken ruhig und besonnen, als wäre dies ein ganz normaler Morgen. Ihre Gelassenheit strahlt langsam auch auf uns Deutsche ab, die wir über keine große Erdbebenerfahrung verfügen. Alem Jana, mein kampferprobter Freund aus den Zeiten der sowjetischen Besatzung und seit 2001 der afghanische Leiter unserer Projekte in den Ostprovinzen, zeigt ebenfalls keinerlei Panik und hängt an seinem Mobiltelefon. Ohne uns zu beachten, versucht er, eine Verbindung aufzubauen.
In Afghanistan gibt es zwar schon seit 2003 ein Mobiltelefonnetz, aber eben ein »afghanisches«, und da braucht man Geduld und nochmals Geduld. Mit Gesten fordert er mich auf, unseren Weltempfänger aus dem Häuschen zu holen und einzuschalten, damit wir Nachrichten hören können. Er selbst spricht jetzt mit seinem ältesten Sohn Mustafa in Peschawar, um zu erfahren, wie es in der nur etwa hundert Kilometer entfernten pakistanischen Stadt aussieht und ob es seiner elfköpfigen Familie gut geht. Noch während des Gesprächs wird Alem kreidebleich. Er winkt mich in den Garten. In den BBC-Nachrichten auf dem Weltempfänger wurde noch kein Erdbeben gemeldet. Doch Alem hat von seinem Sohn erfahren, dass in Peschawar Häuser eingestürzt und Dutzende von Toten zu beklagen sind. Auch aus dem Nordosten des Landes, aus der Hauptstadt Islamabad und aus Kaschmir, gibt es schreckliche Nachrichten. Ich informiere meine Frau und die Sittlers. Wir beschließen, Afghanistan sofort zu verlassen und über den Khyber-Pass nach Peschawar zurückzufahren. Noch wissen wir aber nichts vom Schicksal unserer Schulen. Vor drei Jahren sind einem Erdbeben nördlich von Kabul Hunderte von Menschen zum Opfer gefallen, und auch unser erster, gerade fertiggestellter Bau, die Allaei-Mädchenoberschule in Jalalabad, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Mädchen waren damals beim Einsturz einer Treppe verletzt worden.
Auf der Rückreise nach Pakistan wollen wir daher alle Schulen aufsuchen, die auf unserer Strecke liegen. Hat sich die aufwendige, stabile Bauweise der letzten Jahre wirklich gelohnt?
Alem ist damit einverstanden. Zwar möchte auch er so schnell wie möglich zu seiner Familie nach Peschawar, aber nicht ohne Zwischenstopp an den erst jüngst fertiggestellten Gebäuden. Wir umarmen Pacha, unseren treuen Buchhalter, Taraki, den frisch verheirateten Koch, und Farid, den graubärtigen chowkidar, unseren zuverlässigen, aber stets missmutig wirkenden Torwächter. Sie haben inzwischen erfahren, dass das Beben in Pakistan besonders schlimm gewütet hat, und verabschieden uns mit den Worten: Ba mane choda – »Gott schütze uns«. Pachas jüngerer Bruder Rohullha, unser furchterregend schielender Fahrer, sitzt bereits am Steuer des Pickups. Der alte Farid hat das schwere Eisentor geöffnet, und als er uns mürrisch wie immer zum Abschied winkt, liegt ein Hauch von Schmerz auf seinem Gesicht. Die Unbeschwertheit des letzten Tages ist vergessen und einer düsteren Ungewissheit gewichen. Voller Bangen verlassen wir unser kleines Paradies.