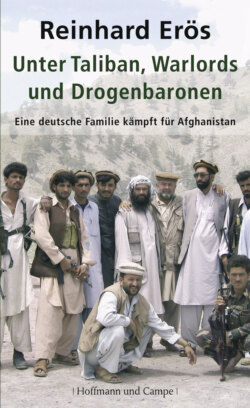Читать книгу Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen - Reinhard Erös - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Grenzüberschreitungen
ОглавлениеUnsere Angst um die Schulen erweist sich als unbegründet: Weder Schüler noch Lehrer sind verletzt worden. Auch sie hatten zum Zeitpunkt des Bebens noch in ihren Betten gelegen, sind dann aber alle zum Unterrichtsbeginn erschienen. Bei der »Bauprüfung« stellen Alem und ich stolz und glücklich fest, dass sich unser hoher Aufwand bei der Errichtung der Schulen gelohnt hat. Stahlbeton und Eisenträger haben den Preis für die Bauarbeiten fast verdoppelt, nun aber dem Beben standgehalten. Im erdbebengefährdeten Afghanistan sind Schulen eben nicht nur durch die bildungsfeindlichen Taliban bedroht.
Wir fahren entlang des Kabul-Flusses der afghanisch-pakistanischen Grenze entgegen, der sogenannten Durand-Linie. Nach den ersten britisch-afghanischen Kriegen hat Sir Henry Mortimer Durand, Außenminister der Kolonialverwaltung Indiens, im Jahr 1893 mit einem Federstrich auf der Landkarte eine Demarkationslinie durch die Paschtunengebiete gezogen und ein Drittel afghanischen Territoriums annektiert. Er wollte aus Afghanistan eine Pufferzone machen, um so das Volk dieses Landes besser kontrollieren zu können. Mit militärischem Druck zwang er den afghanischen König, diese Grenze zumindest für hundert Jahre anzuerkennen.
1947 hat Großbritannien seine Kolonie Britisch-Indien in die Unabhängigkeit entlassen: Der Staat Pakistan wurde gegründet. Zwei Jahre später erklärte die Loya Dschirga, Afghanistans Große Ratsversammlung, die Abmachung von 1893 für nichtig, da dieser Vertrag mit den Briten und nicht mit einer pakistanischen Regierung abgeschlossen worden sei. Über Jahrzehnte hinweg blieb die völkerrechtliche Lage unklar. 1993 ist dann auch der ursprüngliche, auf hundert Jahre festgelegte Vertrag ausgelaufen. So gibt es heute eigentlich keine völkerrechtlich unumstrittene, offizielle Grenze zwischen den beiden Ländern.
Seit dem 11. September 2001 ist diese Demarkationslinie urplötzlich ins Zentrum weltpolitischer Interessen gerückt. Talibankämpfer und al-Qaida-Anhänger bewegen sich fast ungestört in beide Richtungen über die 2500 Kilometer lange Durand-Linie und finden Schutz in den gebirgigen, autonomen paschtunischen Stammesgebieten Pakistans. Für den »normalen« Ausländer und Touristen ist die Frage entscheidend, von welcher Seite er diese Grenze überschreiten möchte. Kommt er aus Pakistan, so erwartet ihn schon 70 Kilometer vor dem Übergang, am Rand der pakistanischen Grenzstadt Peschawar, ein riesiges Schild mit der Aufschrift Tribal agency, off limits to all foreigners – »Stammesgebiete, kein Zutritt für Ausländer«.
Eine Sondergenehmigung für den Aufenthalt in den autonomen Stammesgebieten, die sich tausend Kilometer entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze erstrecken, ist in diesen Zeiten nicht zu bekommen. Es herrscht Krieg in den Grenzregionen. Genau genommen lodern in dieser unwirtlichen Steinwüste derzeit mehrere Kriege: zum einen regionale Stammesfehden und zum anderen der war on terror. Daher braucht ein Ausländer, selbst wenn er lediglich eine Sondergenehmigung für die Durchreise in Richtung afghanischer Grenze beantragt, eine Unmenge Geduld. Mit Bakschisch, sonst ein gängiger Beschleuniger in der Region, hat er hier keinen Erfolg. Die staatlichen Kontrollmechanismen in Kriegszeiten sind überaus engmaschig.
Eine Sondergenehmigung kann nur die Verwaltungsbehörde der pakistanischen Zentralregierung für die Stammesgebiete ausstellen; und die ist seit dem Frühjahr 2002, als Pakistan in den »Krieg gegen den Terror« eintrat, unerbittlich streng. Ohne Wissen des Ausländers wird sein Antrag zunächst dem pakistanischen Inlandsgeheimdienst Intelligence Bureau (IB), vergleichbar dem deutschen Amt für Verfassungsschutz, zur Prüfung vorgelegt. Hat der Antrag diese Hürde genommen, geht er weiter an den für die Überwachung der Ausländer zuständigen Inter-Services Intelligence (ISI), vergleichbar dem ehemaligen Staatssicherheitsdienst der DDR. Dieser in Pakistan allmächtige Geheimdienst war es auch, der vor Jahrzehnten die Taliban ins Leben gerufen und ihre blitzartige Machtergreifung in Kabul 1994 möglich gemacht hatte. Auch nach dem Sturz der Steinzeit-Islamisten steht der ISI im Verdacht, insgeheim die radikalen Gotteskrieger weiter zu unterstützen und zu schützen.
Erst wenn beide Geheimdienste grünes Licht gegeben haben, lädt die pakistanische Staatsschutzpolizei, Special Branch, die Ausländer in Peschawar zu einem letzten Gespräch vor, das eher einem Verhör gleicht. Haben sich bei den Prüfungen Unklarheiten ergeben, oder handelt es sich bei den Ausländern um Journalisten, die womöglich kritisch über die pakistanische Politik berichten könnten, wird die Genehmigung verweigert. Wer also durch die autonomen Stammesgebiete reisen will, muss schon sehr gute Gründe und enge Beziehungen zu pakistanischen Behörden haben, um ein tribal permit zu erhalten.
Wenn der Ausländer dann nach tagelangem Warten endlich das begehrte Dokument in den Händen hält, heißt das nicht, dass er sich in den Stammesgebieten frei bewegen kann. Vielmehr wird er auf der gesamten Fahrt von schwer bewaffneten, schwarz uniformierten Grenzmilizen, den sogenannten Khyber Rifles, begleitet. Auf dem zweistündigen Weg bis zum Grenzübergang Torkham darf er sein Fahrzeug unter keinen Umständen verlassen, und seine Kamera muss im Rucksack bleiben. Um dem Reisenden schon vor Antritt der Fahrt klarzumachen, was ihn bei Zuwiderhandlungen erwartet, lässt man ihn vor der Abfahrt in Peschawar schon mal einen Blick in das zuständige Gefängnis werfen. Dort sieht er Gefangene, die, an Armen und Beinen mit Eisenketten gefesselt, oft wochenlang auf ihren Prozess warten.
Ursache für diese strengen Regelungen sind neben dem Anti-Terror-Kampf auch die immer wieder aufflackernden Stammeskriege. Seit Wochen bekämpfen sich in den tribal areas zwischen Peschawar und dem Khyber-Pass zwei einflussreiche Clans vom Stamm der Afridis. Dieser stolze Paschtunenstamm – auch »Hüter des Khyber« genannt – herrscht seit Jahrhunderten unangefochten über diese Region. Bei den blutigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Clans hat es in den vergangenen Tagen Tote und Verwundete gegeben. Der Anlass für die brutalen Gefechte, die auch mit Panzerfäusten und Maschinengewehren geführt werden, mag für westliche Gemüter eher banal wirken: Der Sohn eines Clan-Führers wurde – so vermutet es zumindest seine Familie – vom Nachbarstamm an die verhasste pakistanische Bundespolizei verraten. Denn vor mehreren Wochen haben Drogenfahnder aus Islamabad ein Heroinlabor im Gebiet der Afridis gestürmt und dabei den ältesten Sohn des besagten Clan-Führers beim »Kochen« ertappt. Nun sitzt der knapp Zwanzigährige wegen »illegalen Drogenbesitzes und -handels« im Staatsgefängnis von Lahore. Seine Familie macht dafür den mit ihr verfeindeten Nachbar-Clan verantwortlich: Der habe den Behörden einen Tipp gegeben. Das ist möglich, muss aber nicht sein, denn solche überraschenden Festnahmen ereignen sich häufig.
Der Grund dafür ist die schizophrene Drogenpolitik in diesem Land: Anbau, Besitz und Handel mit Marihuana und Opium ist offiziell auch in den Stammesgebieten verboten. Tatsächlich aber leben die Menschen dort weitgehend vom Drogenanbau und -handel. Wollten die pakistanischen Behörden dem offiziellen Recht Geltung verschaffen, müssten sie eigentlich die Hälfte der männlichen Erwachsenen und 90 Prozent der Clan-Führer einsperren. Das ist natürlich nicht ohne Krieg gegen die Stämme durchzusetzen, und deshalb verhaftet man ab und zu einen der Übeltäter, um der Öffentlichkeit die »Macht des Staates« zu demonstrieren. Der junge Afridi hat also vermutlich einfach Pech gehabt. Dass er allerdings im fünfhundert Kilometer von seiner Heimat entfernten Lahore eingekerkert wurde, ist eine bewusste Entscheidung der pakistanischen Behörden. Das eigentlich zuständige Gefängnis befindet sich in Peschawar, unweit vom Stammesgebiet der Afridis: Hätte man ihn dort eingesperrt, wäre er längst wieder auf freiem Fuß. Sein Clan hätte ihn entweder mit Drohungen und Gewalt aus dem Gefängnis geholt oder mit Bakschisch, dem gängigen Mittel der »Rechtsprechung« im Nordwesten Pakistans, freigekauft. Aber in das Gefängnis von Lahore reicht der Arm der Familie nicht. So führen jetzt also die beiden Clans einen erbitterten Rachekrieg, weil einer der Ihren womöglich von den anderen an die staatlichen Behörden verraten worden ist.
Noch irrationaler ist der zweite, der Anti-Terror-Krieg an der pakistanisch-afghanischen Grenze. Die pakistanische Regierung vermutet im Distrikt Nordwaziristan versteckte Terroristenlager. Dort lernen foreign miscreants, »ausländische Schurken«, wie sie in den einheimischen Medien genannt werden, ihr blutiges Handwerk. Auf massiven Druck der US-Regierung hat Staatspräsident Musharraf mehrere Elitebrigaden der pakistanischen Streitkräfte in diese unwirtliche Bergwüste entsandt. Das Problem ist jedoch, dass die ausländischen »Schurken« den Schutz und die Gastfreundschaft einiger Stämme genießen.
Diese Gastfreundschaft erkaufen sich die al-Qaida-nahen Ausländer aus Tschetschenien, Usbekistan und aus arabischen Staaten nicht selten durch Drogengelder, die sie beim grenzüberschreitenden Heroinhandel mit afghanischen Warlords kassieren. Und so führen dort Zehntausende pakistanischer Soldaten einen seltsamen Krieg. Als staatstreue und kampferprobte Berufssoldaten gehören sie zur stolzen und äußerst patriotischen pakistanischen Armee. Als Bürger Pakistans sind sie jetzt aber auch in Kämpfe gegen die eigene Bevölkerung, manchmal sogar gegen die eigene Familie, verwickelt und befinden sich dadurch oft in einem tiefen inneren Zwiespalt. Vor einigen Wochen hat mir ein paschtunischstämmiger Bataillonskommandeur anvertraut, dass aus seinem Verband mehr als fünfzig Soldaten desertiert und zum »Feind« übergelaufen seien. Sie hätten es nicht ertragen, gegen ihre paschtunischen Glaubensbrüder zu kämpfen. Die Regierung weiß um diesen Gewissenskonflikt und setzt daher in dem Krieg bevorzugt Regimenter aus Punjab und Sind ein.
Aber auch das bringt Probleme mit sich: Die Soldaten aus dem Osten verstehen meist nicht die Sprache der Menschen im Nordwesten. Die Bauern sprechen hier nämlich ausschließlich Paschtu, ihre Stammessprache. Nur wenige Bewohner der Stammesgebiete haben eine öffentliche Schule besucht, an der sie die Nationalsprache Urdu hätten lernen können. Solche staatlichen Schulen fehlen nämlich zu Tausenden in diesem Armenhaus Pakistans. Die Soldaten aus dem Osten beherrschen zwar Urdu und Punjabi, aber eben kein Paschtu. So ist dieser Krieg, der sich eigentlich gegen die ausländischen Terroristen richten sollte, auch ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung geworden. Ein Krieg aus Sprachlosigkeit. Und wo Menschen sich nicht miteinander verständigen können, übernehmen rasch die Waffen das Wort.
Das ist in groben Zügen die für den Ausländer kaum verständliche politische Situation jenseits der Grenze, der wir uns nun langsam nähern. Während der Fahrt hat Alem pausenlos telefoniert und nur niederschmetternde Nachrichten über die Lage in Pakistan erhalten. Es wird von unzähligen Toten im Erdbebenzentrum nördlich der Hauptstadt Islamabad berichtet. Auch in einer vornehmen Wohnsiedlung der Metropole selbst sollen Hochhäuser eingestürzt sein und Dutzende unter sich begraben haben. Uns sitzt der Schreck noch in den Knochen, und Sigrid und Walter beschließen mit Rücksicht auf ihre Familie, von Peschawar aus schnellstmöglich zurück nach Deutschland zu fliegen. Sie wären ohnehin nur noch wenige Tage in Afghanistan geblieben. Auf den letzten Kilometern geht es steil bergauf, vor uns stauen sich Kolonnen von Lastautos. Im Schritttempo erreichen wir Torkham.
Torkham ist einer der beiden bedeutenden Grenzübergänge zwischen Afghanistan und Pakistan. Er verbindet den Norden Pakistans mit Jalalabad, wo einstmals Osama Bin Laden »residierte«. Von dort gelangt man auf einer gut ausgebauten Teerstraße in drei Stunden nach Kabul. Shaman, der tausend Kilometer weiter im Süden gelegene zweite wichtige Grenzübergang, verbindet den Süden Pakistans mit Kandahar, der ehemaligen Hauptstadt der Taliban, die jetzt wieder zu ihrer Hochburg zu werden droht.
Zwischen diesen beiden Grenzübergängen verlaufen – wie schon während des Krieges gegen die sowjetischen Besatzer – die logistischen Wege der Dschihadis, der »Heiligen Krieger«. Vor dreißig Jahren bewegten sich hier die Mudschaheddin, heute sind es die Taliban. Damals waren die beiden Grenzübergänge geschlossen; die Transporte mussten mühsam mit Pferden über die Berge organisiert werden. Heute sind die Übergänge offen. Hunderte Lastautos und Traktoren und Tausende Menschen nutzen sie täglich. Wenn man also den Nachschub für die Taliban aus Pakistan unterbinden oder zumindest erschweren will, sind strenge Grenzkontrollen für Personen und Güter eigentlich unerlässlich.
Der zu Zeiten des Talibanregimes (1996 bis 2001) noch mittelalterlich anmutende afghanische Grenzübergang bei Torkham wurde in den vergangenen Jahren auch mit deutscher Hilfe zu einem modernen Komplex ausgebaut. Wir betreten ein zweistöckiges, helles Betongebäude. Die Gänge riechen nach frischer Farbe, Böden und Wände sind blitzblank. Die Ausreiseformalitäten im Passamt für Ausländer verlaufen freundlich-korrekt und zunächst auch recht zügig. Der Grenzer trägt gerade unsere Daten aus den Pässen in ein dickes Buch mit der Aufschrift Foreigner ein, als aus dem Nebenraum ein hochgewachsener Fünfzigjähriger mit buschigem Schnurrbart an die Holzschranke tritt. Die Uniformierten im Raum springen von ihren Holzstühlen auf und salutieren dem Zivilisten im blütenweißen Shalwar-Kamez mit schwarzer Weste. Wortlos nimmt dieser dem Unteroffizier die Dokumente aus der Hand und wirft zunächst einen kritischen Blick auf unsere afghanischen Begleiter. Dann erst schlägt er mit einer arroganten Geste unsere Pässe auf. Sein Aussehen und Gehabe sind mir unangenehm vertraut: afghanische Geheimpolizei. Die Nachfolgeorganisation des unter der Sowjetherrschaft allmächtigen und wegen seiner Grausamkeit berüchtigten Geheimdienstes KHAD genießt auch heute keinen guten Ruf. Die Stimmung im Raum ist eisig. Ich fürchte schon, dass es mit einer zügigen Abfertigung nun nichts mehr werden wird, als sich der Gesichtsausdruck des »Geheimen« plötzlich verändert. Sein Schnauzbart hebt sich, die schmalen Augenschlitze öffnen sich, er streckt mir die Hand entgegen und grüßt strahlend und in dezentem Sächsisch: »Gudn Daach, Sie sind Deudsche? Wie gähd’s Ihn’n?«
Ich atme tief durch. Gleichzeitig erleichtert und verwirrt über den unerwarteten Stimmungswechsel und seinen Akzent, drücke ich die angebotene Hand: »Weshalb sprechen Sie so gut Deutsch?« Wohlweislich verkneife ich mir ein Kompliment zu seinem »Sächsisch«. Er tut, als hätte er meine Frage nicht gehört, und bittet mich, nur mich, in sein Zimmer. Dieses ist doppelt so groß wie das offizielle Passbüro und mit Plüschsofa, breiten Polstersesseln, einem eleganten Schreibtisch und kunstledernem Chefsessel fast »westlich« ausgestattet. Doch auf einem Tischchen in der Ecke – ich traue meinen Augen kaum – steht ein kleiner Stander: Schwarz-Rot-Gold mit Ährenkranz, Hammer und Zirkel! Ein afghanischer Geheimpolizist mit Hang zu deutscher Ostalgie?
Mein verblüffter Blick auf die »DDR-Devotionalie« entgeht ihm nicht. Er bittet mich, Platz zu nehmen, und beginnt zu erzählen. Mehr als eine Stunde lang lausche ich der unglaublichen, irrsinnig spannenden Vita eines afghanischen »Grenzgängers«.
Lieber Doktor Erös, Ihr Name ist hier in der Provinz und mir persönlich bestens bekannt, und Ihre »Kinderhilfe Afghanistan« hat einen guten Namen. Ich kenne die Schulen, insbesondere die Mädchenoberschulen und die modernen Computerklassen, für die Sie in den vergangenen Jahren hier in den Ostprovinzen Gebäude errichtet haben. Sie leisten damit einen großartigen Beitrag zum Wiederaufbau unseres Landes zu einem modernen Staat. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Natürlich habe ich Ihren erstaunten Blick bemerkt, als ich Sie vorhin auf Deutsch angesprochen habe, und ich sehe auch, dass Sie sich über die kleine DDR-Flagge hinter mir wundern. Da ich Sie sehr schätze und wir beide in den kommenden Monaten und hoffentlich Jahren wohl noch öfter miteinander zu tun haben werden, werde ich Ihnen nun erzählen, woher meine Deutschkenntnisse kommen und aus welchem Grund die Flagge hier steht.
Ich entstamme einer alten paschtunischen Offiziersfamilie. Mein Großvater und mein Vater dienten als »königliche Aafsari« (Polizeioffiziere) unter unserem letzten Monarchen Zahir Shah (afghanischer König von 1933 bis 1973). Anfang der sechziger Jahre, als ich gerade eingeschult worden war, kamen deutsche Polizisten nach Kabul. Wegen guter Leistungen wurde mein Vater ausgewählt, an einer Sonderausbildung durch diese Deutschen teilzunehmen. Er war begeistert und schwärmte daheim von den deutschen Polizisten, ihrer Ehrlichkeit und Disziplin – Eigenschaften, die bei der afghanischen Polizei damals nicht überall verbreitet waren. Abends brachte er sie häufig mit nach Hause, wo sie uns sechs Kindern von ihrer Heimat und ihren Familien erzählten und Bilder aus Deutschland zeigten.
Deutschland wurde das »Land meiner Träume«, und schon damals wollte ich es unbedingt einmal besuchen. Mein Vater ist nach der privilegierten »deutschen« Ausbildung sehr rasch zum Polizeichef von Nangahar befördert worden. Die Familie zog von Kabul nach Jalalabad, der Hauptstadt der paschtunischen Ostprovinz. Dort wohnten wir in einem palastartigen Haus mit riesigem Garten direkt neben der Winterresidenz unseres Königs. Diese Jahre waren vor allem für uns Kinder eine wunderbare Zeit: Unser Vater war eine hoch geachtete Persönlichkeit, meine ältere Schwester heiratete den Sohn des Bürgermeisters, die drei jüngeren Schwestern gingen auf die Allaei-Mädchenoberschule, die Sie, lieber Doktor Erös, vor wenigen Jahre wieder aufgebaut haben. Ajmal, der ältere von uns zwei Brüdern, trat nach dem Abitur als Erster in die Fußstapfen des Vaters und wurde ebenfalls Polizist. 1973 veränderte sich dann unsere bis dahin »heile Welt«: Der König wurde durch einen Putsch gestürzt, und kurz darauf übernahmen die Kalqis – die Kommunisten – die Macht.
Mein Vater, ein überzeugter Monarchist, musste den Dienst quittieren. Als 1979 sowjetische Truppen ins Land kamen, kehrte auch mein Bruder Ajmal der Polizei den Rücken und verließ seine Familie. Er schloss sich den Mudschaheddin an und ging in die Berge, um gegen die Sowjets und die Kabuler Kommunisten zu kämpfen. Ich selbst war hin und her gerissen: Schließlich entstammte ich einer konservativen, wohlhabenden Offiziersfamilie, mein verehrter Vater war ein überzeugter Anhänger der Monarchie und ein tiefgläubiger Moslem, meine fürsorgliche Mutter die Tochter eines reichen Großgrundbesitzers, mein Bruder ein patriotischer Widerstandskämpfer! Das war die eine Welt, die Welt meiner Kindheit, in der ich mich sehr geborgen fühlte. Doch daneben gab es die Welt meiner Freunde, Lehrer und Mitschüler, in der ich die Zukunft Afghanistans sah.
Schon vor dem Einmarsch der Russen sympathisierten an meiner Schule einige Lehrer und Schüler mit sozialistischen Ideen. Ihre Ideale von einer »besseren Welt« begeisterten zunehmend auch mich. Mit dem Aufbau des Sozialismus, so hofften wir, würden technischer Fortschritt, Gerechtigkeit und Gleichheit unser Land verändern. Die Macht gieriger Großgrundbesitzer würde gebrochen werden, und dem Einfluss dummer Mullahs würde man einen Riegel vorschieben. Im Alter von achtzehn Jahren traf ich eine folgenschwere Entscheidung und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei. Ein Jahr später trat ich als Offiziersanwärter in den Polizeidienst. Für meinen Vater war dieser Entschluss ein schwerer Schlag. Mit meiner Mutter und meinen Schwestern ging er ins Exil nach Pakistan. Erst achtzehn Jahre später sollte ich sie wiedersehen.
Als Jahrgangsbester meiner Offiziersklasse schickte mich die Demokratische Republik Afghanistan 1984 in die Deutsche Demokratische Republik. Auf einem Speziallehrgang in Leipzig wurde ich von der Staatssicherheit der DDR zum Geheimdienstpolizisten ausgebildet. Endlich war ich im Land meiner Träume angekommen! Von der BRD, dem anderen Deutschland, wussten wir nur, dass es ein amerikanischer Vasallenstaat sei, in dem – wie früher in Afghanistan – die Armen von der Kapitalistenklasse ausgebeutet würden. Schon in der Schule hatte sich meine Sprachbegabung bemerkbar gemacht, und so lernte ich nun schnell Deutsch. Ich war begeistert von der Kameradschaft und Kompetenz meiner deutschen Ausbilder, der Disziplin, Sauberkeit und Ordnung überall auf den Straßen und fasziniert von der Kultur, dem Reichtum und den Segnungen der modernen Technik. So verbrachte ich drei wunderbare Jahre in dieser für mich neuen Welt.
Nach dem Dienst und der – besonders für mich als Ausländer – sehr anstrengenden täglichen Ausbildung zeigten mir meine deutschen Kollegen das Leipziger Nachtleben. Ich tanzte – in Afghanistan undenkbar – in der Öffentlichkeit mit fremden Frauen und trank zum ersten Mal in meinem Leben Bier und Wein. Als Moslem hatte ich dabei anfangs ein schlechtes Gewissen, doch mit der Zeit kam ich immer mehr auf den Geschmack! Dann verliebte ich mich auch noch in eine deutsche Kollegin aus meiner Klasse und wäre sehr gern für immer in Leipzig geblieben. Mit einem überdurchschnittlichen Abschluss kehrte ich als Liebhaber Deutschlands und nunmehr vollends überzeugter Sozialist in meine Heimat zurück. Deutschland war für mich identisch mit Sozialismus.
Es war die Rückkehr aus einem Paradies in die Vorhölle. Ganz Afghanistan befand sich Mitte der achtziger Jahre in einem grausamen Guerillakrieg. Auf beiden Seiten der Front waren mittlerweile Nachbarn und Freunde aus meiner Schulzeit ums Leben gekommen. Die täglichen Fahrten durch Kabul zu meinem Dienstort am Pul-E-Charki-Gefängnis führten an den großen Moscheen vorbei. Vor ihren Toren sah ich junge Männer in verdreckter Kleidung an Krücken humpelnd, beidbeinig Amputierte in primitiven Rollstühlen, Blinde, die von Kindern an der Hand geführt wurden. Und diese jungen Männer bettelten am Eingang der Moscheen in aller Öffentlichkeit. Ich war empört und schämte mich als Polizist und Afghane vor allem vor den ausländischen Gästen, den russischen Offiziersfamilien und den Lehrern, Ärzten und Entwicklungshelfern aus der DDR, die damals zu Tausenden in Kabul lebten.
Wie schon zur Zeit meines Vaters und des Königs beschleunigte auch im sozialistischen Afghanistan eine »deutsche Ausbildung« die Karriere. Ich stieg rasch auf, und schließlich war ich der jüngste afghanische Polizeigeneral. Mit »meinem« Afghanistan allerdings ging es im gleichen Tempo bergab. Der Rückzug der sowjetischen Truppen im Februar 1989 läutete das Ende des afghanischen Sozialismus ein, und als die Mudschaheddin im April 1992 den Präsidenten Dr. Najibullah stürzten, war meine Karriere zu Ende und mein Traum von Sozialismus, Demokratie und Fortschritt in meinem Heimatland zerstört. Ein Traum, der in Deutschland begonnen hatte. Die Kontakte zu meinen Kollegen von der Staatssicherheit in Leipzig waren auch nach meiner Rückkehr nach Kabul nie abgerissen. Sie überdauerten die »beiden Wenden« in beiden Ländern.
Auf Umwegen gelangte ich 1994 wieder nach Leipzig. Die Staatssicherheit gab es nicht mehr; die »Seilschaften« aber, auch mit Ehemaligen aus dem einstigen sozialistischen Ausland, hielten. Einer meiner Lehrer aus der DDR-Polizeischule leitete inzwischen einen privaten Sicherheitsdienst, ein Gewerbe, das zu Zeiten des Sozialismus unvorstellbar und überflüssig gewesen war. Nicht zuletzt wegen meiner Sprachkenntnisse – neben Deutsch spreche ich natürlich auch meine Muttersprachen Paschtu und Farsi, das pakistanische Urdu, etwas Russisch und recht passabel Arabisch – erhielt ich von ihm eine interessante und gut bezahlte Stellung. Rasch lebte ich mich in dem für mich neuen »kapitalistischen« Deutschland ein. Geheimdienstler – auch ehemalige – sind überaus »anpassungsfähig«.
Nach dem Sturz Najibullahs und dem Ende der Demokratischen Republik Afghanistan hatten Horden marodierender Mudschaheddin das Land geplündert und wie im Dreißigjährigen Krieg gewütet. Morde, Brandschatzungen und Vergewaltigungen prägten das Leben besonders im Süden, im Osten und auch in Kabul. Die nach dem Sturz des gemeinsamen Feindes wieder völlig zerstrittenen Mudschaheddin-Gruppen waren es, die das bis 1992 unversehrte Kabul durch monatelangen Artillerie- und Raketenbeschuss zur Hälfte dem Erdboden gleichmachten.
Im Sommer 1994 erschienen die Taliban auf der Bildfläche. Was weder den Kommunisten noch den Mudschaheddin in einem fünfzehn Jahre währenden Bürgerkrieg gelungen war, schafften diese Koranschüler in wenigen Monaten. In einem »Blitzkrieg« eroberten sie – bis auf wenige Distrikte im Norden – das gesamte Land und riefen im September 1996 das »Islamische Emirat Afghanistan« aus, einen Gottesstaat von arabisch-wahhabitischer* Prägung. In meiner Heimat herrschten jetzt »Recht und Ordnung« eines primitiven, menschenverachtenden Regimes von ungebildeten, zivilisationsfeindlichen Mullahs. Den »freien Westen«, einschließlich Deutschland, hat das wenig interessiert. Die sowjetischen Truppen waren aus Afghanistan vertrieben worden, und wenige Jahre später war das »Reich des Bösen« vollends kollabiert. Sowjetunion und Warschauer Pakt existierten nicht mehr. Die Karawane der Weltpolitik zog weiter, und niemand kümmerte sich mehr um das Schicksal Afghanistans.
Aus Pakistan erreichte mich ein erstes Lebenszeichen meiner Familie. In einem herzzerreißenden Brief verzieh mir mein Vater und flehte mich an, zur Familie zurückzukehren: Ich sei nunmehr der einzige Sohn, denn mein älterer Bruder Ajmal sei gegen Ende des Dschihad gegen die Russen gefallen. Auch meine Mutter und Schwestern würden mich sehr vermissen. Eine Rückkehr nach Afghanistan sei unmöglich, denn das Terrorregime der Taliban sei noch schlimmer als die Kommunisten. Er selbst sei schwer krank und benötige dringend meine Hilfe. Da ich bei meiner Arbeit in Leipzig gut verdiente, konnte ich die Kosten für die Behandlung meines Vaters in einer Privatklinik in Islamabad problemlos übernehmen. Im Spätsommer 2001 reiste ich dann nach Pakistan, um meine Familie wiederzusehen.
Am 11. September, dem Tag meiner Rückkehr nach Deutschland, explodierte die Welt. Wenige Wochen später bombardierten Kampfflugzeuge der USA die Steinzeit-Islamisten in meinem Heimatland. Im Herbst 2001 kehrte das kleine, wirtschaftlich unbedeutende Afghanistan zurück auf die Bühne der Weltpolitik. Und Deutschland, inzwischen meine zweite Heimat, wurde zum politischen Motor des Wiederaufbaus. Ich wollte daran mitwirken und meine Fähigkeiten einbringen, die ich in der DDR und in der Bundesrepublik erlernt hatte. Mit Unterstützung meines Vaters, des von den Kommunisten entlassenen königlichen Polizeigenerals, wurde ich, der Ex-Kommunist, im Sommer 2002 als Polizeioffizier in Kabul reaktiviert. Meine politische Vergangenheit kam nie zur Sprache, und ich bin glücklich, dass ich jetzt in dieser Provinz, in der ich meine Jugend verbracht habe, arbeiten und mit meiner Familie leben kann. Morgen kommen übrigens deutsche Polizisten hierher in meine Dienststelle. Sie werden einige meiner jungen Kollegen auswählen und sie an der von euch Deutschen wiederaufgebauten Polizeiakademie in Kabul ausbilden. Wir Afghanen kommen einfach nicht los von Deutschland. Und das ist gut so.
Ich fühle mich erschlagen von dieser Lektion in Afghanistans jüngster Geschichte und bin fasziniert vom Schicksal dieses paschtunischen »Wanderers zwischen den Welten«. Trotz Dutzender Fragen, die mir auf den Nägeln brennen, muss ich mich verabschieden, denn die Zeit drängt. Mit dem Versprechen, uns bald wiederzusehen, umarmen wir einander: Ba mane choda – »Gott schütze uns«.
Um die Grenze zu überschreiten, müssen wir unseren Pickup zurücklassen. Wie die meisten Lkws darf er die Grenze nicht passieren. Da wir den Oldtimer sowieso nur in Afghanistan benötigen, verabschieden wir uns von unserem Fahrer Rohullah und gehen mit unserem Gepäck zu Fuß durch das meterhohe, grün gestrichene Stahltor. Auf der pakistanischen Seite wollen wir dann mit einem Minibustaxi den Weg nach Peschawar fortsetzen.
Die Laxheit der pakistanischen Grenzkontrollen erstaunt mich. Die Fahrer legen den Beamten zwar die Zolldokumente vor, zwischen denen ab und an auch ein Geldschein zu sehen ist; doch nur bei jedem zehnten Fahrzeug werfen die Uniformierten einen ernsthaften Blick auf die Ladefläche. Martialische Gesten und scharfe Worte ersetzen korrekte Überprüfungen. Tonnenweise könnten so tagtäglich Sprengstoff, Waffen und Munition auf Lastautos nach Afghanistan eingeführt werden. Auch wir werden beim Grenzübertritt von keinem pakistanischen Polizisten angehalten oder kontrolliert. Die Uniformierten zeigen nicht das geringste Interesse an unseren Taschen und Koffern. Wir könnten kiloweise Opium mit uns führen, ohne dass dies irgendjemandem auffallen würde. Uns soll es heute recht sein, denn wir wollen spätestens am Abend in Peschawar sein und müssen möglichst zügig weiter. Obwohl uns niemand kontrollieren möchte, müssen wir hier an der Grenzstation Torkham ins pakistanische Zollamt, um eine Einreisebestätigung in unsere Pässe eintragen zu lassen. Andernfalls bekämen wir bei der Rückreise von Pakistan nach Deutschland Probleme.
Das pakistanische Grenzgebäude ist – ganz anders als das afghanische – ein armseliges, halb zerfallenes Lehmziegelhäuschen, etwa fünfzig Meter oberhalb der Straße an einem Hang gelegen. Bei unserer Ankunft ist es menschenleer. Die Beamten sind beim Mittagsgebet, und danach gehen sie erst einmal mittagessen. Wir müssen also warten. Alem nutzt die Zeit, um mit unseren Freunden im Reisebüro in Peschawar zu telefonieren: »Wenn ihr vor achtzehn Uhr hier ankommt«, so die Auskunft, »können Walter und Sigrid ihre inzwischen unbürokratisch auf den nächsten Tag umgeschriebenen Flugtickets abholen.« In all den Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Servicegedanke bei Unternehmen in weniger hoch zivilisierten Ländern oft wesentlich entwickelter ist als in Deutschland.
Während Alem sich zu den ihm bestens bekannten Grenzbeamten gesellt, mit ihnen betet und zu Mittag isst, beobachten wir das bunte, chaotische Bild, das sich auf der pakistanischen Seite bietet. Auf der mit Schlaglöchern übersäten Grenzstraße stauen sich unzählige Corollas, bunt bemalte Busse und überladene, altersschwache Lkws, die Stahlträger aus Islamabad, Zementsäcke aus Kohat und Lehmziegel aus Peschawar transportieren. Hier und da warten Konvois moderner, leuchtend weiß gestrichener UN-Lastautos, die seit Wochen Tausende Tonnen Weizenmehl nach Afghanistan befördern. Dazwischen drängen Kolonnen von Diesel- und Benzintransportern aus Karachi ungeduldig hupend auf eine bevorzugte Abfertigung. Sie liefern nämlich den Treibstoff für die US-Truppen, deren Hauptquartier sich im unweit von Kabul gelegenen Baghram befindet. Die Fahrer dieser Benzintransporter werden gesondert überprüft, bevor sie den westlichen Truppen diesen »Lebenssaft« für den »Kampf gegen den Terror« bringen »dürfen«. Ihre Touren sind lebensgefährlich: Auf ihrem Weg durch die Stammesgebiete zur afghanischen Grenze und auch innerhalb Afghanistans werden regelmäßig Terroranschläge auf diese Benzintransporter verübt. Daher ist ihre Bezahlung überdurchschnittlich. Für eine viertägige Fahrt von Karachi nach Baghram erhalten sie 100 US-Dollar; das ist mehr, als ein normaler pakistanischer Lastwagenfahrer in einem Monat verdienen kann. Die Dollars erhalten sie allerdings nur, wenn das Fahrzeug auch tatsächlich seinen Bestimmungsort erreicht hat. Hier könnten mutige Regisseure ein wirklichkeitsnahes Remake von Filmen aus meiner Jugendzeit drehen: »Einer kam durch« und »Lohn der Angst« auf Afghanisch.
Ganz am Ende der kilometerlangen Schlange tuckern altersschwache, mit Hausrat beladene Traktoren. Sie befördern afghanische Flüchtlingsfamilien zurück in ihre Heimat, die die meisten von ihnen seit Jahrzehnten nicht mehr betreten haben und kaum mehr wiedererkennen werden. Die Kinder auf der Ladefläche waren noch nie im Land ihrer Vorfahren. Seit dem Sturz der Taliban ist die pakistanische Regierung dabei, mit Zustimmung der UNO alle afghanischen Flüchtlingslager aus den achtziger Jahren zu schließen. So werden die Menschen mit ihren wenigen Habseligkeiten und einem Handgeld von 100 US-Dollar, ausbezahlt vom UNHCR, dem Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, zurück nach Afghanistan geschickt. Daher liegt in ihren Gesichtern keine freudige Erregung über die Rückkehr in die Heimat. Vielmehr blicken sie ängstlich, hilflos und besorgt in eine unsichere Zukunft.
Inmitten des chaotischen Treibens wuseln Hunderte von Kindern umher. Mit ihren hölzernen Schubkarren verdingen sie sich als Gepäckträger. Barfüßige Zehnjährige, Jungen und Mädchen, schieben zentnerschwere Koffer und Kisten wohlhabender Reisender kilometerweit in beide Richtungen, um sich ein paar Cents pro Tag zu verdienen. Da es in der Nacht zuvor heftig geregnet hat, stapfen sie keuchend durch knöcheltiefe Pfützen. Trotz ihrer anstrengenden Kinderarbeit scheinen sie guter Dinge zu sein. Mit den 80 Rupien (ungefähr ein Euro), die sie an einem solchen Tag verdienen, können sie ihre oft vaterlosen Familien ernähren. Für einen Schulbesuch reicht natürlich weder die Zeit noch das Geld.
Nach zwei Stunden kurzweiligen Wartens öffnet sich jetzt die Tür zum Zollhäuschen. Wir Deutschen wollen uns gerade vor dem Eingang mit dem Türschild Incoming am Ende der Schlange von über hundert Pakistani und Afghanen einordnen, da bittet uns ein älterer Beamter mit einem freundlichen »Please, come with me« nach vorn. Das hätten Sigrid und Walter in dieser streng islamischen und angeblich so »antiwestlichen« Welt nicht für möglich gehalten: Der Nichtmoslem und Ausländer hat den Vortritt! Die Gastfreundschaft der Paschtunen bewährt sich eben auch in schwierigen Zeiten. Dagegen wird es wohl noch eine Weile dauern, bis Ausländer, insbesondere Moslems, von den Passkontrollstellen in Deutschland bevorzugt behandelt werden.
Bei einem Glas Tee – auch das gehört zum gastlichen Service gegenüber Fremden – spricht uns der Zollbeamte auf das schreckliche Erdbeben an. Er wirkt ernsthaft besorgt um unser Wohlergehen und rät uns dringend, sein Land so schnell wie möglich zu verlassen. »Wir wollen nicht, dass auch noch Deutsche zu Schaden kommen«, erklärt er zum Abschied.
Noch vor Sonnenuntergang erreichen wir Peschawar, die pakistanische Paschtunenstadt am Fuß des Khyber-Passes.