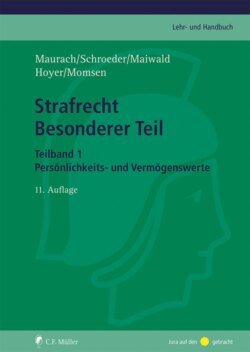Читать книгу Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1 - Reinhart Maurach - Страница 88
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A. Geschichte – Allgemeines
Оглавление3
Die Aussetzung ist ein im Strafrecht noch sehr junger Tatbestand. Dem römischen und germanischen Recht unbekannt, im älteren deutschen Recht nur selten erwähnt, findet die Aussetzung unter dem Einfluss des kirchlichen Rechts Eingang in die Reichsgesetzgebung des 16. Jahrhunderts. In Art. 132 PGO wird das „Von-sich-Legen“ von Kindern durch deren Mutter bestraft, woran sich die stark umstrittene Frage knüpfte, ob es sich um eine Straftat gegen das Leben, gegen die mütterliche Fürsorgepflicht – so ständig die gemeinrechtliche Wissenschaft – oder um ein Delikt gegen den Personenstand handelte. Das Preuß. ALR versucht in II, 20 §§ 969, 971 zu kombinieren: einerseits ist die Aussetzung als Delikt wider das Leben konstruiert, andererseits ist aber – Nachwirkung des Gedankens der Familienfürsorge – nur die Mutter taugliche Täterin. Den ersten entschlossenen Schritt von der „Weglegung“ zur „Aussetzung“ geht das bayer. StGB 1813 in Art. 174: Täter der Aussetzung kann jedermann, Objekt der Aussetzung jeder Hilflose sein. Dem schließt sich das Partikularrecht des 19. Jahrhunderts überwiegend an. § 183 preuß. StGB 1851 und ihm folgend § 221 StGB 1871 sahen die „Aussetzung“ hilfloser Personen oder deren Verlassen in hilfloser Lage vor. Die Neufassung durch das 6. StrRG 1998 beruht auf § 139 E 1962.
4
Die Neufassung hat allerdings nicht alle Probleme beseitigt, sondern einige neue geschaffen, wobei eine überkritische Wissenschaft allerdings die Problematisierung etwas übertrieben hat. Die Neufassung hat mit der Ersetzung der Worte „aussetzen“ und „in hilfloser Lage verlassen“ durch „in eine hilflose Lage versetzen“ und „in einer hilflosen Lage im Stich lassen“ auf das bisher nach dem Wortlaut erforderliche Element der räumlichen Entfernung des Opfers vom Täter und umgekehrt verzichtet, damit allerdings zugleich die Überschrift „Aussetzung“ obsolet gemacht.
5
§ 221 unterscheidet zwischen dem Versetzen in eine hilflose Lage (Abs. 1 Nr. 1) und dem Im-Stich-Lassen in einer hilflosen Lage (Abs. 1 Nr. 2). Im ersten Fall führt der Täter also die hilflose Lage herbei, im zweiten liegt sie bereits vor. Der Kernbegriff ist also die hilflose Lage. Dass sich die hilflose Lage selbst bereits durch eine konkrete Gefährdung auszeichent, ist wegen des konkreten Gefährdungserfordernisses (u. Rn. 13) nicht mehr erforderlich. Lediglich zur Wahrung der Zweigliedrigkeit des § 221 StGB (s.o. Rn. 2) ist für sie ein gewisses Maß an weitergehenden Voraussetzungen erforderlich. Eine hilflose Lage liegt danach vor, wenn das Opfer sich wegen physischer oder psychischer Mängel oder mangels der erforderlichen Hilfspersonen oder -mittel nicht mehr gegen mögliche Gefahren für Leben oder Leib zur Wehr setzen könnte[3]. Eine Lage setzt eine gewisse Dauer voraus[4].