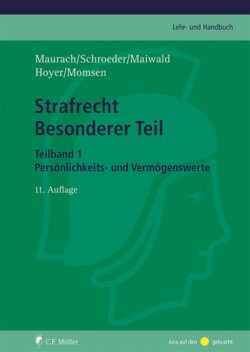Читать книгу Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1 - Reinhart Maurach - Страница 27
IV. Die Unverzichtbarkeit des Lebensschutzes
ОглавлениеSchrifttum:
Chatzikostas, Die Disponibilität des Rechtsgutes Leben in ihrer Bedeutung für die Probleme von Suizid und Euthanasie, 2001; Hirsch, Einwilligung und Selbstbestimmung, FS Welzel 1974, 757; v. Hirsch/Neumann, „Indirekter“ Paternalismus im Strafrecht am Beispiel der Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB), GA 07, 671; Hoerster, Rechtsethische Überlegungen zur Freigabe der Sterbehilfe, NJW 86, 1786; Jakobs, Tötung auf Verlangen, Euthanasie und Strafrechtsreform (Sitzungsber. Bayer. Ak. d. Wiss.), 1998; Kargl, Aktive Sterbehilfe im Zugriff der volkspädagogischen Deutung des § 216 StGB, in: Inst. f. Kriminalwiss. u. Rechtsphilos. Frankfurt a.M. (Hrsg.), Jenseits des rechtsstaatl. Strafrechts, 2007, 379; Merkel, Teilnahme am Suizid – Tötung auf Verlangen – Euthanasie, in: Zur Debatte über Euthanasie, hrsg. von Hegselmann und Merkel, 1991, 71; Roxin, Die Abgrenzung von strafloser Suizidteilnahme, strafbarem Tötungsdelikt und gerechtfertigter Euthanasie, 140 Jahre GA, 1993, 177; Schroeder, Beihilfe zum Selbstmord und Tötung auf Verlangen, ZStW 106, 565; Schroeder, Zur Legitimation des § 216 StGB, FS Deutsch 09, 505; Tenthoff, Die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen im Lichte des Autonomieprinzips, 2008; Vöhringer, Tötung auf Verlangen, 2008.
14
Das Recht auf Leben ist nach Art. 1 Abs. 2 GG „unveräußerlich“, d.h. unverzichtbar[30]. Aus der Unverzichtbarkeit des menschlichen Lebens folgt die Unerheblichkeit der Einwilligung in die Tötung. Dies ergibt sich insbesondere aus § 216, wonach sogar die Tötung auf Verlangen des Opfers unter – freilich gemilderter – Strafe steht (näher u. § 2 IV B).
15
Die Unverzichtbarkeit des menschlichen Lebens wird neuerdings unter dem Einfluss liberalistischen Denkens zunehmend infrage gestellt. Dabei wird § 216 StGB als eine Vermutung der Einwilligungsunfähigkeit (Schmitt FS Maurach 1972, 118), eine Verdachtsstrafe für eine unbeweisbare Einwilligung[31], als „paternalistisch“[32] gedeutet oder als Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (Krack KJ 95, 60) oder als rational überhaupt nicht begründbar angesehen[33] und dementsprechend seine Abschaffung oder Einschränkung gefordert. Hiergegen Engisch (FS H. Mayer 411 ff.), Hirsch[34] und Otto (FS Tröndle 1989, 158 f.) wegen der Aufrechterhaltung des Tötungstabus, Jakobs aaO wegen der Sicherung der „Vollzugsreife“ des Todeswunsches, Schroeder[35] wegen der Nichtabwälzbarkeit des Vollzugs der Selbsttötung und des Handlungsunwerts, Hoerster (NJW 86, 1789) wegen der Irreversibilität, Roxin (140 Jahre GA 184) wegen des Nachweises der Autonomie des Sterbewilligen[36]. Häufig wird § 216 StGB mit einem Bündel von Argumenten gerechtfertigt[37]. Zahlreiche Vorschläge zur Einschränkung des § 216 gibt es im Rahmen der Euthanasie (u. Rn. 30). Schon de lege lata will Jakobs bei „akzeptablen Gründen“ § 216 entfallen lassen[38].
Allerdings ist in Extremfällen eine Rechtfertigung nach § 34 StGB möglich (s.u. Rn. 34). Diese hier schon seit der 6. Aufl. 1977 vertretene Auffassung wird heute unglücklich als „Rechtfertigungslösung bei der aktiven Sterbehilfe“ bezeichnet[39]. Echte „Sterbehilfe“ als Erleichterung des Sterbens bedarf auch bei aktivem Handeln keiner Rechtfertigung (s.u. Rn. 32). Verzichten kann der Lebensmüde auch auf die Lebensrettung durch einen Dritten, da bei diesem keine Tatherrschaft vorliegt (s.u. Rn. 24, § 2 Rn. 60) und im Übrigen der Lebensmüde Behandlungen gegen seinen Willen verweigern kann.