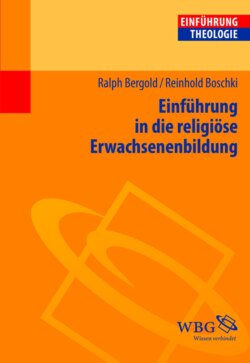Читать книгу Einführung in die religiöse Erwachsenenbildung - Reinhold Boschki - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. TEIL: ERWACHSENE IM KONTEXT UNSERER ZEIT 1.1 Was heißt „erwachsen“? DYNAMISIERTER ERWACHSENENBEGRIFF
ОглавлениеEine religiöse Bildungsarbeit mit Erwachsenen muss sich der Frage stellen, was mit den Termini „Erwachsene“ und „erwachsen“ eigentlich gemeint ist. Rudolf Englert fordert, dass eine heutige religiöse Erwachsenenbildung „etwas von ihren Teilnehmer/innen verstehen“ muss (Englert 2002b, S. 157). Im Zentrum religiöser Bildungsvorgänge stehen also nicht allein die Inhalte, die auf irgendeine Weise an möglichst viele „Erwachsene“ weitergegeben, vermittelt werden sollen – im Sinne reiner Vermittlungshermeneutik bzw. Vermittlungsdidaktik. In erster Linie und an zentraler Stelle stehen die Menschen selbst, die Teilnehmenden, die Erwachsenen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen und Motiven zu einer Bildungsveranstaltung angemeldet haben. Ihre Motive zu ergründen, ihren Fragen, die sie mitbringen, strukturelle Aufmerksamkeit zu schenken, ihren biografischen, sozialen, familiären, beruflichen und lebensweltlichen Bedingungen Raum zu geben, ist wesentliche Aufgabe der Veranstaltenden und Leitenden erwachsenenbildnerischer Maßnahmen. Deshalb muss sich eine Theorie religiöser Erwachsenenbildung bereits im Vorfeld den gesellschaftlichen und individuellen Kontexten von Bildung zuwenden.
Für eine religionspädagogische Betrachtung der Zielgruppe religiöser Bildungsprozesse ist eine Unterscheidung zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen wesentlich. Inwiefern kann man von einem Anderssein „erwachsener“ Menschen z.B. gegenüber Kindern ausgehen?
Im Gegensatz zum Begriff des „Heranwachsens“, den man mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung bringt und der stets einen zukunftsgerichteten Aspekt beinhaltet („jemand wächst heran zu …“), weisen die Termini „erwachsen“ und „Erwachsene“ eher in rückblickender Perspektive auf einen Zustand bzw. ein Stadium, aus dem jemand sich heraus entwickelt und es verlassen hat. Von daher gibt es einen substanziellen Unterschied zwischen Kinder- und Jugendbildung – wie z.B. im schulischen Kontext – und dem Bereich der Erwachsenenbildung.
veränderter Begriff erforderlich
Doch auch das Erwachsensein ist keine feste Zustandsbeschreibung. Angesichts der postmodernen Gesellschaft sind die früheren Definitionen des Erwachsenenstatus nicht mehr eindeutig, da sie sich meist auf traditionelle Bezugsgrößen wie Beruf und Familie ausrichten, die heute mehr denn je fluide geworden und immer weniger fest umrissen sind. Eine solche klassische Beschreibung lautet etwa: „Erwachsener soll heißen, der aus den generellen Fürsorge- und Schonungsmaßnahmen für die Jugend entlassen ist und für sich und seinen Anteil an den gemeinschaftlichen Lasten selber aufkommt oder aufkommen soll.“ (Arnold/Pätzold 2008, S. 15.) In den heutigen Zeiten der Umbrüche, Unsicherheiten und Entgrenzungen (s. in diesem Teil unten: „gesellschaftliche Veränderungen“, „individuelle Veränderungen“ etc.) ist ein solcher Erwachsenenbegriff kaum mehr zu füllen.
Wir folgen daher bei der Bestimmung religiöser Erwachsenenbildung dem Vorschlag Jochen Kades, der einen dynamisierten Erwachsenenbegriff favorisiert, wenn er das Erwachsensein folgendermaßen definiert:
„Nicht fertig zu sein, sondern sich auf die eigene Biografie als eine durch Bildung immer erst noch herzustellende zu beziehen, das wird in diesem Sinne zum allgemeinen Merkmal eines nunmehr dynamisierten Erwachsenenbegriffs.“
(Kade 2010)
Bei dieser Bestimmung wird dreierlei deutlich: Zum einen wird auf das biografische Element hingewiesen, was bedeutet, dass das Erwachsensein einen lebensgeschichtlich nie endenden Prozess darstellt. Auch und gerade Erwachsene entwickeln sich, wie die neuere entwicklungspsychologische Forschung, die sog. „life span developmental psychology“, deutlich herausgearbeitet hat, in einem erheblichen Maße und bis hinein ins höchste Alter (Arnold/Nolda/Nuissl 2010, S. 183). Dieser Prozess erfolgt in Kontinuität und in Brüchen zur Kindheit und Jugendzeit (Arnold 2010, S. 92), nimmt allerdings neue Elemente aus den biografischen Stationen, den Erfolgs- und Glücksgeschichten ebenso wie den Verwundungen und Traumata auf, wobei die Bestimmung „nie fertig zu sein“ dominierend ist. Zum anderen – und damit zusammenhängend – wird auf die Bedeutung von Bildung hingewiesen. Bildung im Erwachsenenalter ist zwar von Lernvorgängen in der Kindheit und Jugend zu unterscheiden, da die Dichte des bereits Vorfindbaren und Vorstrukturierten größer und möglichweise festgelegter ist als bei jungen Menschen. Dennoch kann Bildung auch als ein konstitutiver Faktor für das „Erwachsensein“ gelten, da der dynamische Begriff das Element der zeitlichen Progression mit einschließt (vgl. unten Teil 2). Bildung ist stets Bewegung, nicht Stillstand. Schließlich, drittens, verweist die kurze Umschreibung des Erwachsenseins von Kade auf die Bedeutung der Gewinnung von „Identität“, die, wie noch zu zeigen ist, eine lebenslange Aufgabe des Individuums darstellt. „Die Frage ‚Wer ist erwachsen?‘ hat eine reflexive Dimension: Sie ist eine zentrale identitätstheoretische Frage in vielen Bildungsveranstaltungen.“ (Siebert 2012, 16) Damit sind wesentliche Bestimmungen und elementare Aufgabenfelder jeder, insbesondere auch der religiösen, Erwachsenenbildung angesprochen: Die Suche nach Identität und die damit zusammenhängende Suche nach Impulsen zur eigenen Identitätsbestimmung entspricht in vielen Fällen explizit und implizit der Motivation Erwachsener, sich zu Bildungsveranstaltungen der (religiösen) Erwachsenenbildungseinrichtungen anzumelden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Erwachsenenbegriff und das Verständnis von Erwachsensein heute dynamisiert, kontextualisiert und biografisch orientiert sein müssen. Für die religiöse Erwachsenenbildung bedeutet dies, dass Erwachsene im Kontext der Transformationen von Gesellschaft, Lebenswelt und Kirche zu sehen sind.