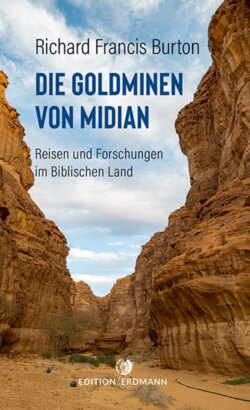Читать книгу Die Goldminen von Midian - Richard Francis Burton - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL II
ОглавлениеDie Veränderungen in Kairo
Mein kurzer Aufenthalt in der Hauptstadt begann äußerst traurig. Ich besuchte sie in der Absicht, einen Vortrag vor der Société Khédiviale de Géographie zu halten. Ich bestellte eine Kutsche und wies den Dragoman an, zur Wohnung des Marquis Alphonse-Victor de Compiègne zu fahren, dessen letzter Brief noch unbeantwortet in meiner Jackentasche steckte. »Ach, Sie wissen wohl nicht, dass er gestorben ist?«, war die Antwort, gefolgt von einem Bericht über den nutzlosen, vorzeitigen Tod in einem Duell am 28. Februar. Es erübrigt sich, bei der eigenartigen Kombination unheilvoller Zufälle länger zu verweilen, dem totalen Fehlverhalten von »Freunden«, die es nicht hätten dulden dürfen, dass die Affäre eine solche Wendung nahm, der geschwächten Gesundheit, die eine Schulterwunde tödlich werden ließ, und dem Unvermögen des aufrechten Mannes, sich die ihm gemäße Stellung zu verschaffen. Es ist nur angemessen zu bemerken, dass diejenigen im Irrtum waren, die dem Ereignis einen politischen Anstrich verleihen wollten – nur weil sich die Angelegenheit zwischen einem Franzosen und einem Deutschen abspielte. Die am besten Informierten können nichts Schuldhaftes am Verhalten von Herrn Meyer entdecken, der seinerseits zu drei Monaten Haft in Preußen verurteilt wurde und mit uns auf der Flora des Österreichischen Lloyds nach Hause zurückkehrte, um seine Strafe abzubüßen. Doch die Tatsache, dass sich beide Kontrahenten so untadelig dem Ehrenkodex unterwarfen, vermag nicht über das unglückliche Ende eines jungen und vielversprechenden Lebens hinwegzutrösten, das so herrlich mit Entdeckungsreisen begann und im Alter von dreißig Jahren, gewissermaßen durch einen dummen Zufall, so plötzlich endete. Es war ein Abgang, den er durchaus nicht verdient hatte.
Herr Frederick Smart teilte Seiner Hoheit freundlicherweise meine Ankunft mit, und schon am nächsten Tag wurde ich mit einer Einladung in den Abidín-Palast geehrt. Mein Empfang durch den Vizekönig fiel besonders wohlwollend aus; bereits die erste Audienz lehrte mich, dass dieser Fürst ein Meister des Details ist, da er gelernt hat, bei der Förderung des Aufschwungs in seinem Lande äußerste Wachsamkeit und Diskretion zu üben. Der Khedive hat kaum die angemessene Anerkennung von Europa erhalten, die sein hoher moralischer Mut verdient. Es erfordert nicht wenig Geisteskraft, so unvermittelt alle Traditionen absoluter Herrschaft aufzugeben, um sie gegen die Fesseln des Konstitutionalismus einzutauschen und obendrein die Hilfe von Fremden anderer Rasse und anderen Glaubensbekenntnisses zu erbitten, wenn sich die Verwaltung des Landes als unfähig und ineffizient erweist.
Das liebe alte Kairo! Und erst sein Nilwasser! Süß, leicht und schmackhaft unterscheidet es sich nicht nur teilweise, sondern ganz und gar von dem anderer Flüsse. Kein Wunder, dass die Hebräer murrten, als sie darauf verzichten mussten. Der erste Schluck ist eine ganz neue Erfahrung, jede Wiederholung der reine Genuss.
Wir haben Anfang März, der Khamsín oder Fünfzig-Tage-Abschnitt des Schirokko hat noch nicht eingesetzt, das Wasser ist morgens wie abends klar und kühl. Im April, dem Frühlingshöhepunkt, und im Mai, der ägyptischen Erntezeit, werden wir Kairo bei Weitem nicht so angenehm vorfinden. Noch ein Schluck, dann brechen wir auf, um erste Eindrücke aus der Stadt des Khediven zu sammeln und die Veränderungen zu erkunden, mit welchen das letzte Vierteljahrhundert die Hauptstadt von Mohammed Ali heimgesucht hat.
Als nach dem Ende der großen napoleonischen Kriege und der fürchterlichen Schlachten der Dragoman-Heerscharen – angeführt von Salt, dem Briten, und Rosetti, dem Franzosen – stillschweigend ein Modus Vivendi geschaffen wurde, hätten die kühnsten Propheten nicht vorauszusagen gewagt, dass ein Stückchen Paris, eine brandneue blitzsaubere gallische Stadt mit ihren Plätzen, ihren Boulevards und ihren Verkehrsinseln, ihrer Oper, ihren französischen Theatern und zwei Pferde-Rennbahnen, ihren Rues Castiglionis und ihrem Grand Hôtel nördlich des kompakten und soliden Parallelogramms entstehen würde, welche hier die Stadt des Mars begrenzt. Und niemals hätten sich die nüchternen Muslime träumen lassen, dass sie ein französisches Viertel in ihrer Hauptstadt erdulden müssten, das sogar bald schon das Ganze zu verschlingen drohte. Ein Blick auf die Verschönerungen, die zwischen dem westlichen Ende des alten Muski oder der halbeuropäischen Basar-Straße und dem Beginn der Schubra-Straße getätigt wurden, lässt erahnen, was auf unsere Nachkommen im Lauf der nächsten fünfzig Jahre zukommen wird.
Der Nil bei Kairo
Der Kern und Brennpunkt der modernen Umgestaltungen ist der Ezbekiyyeh-Platz, das alte sumpfige Zeltlager der Uzbegs, den der gegenwärtige Suleyman Pascha auf Befehl von Mohammed Ali dem Großen in einen öffentlichen Garten umwandeln ließ, welcher für die verschiedensten Zwecke genutzt wird. Fünfundzwanzig Jahre zuvor war er ein nicht eingefriedeter englischer Garten: wild, malerisch und besonders levantinisch in seinen Accessoires. Hier fanden Ausstellungen statt, und über die Rücken der Betenden wurde einfach hinweggeschritten. Unter Grand-Bey hat er seinen familiären Charakter verloren: Wir erkennen nichts außer dem alten Herrensitz des verstorbenen Kyámil Pascha und den stets auf den Bänken verkehrenden Flöhen wieder. Es ist hier ausgesprochen zivilisiert geworden; der reinste Pariser Gaffer würde sich hier leicht in seine Rolle finden.
Die herrlichen Lebek-Bäume – Akazien, deren weißgelbe Blütensträuße und große goldene Schoten ihnen den Namen Dakn el-Bascha, »Bart des Paschas«, einbrachten und deren parfümierter Auszug seinen ätherischen Wirkungen nach nicht grundlos »fitneh« oder »Plage« genannt wurde – haben den Weg für eine Hyksos-Invasion von auswärtigen, unkultivierten Pflanzen bereitet. Der Birket (Wasserbehälter) ist jetzt um die Hälfte zusammengeschrumpft, umgewandelt in ein birnenförmiges Schwimmbad und von einem umzäunten achteckigen Garten umgeben.
Dieses Vergnügungsgewässer ist mit Kanus und Tretbooten ausgestattet; der Rasen wird mithilfe von Metallleitungen bewässert und die Flächen erfreuen sich abwechslungsreicher Gestaltung durch einen Kanal und einen Katarakt, durch Kaffeehäuser und »Kahwehs« – Letztere sind für »Einheimische« vorgesehen –, durch Kioske und Musikpavillons, durch eine Pferde-Rennbahn und ein Karussell, hölzerne Pferde, Boote und anderes mehr. Darüber hinaus hat man einen etwa zwanzig Fuß hohen Berg mit einem zweistöckigen Sommer-Landhaus gekrönt, welches über eine rustikale Brücke zu erreichen ist und sich über einer Grotte erhebt, in der man Eis essen und Domino spielen kann. Zu guter Letzt gibt es noch ein französisches Restaurant, von welchem ich, seiner Weine und seiner Lammkoteletts wegen, durchaus respektvoll sprechen möchte.
Kurz vor Sonnenuntergang werden die Drehkreuze mit weiß gekleideten Polizisten bemannt – die eigentlich braunen groben Leinenstoff tragen sollten –, welche das Eintrittsgeld verlangen. Hierbei hat man keineswegs im Sinn, die städtische Finanzkraft zu stärken. Die Steuer zielt vielmehr darauf, die schwarz bekittelten Fellachen und schweinsgesichtigen Eunuchen von der Bemächtigung der Lebensnerven des jungen Kairo abzuhalten. Nun sehen wir beide Geschlechter gemeinsam promenieren; das eine trägt einen französischen Damenhut, das andere diesen kragenlosen »Konstantinopeler Mantel«, dessen einziger Verdienst darin besteht, dass er zugleich kleidet und entkleidet.
Das neue Kairo rings um den Ezbekiyyeh-Platz ist – wie alle solche modernen Erweiterungen oder Auswüchse – eine Stadt von enormer Ausdehnung, und darüber hinaus in hohem Maße unvollendet: eine feine neue, frisch aus der Hutschachtel stammende französisch-italienisch-griechisch-hebräischarmenische-Yankee-Doodle-negerartige Sorte von Vorort. Die modernen Durchfahrten von gewaltiger Länge und riesiger Breite werden von eigens gepflanzten Bäumen gesäumt, die man doch besser entlang der zentralen Avenuen und Bürgersteige für Fußgänger angelegt hätte. Die einzige Strecke für schattige Spaziergänge findet sich an der südöstlichen Ecke des Neuen Hotels. Gas ist noch ein Luxus am Ort. Die neuen Durchfahrten werden nicht benannt, die frei stehenden und halb frei stehenden Villen nicht nummeriert; dies macht es – wie auf dem Malabar-Hügel in Bombay – schwierig, einen Freund ausfindig zu machen.
Die neuen Boulevards – Abidín, Abd-el-Aziz und Fawwálah (der Bohnenverkäufer) – mit ihren ordentlichen Gartenparzellen prägen die nordwestlichen und westlichen Teile des Parallelogramms. Einer indessen, der »Boulevard des Méhémet Ali«, verläuft durch die Lebensnerven der alten Stadt und ist durch ein Elendsquartier stark beeinträchtigt worden. Er mündet oberhalb der Moschee von Sultan Hasan ein, der bei Weitem größten der Kairoer Moscheen. Die edle ägyptische Architektur von Sultan Hasan mit dem gewaltigen Kranzgesims krönt die immensen ungebrochenen Mauern, welche durch die Konfrontation mit der neuen Rufá’í-Moschee zusätzliche Würde erhalten – es ist dies der große Gebäudekomplex, der sich noch im Bau befindet und in jeder Linie Spuren von europäischer Hand zeigt. Das Beste an Letzterem ist, dass es verglichen mit dem alabasternen griechisch-türkischen Horror in der Zitadelle eine Renaissance der Kunst bedeuten wird. Der Boulevard endet am Kara-Maidan (schwarzer Platz), dem klassischen Rumayleh der Mameluken, wo der Dscherid gespielt wurde und wo Verbrecher, zum Tor der Bestrafung gebracht, über einem eigens für diese Zwecke genutzten Wasserbehälter enthauptet wurden. Was würde der Abessinier Bruce zu dem kahlen Parallelogramm dieser modernen Tage sagen, der ebenfalls nach einer Pariser Mode seinen Namen in »Mohammed-Ali-Platz« geändert hat?
In der Eingeborenenstadt hat man die Hauptverkehrsstraßen durch Abriss der Häuser, die durch »Notlösungen« ersetzt wurden, verbreitert. Die »grüne Schwelle« (Atabat el-Khazrá) aber, wo Ibrahim Pascha, der ritterliche Vater des gegenwärtigen Vizekönigs, sein bronzenes Dienstpferd reitet, gereicht noch immer zur Bestrafung der Fußgänger. Die Eseljungen, einst die einzigen Taxifahrer des Landes, sind wie die Sänftenträger von Bath über die Maßen aufdringlich, und die Wagenlenker von Ägypten lieben es, gerade an solchen Plätzen furios zu fahren, wo der Bürgersteig nichts als ein Streifen und die schmale Straße von schiebenden Menschenmassen verstopft ist. Die Fußgänger, welche den Granden in langen Schritten vorausgehen, schreien o-â! in den lautesten Tönen, wobei sie aber nicht mehr, wie früher, von ihren langen Spazierstöcken Gebrauch machen; sie sind reine Überbleibsel, insbesondere in der mit breiten Straßen versehenen neuen Stadt, und je eher diese Opfer des Raki und der Herzkrankheit von der Welt verschwinden, desto besser. Die öffentliche Ordnung wird von der neuen Polizei in leidlicher Disziplin aufrechterhalten, aber Grausamkeit gegen Tiere ist noch immer die Regel.
Der Muski, Prototyp der verbesserten inneren Durchfahrt, lässt noch viel zu wünschen übrig. Als Pflasterung dient schmutzige schwarze Erde aus faulendem Abfall pflanzlicher und tierischer Herkunft, die infolge der Besprengung selbst im Hochsommer schlammig und rutschig ist. Es bilden sich Haufen, die mit der Hacke ausgeglichen werden müssen, und der Andrang und Gestank von Mensch und Tier sind widerlich. Was diese Pflasterung soll, weiß ich kaum zu sagen. Holz oder jedwede Form von Beton, wie auf der Pozzolana in Alexandria, würde für den sehr schwachen Verkehr allemal genügen. In den Gassen und Nebenstraßen der großen Durchfahrten ist der Dunst weniger auffallend. Staub aus zerriebenem Sandstein ersetzt den Schlamm und die Hügel sind höher, sodass die Räder der Fahrzeuge einen Neigungswinkel von dreißig Grad zu bewältigen haben. Wieder sehen wir verwundert zu, wie ein Droschkenkutscher seine klapprigen Gäule durch eine kaum sechs Fuß breite überfüllte Straße jagt und ohne die Pferde zu zügeln die schärfsten Kurven nimmt, sodass die alten Frauen mit ihren Essenskörben zur Seite springen müssen, um nicht Leib und Leben zu riskieren.
So hat denn »der Durchfluss – eine sehr notwendige Angelegenheit«, wie der Epikuräer feststellt, den Sieg über Kairo errungen. Die Bauwut herrscht hier so stark wie in Wien; aber sie tobt sich aus an Herrenhäusern mit verputzten Lattenfassaden und braunem Bewurf an den Innenwänden. Glücklicherweise sind die Vorderfronten nicht sehr solide gebaut, sodass sie im Verlauf von einigen Jahren häufige Gelegenheit zu – im wahrsten Sinn des Wortes – Schönheitsreparaturen geben. Der Stadtplan weist 279 Hauptmoscheen von insgesamt etwa 400 aus. Die Kosten der »Kirchen-Instandhaltungen« sind dabei genauso bemerkenswert wie bei uns.
Die altehrwürdige Hasanayn, welche wie die Ummawi in Damaskus ein Haupt des unglückseligen Enkels des Apostels von Allah birgt, ist im Stil einer griechischen Kathedrale erbaut, die zwar im Detail, aber weniger in der Gesamtheit bezaubert: Die zungenförmigen Zinnen sind abgestuft, und diese Neigungen brechen die Giebel der Stützpfeiler, lassen die äußere Ansicht verkümmern, statt sie zu unterstützen. Die Fenster bestehen aus Parallelogrammen im Erdgeschoss und zwei Lichtkarniesen im oberen Teil. Das unvollendete Minarett präsentiert sich im raffiniertesten Stil: eine kannelierte Säule, obendrein buckelig, auf einem hochragenden Giebel ruhend. Nichts kann erhabener sein als die zu alten Moscheen gehörenden campanileähnlichen quadratischen Türme; nichts ist scheußlicher als jene Kerzen, welche Löschhütchen tragen – neueste »Errungenschaften« aus Konstantinopel. Es gibt etwa ein halbes Dutzend verschiedener Modelle von Minaretten, jedes ein Ausdruck eines eigenen Zeitalters, aus welchem der Architekt es entlehnt haben könnte; doch er hat seiner persönlichen eigenwilligen Auffassung den Vorzug gegeben, und der Dragoman freut sich über die verschönerte Hasanayn, weil sie vierundfünfzig Säulen weißen Marmors enthält. Die Franzosen in Algerien restaurieren die Monumente aus früheren Tagen, und Kairo sollte den wunderschönen Mausoleen der Mameluken-Beys – welchen die Europäer fälschlich den Namen »Gräber der Kalifen« verliehen haben – nicht erlauben, zu bloßen Trümmerhaufen zu verfallen oder gar als Dschubbeh-Khánas (Schießpulvermagazine) zu enden, die überdies die Stadt mit plötzlichem Tod bedrohen.
An den neuen Häusern sind der vorragende Teil der oberen Stockwerke und die zinnenförmige Gestaltung der Fassaden die einzigen Spuren von Lokalkolorit. Um auch jede verirrte Brise einzufangen, ist jedes Fenster in einem gewissen Winkel zum benachbarten geneigt. Die Straße der Kopten, insbesondere der südliche Abschnitt gegenüber der neuen Straße und dem Platz, wurde nahezu unberührt belassen; lediglich das kühlende, komfortable und malerische Gitterwerk, für das der Sammler so teuer bezahlt, ist entfernt worden. Dies können wir aber nicht wirklich beklagen, da es Ungeziefer beherbergte und die Feuergefahr beträchtlich vergrößerte; aber Glasfenster gelten in diesen Breiten als ebenso barbarisch wie das Trinken von Nilwasser aus einem Trinkglas statt aus einem Gulleh (Wasserspeier). Die Häuserblöcke, welche auf die Place de l’Esbekié blicken, sind wie die Rue de Rivoli mit Arkaden geschmückt: Der einzige Einspruch, der gegen diese vernünftigste aller Neuerungen erhoben werden könnte, ist die Enge des überdachten Weges. Die an Piastern so knappe Stadtverwaltung sollte einen Beschluss fassen und auf den richtigen Proportionen bestehen.
Und nun zu den Heimstätten der Reisenden. Das von einer englischen Gesellschaft erbaute »Neue Hotel« wurde wahrscheinlich von einer Eisenbahnstation abgekupfert, und Neuankömmlinge meinen in der Regel, dass es sich um einen vizeköniglichen Palast handle. Ein falsches Tympanon krönt seine Vorderfront, hinten ist es unvollendet, und gleich den Missgeburten in den Vereinigten Staaten ist es innen in muffige kleine Schlafräume unterteilt, die sonderbar mit seiner gediegenen Halle, seinem großartigen marmornen Treppenhaus und seinen riesigen öffentlichen Salons kontrastieren.
Die anderen drei uns vormals bekannten Einrichtungen sind noch immer auf ihre jeweiligen Nationen beschränkt, sprich Franzosen und Griechen, Deutsche und Engländer. Das alte rote Hôtel de l’Orient alias Coulomb’s, gegenüber der neuen Place de la Bourse und jetzt im Besitz eines Hellenen, berechnet sechzehn Franc pro Tag anstatt derselben Summe in Schilling. Das Tagesgericht im Hôtel du Nil (Herr Friedmann) wird von ständig in Kairo wohnhaften Personen bevorzugt, aber unglücklicherweise ist der Zugang zu dem hellhörig gebauten Haus eine lange Gasse, die vom Muski herabführt, und man hört seinen nächsten Türnachbarn schnarchen. Aus Shepheard’s ist Zech’s geworden. Früher öffnete sich das Tor zu den Gärten hin, jetzt grenzt es an den seltsamsten Gegenstand, der jemals von einem sterblichen Mann bearbeitet wurde: einen Block aus Steinmetzarbeit, dessen Äußeres einem lockeren Haufen Fadennudeln oder einem Schwarm von Raupen nachgebildet zu sein scheint.
Ich kann nicht an Sam Shepheards altem Haus vorübergehen, ohne seines ersten Besitzers zu gedenken, eines in vielen Punkten bemerkenswerten Mannes. Der Sohn eines Bauern aus Warwickshire, geboren auf dem Landgut von V…, welches seit Generationen einer alten Grafenfamilie gehört hatte, fühlte in sich eine Berufung über den Pflug hinaus und entschloss sich, sein Glück jenseits der Äcker zu suchen. Er trat als Bäckerlehrling bei Herrn Walker in Dienst, einem Konditormeister in Leamington, und in glücklicheren Zeiten sandte er nach seinem alten Meister, der zu Hause gescheitert war und eröffnete mit charakteristischer Großzügigkeit für ihn ein Geschäft in Kairo.
Als Kabinenjunge an Bord der Bark Bangalore unter Kapitän Smith landete er 1840 in Suez, als Waghorn gerade dabei war, den Transit zu organisieren. Hier wurde er aus den Reisemitteln der Fahrgäste gestärkt, und mein alter Freund, Herr Henry Levick, welcher noch das englische Postamt betreibt, führte ihn bei Herrn Hill ein, Mohammed Ali Paschas Arabagí-Basch (Leibkutscher), der damals ein kleines Gasthaus im Darb el-Beráberah in Kairo betrieb. Nachdem er eine Zeit lang die Suez-Transporter für fünf Pfund pro Person gefahren hatte, besaß er bald Geld und Kredit genug, um ein Geschäft auf eigene Rechnung zu eröffnen. Wann genau er auf die fixe Idee verfallen ist, dass er geboren wurde, um den Grundbesitz von V… zu erstehen, kann ich nicht sagen – und eine fixe Idee ist ja nicht immer ein Zeichen von Wahnsinn. Wohl aber war er zwischen den Jahren 1840 und 1845 von dieser Idee besessen und machte bei seinen Kunden, einschließlich meines verstorbenen Freundes und Blutsverwandten, des armen Sam Burton, kein Hehl daraus.
Da er ungebildet war, begann er nun, sich in die Materie einzulesen, welche die Position erforderte, die einzunehmen ihm bestimmt war. Und obwohl er nur schwach die Erwartungen an einen Lancashire-Gutsherrn der letzten Generation erfüllte, schrieb er Gesellschaftsverse, welche am Ort zur Modeerscheinung avancierten. Mir ist, als hörte ich ihn noch immer rezitieren:
»Komm in die Wüste, komm, Polly, mit mir!«
Sein Arabisch war stets unbeholfen: Bei ihm war ein Tarbúsch nichts weiter als ein Tarbrush (Teerpinsel). Es waren wilde Geschichten im Umlauf, welche seinen Aufstieg zum Glück erklären sollten, typisch für die Klasse der Hotelbesitzer im Allgemeinen und für die Gattung der Hoteliers in Ägypten im Besonderen. So soll er von Mohammed Ali mit der Herstellung von Schinken-Sandwiches (!) betraut worden sein, welche er in einem doppelt verschlossenen silbernen Behälter transportierte; einen Schlüssel bewahrte er selbst auf, den anderen der Konsument. Die Wahrheit aber ist, dass er ein Zechkumpan des verstorbenen Khayr el-Dín Pascha war, und dieser der Chef des alten Transitbüros, der sich am Billardspiel ebenso wie an hochprozentigen Getränken erfreute und Shepheard einen Vertrag über die Lieferung von Versorgungsgütern an die Passagiere der Kutschen und Nildampfer verschaffte – eine gewinnbringende Angelegenheit, da wir zwölf Pfund pro Kopf bezahlten. Niemand murrte über seinen guten Stern: Er war großherzig und gab mit offenen Händen, als er wohlhabend geworden war; seine liebenswürdigen Taten sind zahllos, und die Souveränität seines Geistes und Auftretens erregte bei nur wenigen Unmut, sicherte ihm hingegen viele Freunde. Er hätte eigenhändig jeden Prinzen von seiner Schwelle gejagt, wenn der sich nicht wie ein Gentleman benommen hätte, und einmal hatte ich einige Mühe, ihn vor den geballten Fäusten eines wütenden angloindischen Majors zu bewahren.
Schließlich füllten die Verträge zur Verpflegung unserer Truppen während des Krimkrieges und des Sepoy-Aufstandes seine Taschen mit Gold. Unverzüglich eilte er nach Warwickshire; er kaufte sofort einen Teil des begehrten Grundbesitzes auf, welcher – außergewöhnlich genug – gerade feilgeboten wurde; und nach und nach fiel dann das Ganze in seine Hände, bis er starb.
Meinen einzigen Besuch beim »Gutsherrn Shepheard« habe ich in angenehmer Erinnerung behalten. Er war zum Liebling all seiner Nachbarn geworden. Er ritt wie ein Mehlsack, aber er ließ kaum eine Jagdgesellschaft aus, und seine Freunde waren bei seinen eigenen Jagd- und Angelausflügen stets willkommen. Seine bescheideneren Tage hat er niemals vergessen, doch munkelte man plötzlich von mittellosen aristokratischen Verbindungen, wie das immer geschieht, wenn ein Mann reich wird, und er wurde mit einem Baron in Verbindung gebracht. Sein einziger Kummer war, keinen Sohn zu haben, der ihm nachfolgen und eine Familie gründen würde – eine wahrhaft englische Vorstellung und eher lobenswert denn blamabel.
Kurz und gut, wenige Menschen haben ein glücklicheres Leben geführt oder mehr Gutes getan oder sind erfolgreicher als der liebenswürdige und ehrliche Sam Shepheard, R.I.P., verschieden.
Diese Schilderung aus vergangenen Zeiten rief einen weiteren alten Reisenden an den Ufern des Nils wieder in mein Gedächtnis zurück: den verstorbenen Mansúr Effendi, Herrn Lane. Sein »Modern Egyptians« ist für den Studenten ebenso notwendig wie Wilkinsons »Ancient Egyptians«, aber die Erfahrungen von 1835–1842 reichen jetzt nicht mehr aus. Ein beträchtlicher Teil der Arbeit, insbesondere der erste Teil, macht die Heckenschere erforderlich – und bewahrt indessen die Blumen und die Frucht: die für diese Zeiten so charakteristischen Anekdoten. Einem gestandenen und praktisch veranlagten Arabisten wie etwa Herrn Konsul Rogers sollte es erlaubt sein, das Werk zu modernisieren und mit den neuesten Erkenntnissen zu ergänzen. Vieles, was zu kurz abgehandelt worden ist, sollte in voller Länge ausgeführt werden, die Gebete sollten nicht nur im Dialekt, sondern auch in Arabisch und ebenso in lateinischer Schrift wiedergegeben werden. Es wäre lohnend, mehr über Abu-Zayd zu erfahren. Das Kapitel IX über die Wissenschaft sollte völlig neu geschrieben werden, andere interessante Themen nicht aus Rücksichtnahme auf die Vorurteile und die ignorante Ungeduld des gewöhnlichen Lesers geopfert werden, wie es vierzig Jahre zuvor geschah. Baron von Hammer-Purgstall und andere Orientalisten haben auf mancherlei Unzulänglichkeiten hingewiesen, und die gelehrten Begründungen des Autors für seine oberflächliche Darstellung und für seine häufigen Auslassungssünden können nicht länger als stichhaltig hingenommen werden.
Ägypten besitzt nunmehr zwei wissenschaftliche Gesellschaften: Keine von beiden wird indessen in dem Ausmaß gefördert, das sie verdient hätte. Die ältere ist das Ägyptische Institut, welches 1860 die Stelle des alten Institut d’Égypte unter Said Pascha eingenommen hat. Sein Hauptquartier und seine Bibliothek sind im Gesundheitsministerium von Alexandria untergebracht, wo wir es auf unserer Rückreise besuchen werden. Sein letztes Bulletin, die Nr. 13, herausgegeben im Zeitraum 1874–1875, enthält sowohl für den einheimischen als auch für den allgemeinen Studenten sehr aufschlussreiche Themen.
Die Königliche Geographische Gesellschaft von Kairo trägt den Titel »Société Khédiviale de Géographie«. Ein unglückliches Ereignis beraubte sie der gelehrten Dienste von Dr. Schweinfurth, seines Zeichens Botaniker und Forscher – Seine Hoheit Prinz Husain Pascha, der zweite Sohn des Vizekönigs und Kriegsminister, ist seit dem bedauernswerten Rücktritt bereits als künftiger Präsident im Gespräch. Von dem traurigen Schicksal seines energischen Generalsekretärs habe ich schon gesprochen: Unter seiner Verantwortung erschien die erste Nummer des Bulletin Trimestriel im Februar 1876, und es ist eine sehr gute Ausgabe. Die Schilderung der letzten Reiseroute des bedauernswerten Ernest Linant de Bellefonds wäre von jeder geographischen Gesellschaft in Europa auf das Lebhafteste begrüßt worden.
Die Gesellschaft ist bewundernswert gut beherbergt. Bücher werden zwar nur langsam angesammelt, weil das Geld knapp ist, dafür aber stetig; und die zahlreichen hochgebildeten amerikanischen Offiziere, welche aus dem Inneren Afrikas an ihren ausgezeichneten Inspekteur General Stone (Pascha) berichten, werden dazu originäre Beiträge in großer Vielfalt und Menge liefern. Die Société schlägt auch vor, Reisende aller Nationen, die beabsichtigen, in das Herz Afrikas vorzudringen, mit Rat, Landkarten, Plänen und anderen Notwendigkeiten zu unterstützen. Dies ist augenscheinlich die wichtigste ihrer Aufgaben. Möchtegernmonopolisten werden sich über kurz oder lang einstellen, aber wir wollen darauf vertrauen, dass sie immer in der Minderheit bleiben werden.
In Bombay schlossen sich kürzlich die Asiatische und die Geographische Gesellschaft zusammen und bilden nun einen starken Körper statt zweier schwacher. Sollte dieses gute Beispiel nicht von Ägypten nachgeahmt werden, wo eine Subvention von 5000 Franc pro Jahr für eine einzelne gelehrte Körperschaft genügte und wo die vereinigten Bibliotheken – eine mit alten, die andere mit neuen Büchern – einander ergänzen würden? Aber die anscheinend kleinen Schwierigkeiten sind in Wahrheit groß; es erforderte schon einen Cavour oder einen Bismarck, sie zu vereinigen, wo doch bereits ein Thersites genügt, um ein Königreich oder eine Gesellschaft zu spalten.
In der Hauptstadt vermissen wir den alten zweckmäßigen öffentlichen Lesesaal im koptischen Viertel, von wo unter der Leitung von Professor Spitta die seltenen und wertvollen Bücher an die Zentrale Bibliothek des Bildungsministeriums im Darb el-Dschamámíz übergeben worden sind. Es wäre selbstsüchtig, diese Änderung bedauern zu wollen, die schon so viel Gutes bewirkt hat, und ich war recht überrascht, die große Zahl einheimischer Studenten und Kopisten zu sehen, welche die gut beleuchteten und komfortablen Räume besuchten. Das Bulák-Museum für ägyptische Altertümer, welche – außer einigen von Herrn Generalkonsul Hübner angekauften Artikeln – alle das Ergebnis von Ausgrabungen von Herrn Auguste Mariette aus Boulogne sind, erfreut sich zu großer Bekanntheit, um eine Beschreibung zu benötigen. Letztes Jahr erschien die sechste Ausgabe seiner Notice des Principaux Monuments (Kairo, Mourès), ein 300 Seiten starker Band von besonderem Wert in durchdachtem Katalogstil. Der einzige Mangel dieser vortrefflichen Sammlung ist das geplante und versprochene Gebäude. Gegenwärtig besitzt es die alte Bulák-Station der Nildampfer, einschließlich der Little Asthmatic, und deren Mauern scheinen nicht allzu sicher zu sein. Auf der Westseite des Nils wurden die für das neue Museum beabsichtigten Fundamente in den Schlamm gesetzt. Warum überlässt man ihm nicht die Rennbahn als Baugelände?
Die Zeiten in Kairo sind fast so »hart« wie in Alexandria und erinnern den Sammler an ein bestimmtes altes Sprichwort über krank machende Winde. Vor vielen Jahren ist Birmingham (Massenproduktion von billigen Artikeln – d. Ü.) in den Nil geflossen, wie der Orontes in den Tiber, und die Sintflut von Nachahmungen und schamlosen Imitationen endete erst, als sie den Käufer fast abschaffte: Kaum ein Tourist wagte mehr, einen Skarabäus oder eine Statuette auch nur anzuschauen. Der »Antíká-Jäger« konnte während der letzten zwei Jahre seiner Sache ziemlich sicher sein. Es ist für den Bauern billiger, wirkliche Überbleibsel zu finden, als sein Geld für Fälschungen zu riskieren. Doch sollte ich dem wohlhabenden Amateursammler, der solche Sachen zu kaufen oder in alte Rüstungen und »Damaskus«-Klingen, in Türkise und Rosenöl, in persische Ziegel, Münzen und dergleichen mehr zu investieren gedenkt, dringend raten, sich ein Empfehlungsschreiben für einige hochrangige einheimische Persönlichkeiten zu sichern.
Die unvermeidlichen Abstecher in die Umgebung – zu dem Schubrá-Palast, nach Mataríyyeh und zum versteinerten Wald, nach Rodeh (Nilometer), nach El-Dschezireh (Zoologische und Botanische Gärten), nach Alt-Kairo und Memphis, nach Sakkára und zu den Pyramiden, um nur die wichtigsten zu erwähnen – sind auf eine Weise zwar vereinfacht, auf die andere aber erschwert worden. Die Schubrá-Straße zum Beispiel, noch immer die angesagte Strecke für eine abendliche Spazierfahrt, fängt gut an, endet aber mit Schlaglöchern, die den Kutschenfedern hart zusetzen.
Überdies muss man nun zunächst eine Genehmigung des Konsulats einholen, um die früher für den allgemeinen Besucherverkehr geöffneten Palastgärten aufzusuchen. Dieser offizielle Pass ist neuerdings auch für die Einrichtungen auf El-Dschezireh und für bestimmte Moscheen erforderlich – wo dort früher dein Kawwás (Janitschar) lediglich »Bakhschísch« bezahlen musste. Den alten malerischen Anblick und die amüsanten Reiseunfälle gibt es jetzt nicht mehr. Man mietet eine Kutsche, überquert Vater Nil auf einer großen Gitterbrücke, die nur 1 800 000 Francs gekostet hat, passiert eine zweite von El-Dschezireh nach dem libyschen Ufer und schließlich einen breiten, lockeren und staubigen, mit jungen Bäumen bepflanzten Straßendamm, welcher sich fast wie eine Fernverkehrsstraße in der Normandie oder Kanada über die Felder erstreckt und in einer Art von Umrisslinie endet. Nach zwei Stunden langt man an der Basis des Felsplateaus an, welches die Ghizeh-Pyramiden trägt, die letzten Wohnstätten von Khúfú (Cheops) und Kháfrá (Chephren).
Es herrscht ein Mangel an Schicklichkeit auf dieser zurechtgestutzten, modernen Chaussee, die zu jenen Gebäudekomplexen von kolossaler alter Majestät führt, zu den ersten Früchten und den besten unter den klugen Arbeiten Ägyptens, zu dem Vermächtnis einer Rasse, die auf die Griechen wie auf vorlaute und starrsinnige kleine Kinder herabschaut. Aber jetzt bricht ihr Geist in offene Revolte aus.
Diese Rampe aus Steinmetzarbeit, bereits halb begraben unter den Sanden von Typhon – von ihm, der in Philae schläft – was macht sie hier?
Cheopspyramide und Sphinx
Und dieses Cockney-Gartenhäuschen, welches am unmittelbaren Fuß der Großen Pyramide sitzt, es entweiht den kühlen violetten Abendschatten und verdirbt jede Fotografie – ist es ein grober Scherz über das neunzehnte Jahrhundert? Oder ein Maß für den Unterschied zwischen uns Würmern des Jahres 1877 und den Riesen und Halbgöttern von 3700 v. Chr.?
Der nächste Schritt wird gewiss in »Verbesserungen« an »Khut« (dem Herrlichen, Prächtigen) und an »Ur« (dem Großen) bestehen. Wir werden an Khúfús und Kháfrás Wunderwerken eine Flucht komfortabler Stufen vorfinden, die sich im Zickzack an den nördlichen Fassaden hinauf- und an den südlichen hinabschlängeln, gesichert durch ein ordentliches eisernes Geländer von M. M. Cérisy et Cie. de Lyons, aus Gründen der Ästhetik und der Wirtschaftlichkeit in kräftigem Erbsengrün angemalt. Der Vermessungspunkt auf der obersten Plattform wird einem schmucken Kaffeekiosk Platz machen, wo neben anderen Dingen Pelel und Kaffee mit Zichorie konsumiert werden können, ganz zu schweigen von der ehrenwerten und genialen »Saturday Review«. Und vielleicht dürfen wir auch damit rechnen, dass das Gartenhäuschen zu einem »Hôtel des Pyramides« verschandelt wird, mit Küchenchef und Kellermeistern und Kellnern – angetan mit dem alten Gewand von Kemi, dem Schwarzen Land.
Diese Modernisierungen werden wahrlich einen bemerkenswerten Kontrast zu den Grundsätzen des Neuen Glaubens mit den von den Pyramidisten Filopanti, John Taylor, Abbé Moigno und C. Piazzi Smyth enträtselten Symbolen bilden, in dem »größten, ältesten, am besten gebauten, höchst mathematisch ausgerichteten und in geographischer Hinsicht zu den Ländern der ganzen Erde am zentralsten gelegenen Gebäude (30° nördlicher Breite)«.
Währenddessen behandelt der gelehrte Ägyptologe Herr H. Brugsch-Bey, der ein solch verheerendes Chaos mit der erhaltenen Version des Exodus angerichtet hat, die Pyramiden auf seine eigene neuartige und einfallsreiche Weise. Da er kein hieratisches Wort findet, um »Pyramide« darzustellen, kann er nur eine Metathesis von Abumer vorschlagen (eine »große Gruft«), verfälscht zu Aburam, Buram, und Buram-is. Gewöhnlich gehen wir davon aus, dass sich in dem unter Arabern noch immer populäre koptische »Piramis« das Wort Haram verbirgt, wobei ihm das ägyptische Pi, Pui oder Pa vorangestellt und mit einem griechischen Suffix annehmbar gemacht wird: Pe-haram-is = Pyramis. Andere hingegen finden das Wort in Pi-re-mit, das »Zehnte an Zahlen«. Er rehabilitiert zudem nach der Mode des Jahrhunderts das Gedenken an Cheops und Chephren, die seit 450 v. Chr. die Muster-Tyrannen repräsentiert haben: Herodot, so scheint es, wurde von seinem Dragoman ebenso getäuscht wie jede ältere Jungfer des neunzehnten Jahrhunderts, die die malerische Schönheit einer goldbetressten Jacke und großer Reisetaschen bewundert.
Inschriften – die in Ägypten nicht lügen, selbst wenn sie den Per’aoh, de Pharao, betreffen – versichern uns offiziell, dass die Taten und die Tapferkeit dieser beiden Könige wahrlich Vergöttlichung verdienten. Infolgedessen muss sich die Rhetorik, einmal mehr von der Geschichte in die Flucht geschlagen, wohl oder übel von einem ihrer bevorzugten und ehrwürdigsten Gemeinplätze – den »enormen schrecklichen Wundern« von »Cheops’ Torheit« – und dem eitlen Pomp und Hochmut dieser alten Despoten verabschieden. Der Bau der Steinhügel war augenscheinlich die religiöseste unter den gottesfürchtigen Arbeiten, eine Lektion und ein dauerhaftes Beispiel für die Lehnspflichtigen von Tescher, dem Roten Land.
Kairo hat auch ein Sanatorium in kleinerem Maßstab in Angriff genommen. Es wird hauptsächlich von Rheuma-Patienten frequentiert sowie von Fremden in der kalten Jahreszeit, insbesondere als Schlafplatz für diejenigen Gäste, welche Sakkára besuchen. Helwán (die Bäder), fünfzehneinhalb Meilen südlich von Kairo auf dem rechten Ufer des Niltales und etwa zweieinhalb Meilen vom Fluss gelegen, hat eine eigene Eisenbahnanbindung und widerwärtige Schwefelbäder mit einer Temperatur von 86 Grad (F) zu bieten. Überdies liegt es 120 Fuß über dem Strom, was ungefähr der Höhe des größten Minaretts in der Zitadelle entspricht; deshalb wird seine Luft als wohltuende Veränderung empfunden. Einige entlegene Bungalows führen zum Établissement, einem großen leeren Gebäude mit einem zentralen Hofraum, welcher – völlig ohne Diwane und Sofas – die Vorstellung eines hübschen Queen’s Bench (obersten Gerichtshofes – d. Ü.) erweckt, wenn es für die Nacht geschlossen wird. Das Speisenangebot indessen ist annehmbar; der Geschäftsführer ist gesittet, und es gibt dergleichen Annehmlichkeiten wie ein Post- und ein Telegrafenamt.
Das Hauptinteresse an Helwán hegen die Archäologen. Die Ebene steigt vom modernen Nilbett in Richtung der östlichen Hügelkette an, welche das alte Flusstal begrenzt, und beherbergt zwei Zentren der Feuersteinproduktion, welche möglicherweise eine prähistorische Herstellung suggeriert, zumal dort drei Fuß und tiefer unter der Oberfläche bearbeitete Feuersteine gefunden wurden. Eines der Zentren liegt bei dem letzten Brunnen nördlich des Helwán-Hotels und westlich der Eisenbahnlinie. Hier haben die von Dr. Reil geführten Herren Braun von der Geologischen und Hayns von der Numismatischen Gesellschaft eine Feuersteinsäge und zahlreiche Abschläge aufgesammelt. Das andere Zentrum befindet sich etwa zwei Meilen südlich des Hotels auf den Abhängen eines Bassins, das in Richtung eines großen und offenen Wadis entwässert wird und nach Regenfällen seine Wasser zum Nil transportiert. Hier findet man wieder reichlich Fragmente, und ihre Formen unterscheiden sie sofort von den ringsum verstreuten dunklen Kalksteinen.
Ich wurde von Herrn Lombard, dem Manager des Helwán-Hotels, mit feinen Exemplaren von Sägen und gezahnten Feuersteinen versorgt; aber – Reisende, hütet euch! – sie werden jetzt von den Ägyptern »nachgemacht«. Auf der westlichen Seite des Nils, in Záwiyat el-Uryán, fand Professor Lewis von der Londoner Universität eine Säge, und Herr Hayns kurz danach einen Kratzer. Die gelehrte Welt ist wie so oft in zwei Lager gespalten. Der kompromisslose Ägyptologe, der – Herodot zum Trotz – meint, dass diese »Kunst keine Kindheit in Ägypten hatte«, und hegt eine persönliche Abneigung gegen ein prähistorisches Steinzeitalter; und er akzeptiert bereitwillig die Theorie von Dr. Schweinfurth, Herrn G. Rohlfs und Dr. Zittel, wonach plötzliche und übermäßige Temperaturveränderungen das produziert haben sollen, was frühgeschichtlicher Handarbeit zugeschrieben wurde. Auf der anderen Seite betrachtet der Naturforscher die Frage als gelöst. Sir John Lubbock und weitere entdeckten paläolithische Feuerstein-Artefakte an mehreren Stellen, insbesondere in Theben und Abydos.
Dr. Gaillardot erwähnt auch Assouan (Syene), Manga und die Felsspalten von Dschebel Silsileh, und dieser große Wissenschaftler findet keinen Grund, warum der Mensch nicht zugleich mit der mächtigen quartären Vegetation des Niltales existiert haben sollte. Der hoch angesehene Herr Auguste Mariette-Bey verhält sich diesem Thema gegenüber reserviert, weil er nur von dem sprechen will, was er beim Bearbeiten des Bodens selbst gesehen hat. Herr Arcelin hat im Correspondant von 1873 »La Question Préhistorique« (Die prähistorische Frage) aufgeworfen und auf Einwendungen in »L’âge de la pierre et la classification préhistorique d’après les sources Égyptiennes« (Das Steinzeitalter und die prähistorische Einteilung nach den ägyptischen Quellen – d. Ü.) geantwortet. Die Feuerstein-Dolche der alten Ägypter sind wohlbekannt: Sie werden von Wilkinson in zwei Arten eingeteilt, eine breitflächig, die andere schmal-spitzig; und er übersetzt »äthiopischer Stein« mit »Feuerstein« (Obsidian?). Überdies beantwortete die von den Herren C. F. Tyrwhitt-Drake und Palmer unternommene Expedition durch die Wüste des Exodus und den Negev (oder das Südliche Land) die Frage praktisch durch den massenhaften Fund von Feuerstein-Abschlägen in der Nähe der Monumente von Surabit el-Khádim, die, wie Herr Bauerman vorgeschlagen hatte, dazu verwendet wurden, die hieroglyphischen Wandtafeln herauszumeißeln. Muscheln und bearbeitete Feuersteine kommen wieder in jenen seltsamen Bienenstöcken mit zusammengekrümmten Skeletten vor, die überall auf der Sinai-Halbinsel Nawamis (Moskito-Hütten) genannt werden; und schließlich wurden Feuersteinpfeilspitzen bei einem Hügelfort nahe Erweis el-Ebeirig (Kibroth Hattaavah, die Grüfte der Begierde?) gesichtet.