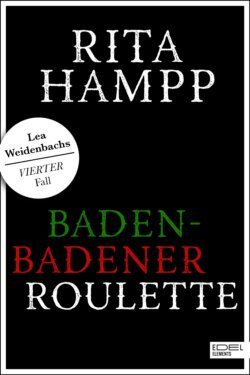Читать книгу Baden-Badener Roulette - Rita Hampp - Страница 11
SECHS Freitag, 10. Juli
ОглавлениеDie Friedrichstraße verlief etwas erhöht und fast parallel zur Lichtentaler Allee, die vor hundertfünfzig Jahren zu einem vierzig Hektar großen englischen Park umgestaltet worden war und seit den Glanzzeiten Baden-Badens so berühmt war, dass einige Enthusiasten sie neuerdings am liebsten in die Liste des Weltkulturerbes aufnehmen lassen würden. Lea rümpfte die Nase. Sie hatte schon einige Artikel über dieses ehrgeizige und vor allem kostspielige Bestreben verfasst. Natürlich liebte auch sie den gepflegten wertvollen alten Baumbestand entlang ihrer frühmorgendlichen, unvergleichlich schönen Joggingstrecke. Aber es ließ sich auch nicht leugnen, dass es größere und eindrucksvollere Anlagen dieser Art auf der Welt gab. Allerdings hielt sie mit ihrer Meinung lieber hinterm Berg, denn sie konnte sich schon die Flut empörter Leserbriefe vorstellen, sollte sie einmal schreiben, was sie wirklich dachte. Es gab Themen, da lohnte sich die Aufregung nicht.
Hier war es auch schon, das einzige rosa gestrichene Haus mit weißen Fensterläden in der Reihe der gediegenen Villen und exklusiven Mehrfamilienanwesen. Das Gebäude lag etwas zurückversetzt in einer gepflegten, leicht ansteigenden Gartenanlage, sah aber im Gegensatz zu den neuen Apartmenthäusern daneben ein wenig heruntergekommen aus. Lea liebte alte Häuser, und sie mochte dieses vom ersten Anblick.
»H. S.« stand an der glänzenden Messingklingel. Herta Sieburg, richtig.
Kaum hatte sie geläutet, schoss ein Rottweiler auf den hohen Gartenzaun zu und bellte geifernd. Vorsichtshalber machte Lea einen Schritt zurück. Von einem Hund hatte Frau Campenhausen ihr gestern Abend nichts erzählt, als sie ihr die Namen und Adressen von zwei Opfern des Gentleman-Räubers genannt hatte, Charlotte Quint und Herta Sieburg. Die alte Dame hätte die Frauen gern selbst besucht, aber sie hatte heute Morgen einen Arzttermin, und Herta Sieburg hatte am Telefon darauf bestanden, dass sie bitte pünktlich um neun Uhr kommen möge. Charlotte Quint hatten sie noch nicht erreichen können.
»Ach, hör doch bitte auf zu bellen«, hörte sie jemanden mit dünner Stimme rufen. Hoffentlich war das nicht das Frauchen, denn auf Höflichkeit würde diese Bestie ganz bestimmt nicht reagieren.
Lea stellte sich auf Zehenspitzen und versuchte, jemanden am Haus zu entdecken. Eine grauhaarige Frau lehnte aus einem Fenster des ersten Stocks und winkte ihr zu. »Trauen Sie sich herein? Sonst müssen wir noch fünf Minuten warten.«
Lea blickte auf das Ungeheuer, das immer wütender wurde und wie ausgehungert am Zaun entlanglief auf der Suche nach einer Lücke, um sich auf sie zu stürzen und sie zu zerfleischen.
»Soll ich lieber später noch einmal vorbeischauen?«, sagte sie zaghaft.
»Nein, nein, bleiben Sie bitte. Es kommt gleich jemand.«
Wenige Augenblicke später hielt ein großer Kombi neben Lea, und eine robuste, kurzhaarige Mittdreißigerin stieg aus, begleitet von vielstimmigem Bellen. Vier oder fünf Hunde tummelten sich auf der hinteren Ladefläche, und sie legte sich eine breite Leine um die Schulter.
»Jacko, still. Kein Mucks«, rief sie und betätigte ein kleines Blechspielzeug, das ein kurzes Klacken von sich gab. Augenblicklich war der Rottweiler still und hing hechelnd am Zaun. Eine Hand fuhr in die Jackentasche, dann mit einem Leckerli durch den Zaun, und Jacko hätte geschnurrt wie ein zahmes Kätzchen, wenn er es nur gekonnt hätte. Lammfromm trottete er zur Pforte, dann ertönte ein Summton, das Tor schwang auf, und Hund und Frau begrüßten sich stürmisch und machten sich auf den Weg zum Auto. »Bis später!«, rief die Dompteurin noch zurück, dann startete sie.
»Kommen Sie, kommen Sie. Jetzt haben wir zwei Stunden Ruhe«, rief die dünne Stimme, und Lea stieg die Anhöhe zum Haus hinauf.
Wie ein verlorenes Kind stand Herta Sieburg in der offenen Tür und sah ihr mit geweiteten Augen entgegen. Sie war klein und zierlich, und ihr sportlicher Hosenanzug passte zu ihrer praktischen Kurzhaarfrisur.
»Ich habe uns eine Kleinigkeit gerichtet. Wollen Sie mir helfen? Dann können wir uns auf die Terrasse setzen, bis der Hund zurück ist«, sagte sie und geleitete Lea durch eine weitläufige Diele und eine elegant weiß möblierte Wohnhalle mit alten Meisterwerken an der Wand, die sicher keine Kopien waren.
In der großen weißen Küche mit einer gemütlichen Essecke, in der sich Zeitungen und Zeitschriften stapelten und ein kleines Radiogerät stand, hatte sie auf einem Tablett Gläser und eine große Karaffe mit Orangensaft, dazu einen Teller mit kleinen belegten Broten bereitgestellt.
»Würden Sie das Tablett freundlicherweise hinaustragen?«, bat sie höflich und ging ins Wohnzimmer, wo sie die schwere Glastür, die zur Terrasse führte, zweifach entriegelte.
Draußen stellte Lea das Tablett auf einen Glastisch, während Frau Sieburg Polster auf den Gartenstühlen verteilte und nervös auf die Uhr sah.
»Wie lange haben Sie den Hund denn schon?«, fragte Lea.
»Seit bald zwei Jahren. Meine Söhne haben ihn mir nach dem Überfall geschenkt. Er soll mich beschützen, sagen sie. Aber irgendwie klappt das nicht mit uns.«
»Er merkt wahrscheinlich, dass Sie Angst haben.«
»Das sagt meine Hundesitterin auch. Gott, bin ich froh, dass sie mir das Tier morgens und abends zwei Stunden abnimmt. Sonst käme ich ja gar nicht mehr in den Garten. Dabei ist es doch so schön hier, nicht wahr?«
Lea musste ihr recht geben. Noch empfing die Terrasse ein paar Strahlen der Morgensonne, aber das Haus stand auf der Schattenseite der Stadt, und an einem heißen Tag wie diesem war das sicher ausgesprochen angenehm. Man hatte einen hübschen Blick über die Allee hinweg zu den grün-weiß gestreiften Baldachins an den Fenstern des berühmten Brenner’s Park-Hotels.
Der Garten sah fürs Leas Geschmack etwas zu pflegeleicht aus, große Rasenflächen, die von dichten Rhododendronbüschen, Hortensien und niedrigen Zierbäumen umgeben waren. An der Grundstücksgrenze ragten hohe Birken, Eiben und Kiefern auf. In einer Ecke stand ein Zwinger ohne Tür.
Herta Sieburg deutete hinüber. »Anfangs habe ich den Hund in den Zwinger gesperrt, aber das wollen meine Söhne nicht. Sie sagen, dann könnte er schlecht Einbrecher verjagen. Das stimmt natürlich, also haben wir den Zaun ums Grundstück erhöht, und nun läuft er frei herum, und ich sitze im Haus. Ob der Halunke eigentlich weiß, was er mir antut?«
»Wahrscheinlich nicht. Frau Sieburg, Frau Campenhausen hat Ihnen ja am Telefon gesagt, wer ich bin und worum es geht.«
»Ja, der Fall Dahlmann.«
»Genau. Ich versuche mehr über die Vorgehensweise des Täters herauszufinden. Die Polizei gibt mir keine Auskunft, aber ich meine, es ist wichtig, die Bevölkerung zu informieren, damit so etwas nicht mehr vorkommen kann.«
Herta Sieburg schenkte Saft ein und schnaubte verächtlich. »Selbst wenn ich gewarnt gewesen wäre, hätte ich es nicht verhindern können. Ich bin ja nicht leichtsinnig. Hier stehen keine Türen und Fenster offen, und ich habe keinen Fremden hereingelassen, auch wenn die Polizei damals ständig danach fragte.«
»Wann geschah der Überfall? Und haben Sie eine Theorie, wie der Mann hereingekommen sein könnte?«
Herta Sieburg hob die Hand und erstarrte. »Haben Sie das gehört?«, flüsterte sie.
»Ein Vogel im Gebüsch.«
»Ach so. Dann ist es gut. Vielleicht sollten wir doch besser hineingehen und die Türen schließen.«
»Frau Sieburg, beruhigen Sie sich. Ich bin doch auch noch da.«
»Stimmt. Lieber Gott, ich bin so schreckhaft geworden. Eigentlich ist der Hund ja doch ganz angenehm. Der lässt unter Garantie niemanden aufs Grundstück.«
»Möchten Sie mir sagen, wie es geschah?«
»Wenn ich das nur wüsste. Ich habe überhaupt nichts gehört oder gesehen oder gespürt. Manchmal spürt man doch, wenn Gefahr droht, nicht wahr? Doch da war nichts. Ich habe in der Küche gestanden und abgespült, und da stand er plötzlich hinter mir. Mit einer Putin-Maske über dem Kopf und einem Revolver in der Hand.«
»Einem Revolver?«
»Ach, das wollte die Polizei auch genau wissen. Ich kenne mich damit nicht aus. Faustfeuerwaffe – darauf haben wir uns dann geeinigt. So habe ich das zu Protokoll gegeben.«
»Was ist dann passiert?«
»Er hat mir die Hände auf dem Rücken gefesselt, mich auf einen Stuhl geschubst und die Geheimnummer für die Bankkarte wissen wollen. Dann hat er mir sämtlichen Schmuck, den ich trug, abgenommen und gefragt, wo der restliche sei. Alles hat er mitgenommen, sogar meinen Ehering.« Herta Sieburg betrachtete ihre wohlmanikürten Finger, die leicht zitterten.
Erst jetzt fiel Lea auf, dass die Frau keinerlei Wertsachen trug.
»Das habe ich ihm besonders übel genommen. Der Ring war doch gar nichts wert, er stammte aus den Kriegsjahren, in denen es nichts gab. Georg wollte mir zur Goldenen Hochzeit einen neuen schenken. Aber kurz vorher ist er gestorben.«
»Hat die Versicherung den Schaden nicht ausgeglichen?«
»Natürlich, aber was ist Geld? Das waren ganz persönliche Erinnerungsstücke, die kann man nicht durch Neukauf ersetzen. Ich habe auch nicht viel erstattet bekommen, denn wer hat schon Quittungen von Geschenken oder Expertisen oder Fotodokumente, die die Versicherung gebraucht hätte, um den Schaden exakter zu schätzen? Ich habe von dem Geld den neuen Zaun bauen lassen und war während dieser Zeit auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Das war übrigens mein letzter Urlaub. Jetzt geht das ja nicht mehr. Es müsste sich jemand um Jacko kümmern, das kann ich niemandem zumuten.«
Irgendwo in der Nachbarschaft bellte ein Hund, und Herta Sieburg zuckte zusammen. Dann sah sie auf die Uhr und entspannte sich wieder. »Noch über eine Stunde«, murmelte sie wie zu sich selbst.
»Wie ging es dann weiter?«
»Er hat mir die Beine an den Stuhl gebunden, einen widerlichen roten Klebestreifen auf den Mund gedrückt und mir gesagt, es wäre nur für die Nacht. Er wüsste, dass jeden Morgen um neun Uhr die Frau von nebenan vorbeisehe, um zu fragen, ob sie mir beim Einkaufen oder im Garten helfen könne. Sie hatte einen Schlüssel vom Haus. Es war so eine reizende Nachbarschaft hier! Damals jedenfalls. Die Frau hat es leider nach dem Überfall mit der Angst zu tun bekommen und ist, obwohl sie ihr Haus gerade erst so hübsch renoviert hatten, ins Rebland gezogen. Das kann ich ihr nicht verdenken.«
Es klang so viel Sehnsucht in ihrer Stimme, dass Lea Mitleid mit ihr bekam.
Ihr Artikel, so beschloss sie, würde ganz anders ausfallen, als sie es vorgehabt hatte. Er würde sich natürlich auch um die Vorgehensweise des Täters drehen, aber ebenso großes Augenmerk auf die Auswirkungen der Tat für seine Opfer richten.
»Haben auch Sie mit dem Gedanken gespielt, wegzuziehen?«, nahm sie den Faden wieder auf.
Herta Sieburg nickte heftig. »Aber bitte schreiben Sie das nicht. Ich bin fünfundsiebzig, da zieht man nicht mehr so einfach um. Hinzu kommt, dass wir das Haus und unser Vermögen schon vor Jahren unseren beiden Söhnen überschrieben haben und ich hier lebenslanges Wohnrecht besitze. Ich könnte gar nicht weg, selbst wenn ich wollte. Sie lassen mich nicht. Ich habe einmal gefragt, ob ich nicht zu ihnen ziehen könnte, weil ich mich so fürchte. Nun ja, eine Woche später kamen sie mit dem Tier an. Sie meinen es ja nur gut, ich will mich nicht beklagen, aber ich habe mein Leben seitdem schon sehr umstellen müssen. Vor allem der Tanztee im Kurhaus am Sonntag fehlt mir.«
»Was hindert Sie daran, hinzugehen?«
»Sonntags hat die Hundesitterin ihren freien Tag, da ist Jacko den ganzen Tag im Garten. Da kann ich nicht raus.« Herta Sieburg beugte sich über den Gartentisch und flüsterte: »Ich glaube, er mag mich nicht. Wahrscheinlich würde er mich beißen, wenn ich zurück ins Haus wollte.«
»Wer kommt eigentlich sonst noch regelmäßig zu Ihnen ins Haus? Könnte es Gemeinsamkeiten mit Frau Dahlmann geben? Kannten Sie sie?«
»Nicht direkt. Ich teile mir Natascha, die Putzfrau, mit ihr und Frau Campenhausen. Aber das weiß ich erst seit dem Telefonat gestern. Ich habe eine Liste angefertigt mit den Personen, die ich ab und zu empfange, inklusive meinem Hausarzt. Sonst habe ich nicht viel Besuch. Meine Söhne wohnen in Hamburg und in Essen. Sie wechseln sich ab und kommen an Muttertag, an meinem Geburtstag und an Weihnachten und führen mich dann ins ›Stahlbad‹ zum Essen aus. Dabei würde ich ihnen viel lieber selbst etwas kochen. Aber das lassen sie nicht zu. Ich soll mir keine Mühe machen, sagen sie. Als wäre ich den ganzen Tag beschäftigt, dabei ...«
Sie musste den Satz nicht beenden. Lea wusste auch so, dass die alte Dame entsetzlich einsam war. Ob sie mit Frau Campenhausen reden sollte? Vielleicht wusste die einen Ausweg.
Als drinnen das Telefon ging, zuckte Herta Sieburg erneut zusammen. »Ich glaube, wir sollten unser Gespräch allmählich beenden. Der Hund kommt gleich«, flüsterte sie und eilte in ihr Gefängnis zurück.
***
An vernünftiges Arbeiten war an diesem Morgen nicht zu denken. Das halbe Büro war in Aufruhr und Glühwürmchen Lydia Riebe den Tränen nah.
»Ich habe sie aus ihrer Box nur schnell aufs Katzenklo lassen wollen«, jammerte sie. »In der Mittagspause bringe ich sie zum Tierarzt.«
»Die Frage ist doch eher, warum Sie überhaupt eine wild gewordene Katze auf eine Polizeidienststelle schleppen«, sagte Gottlieb aufgebracht, während er mit einem Lineal in eine unübersichtliche Ecke hinter dem halbhohen Rollladenschrank stocherte, hinter dem er das Ungeheuer vermutete.
Ratsch – machte es.
»Autsch!«
Er ließ das Lineal fallen und beobachtete erbost, wie Blut aus einer langen, tiefen Kratzspur in seinem Arm quoll.
»Jetzt ist es genug. Sie bringen das Tier weg«, rief er. »Sofort!«
Damit verließ er sein Büro und knallte vorsichtshalber die Tür zu. Im Besprechungszimmer blickte er in feixende Gesichter und musste selber schmunzeln.
»Es gibt Feinde, mit denen man nicht rechnet«, murmelte er halb verärgert, halb amüsiert, griff nach einem Stapel Servietten, der neben einer Platte mit Apfelkuchen stand, und wischte sich den Arm ab. »Diese Frau kann vielleicht göttlich backen, aber sie hat eindeutig einen Tierfimmel.«
»Es ist doch die kranke Katze ihrer Cousine«, nahm Sonja Schöller die neue Kollegin in Schutz.
»Und warum bringt die Cousine das Tier nicht selbst weg? Oder holt sich einen Hund, wenn ihr danach ist? Warum schickt sie andere für sich herum? Wer weiß, womit wir uns morgen herumschlagen müssen, nur weil Madame oder Mademoiselle etwas haben will. Verdammt, dabei haben wir einen Fall zu klären. Also, können wir endlich anfangen? Ist die Kette mit dem Anhänger inzwischen hier?«
Lukas Decker schwenkte einen Plastikbeutel. »Das Teil lag auf dem Teppich vor dem Sofa. Die Kette ist gerissen, wahrscheinlich im Kampf.«
»Also könnte sie unserem Mann gehören?«
»Sieht danach aus.«
»Sicher sind wir aber mal wieder nicht, was? Ruft doch bitte jemand die Zeugin Campenhausen an, sie soll rasch herkommen und sich den Schmuck ansehen. Sie müsste doch am besten wissen, ob er ihrer Freundin gehörte.«
»Wahrscheinlich tat er das nicht«, meldete sich Hanno Appelt. »Das Opfer trug nur teuersten Schmuck, und dies hier ist eine ganz billige Kaufhauskette. Allerdings gibt mir der Anhänger zu denken ...«
Wieder entstand eine von Appelts unerträglichen Pausen.
»Wenn du nicht sofort weitersprichst, gehen mir die Nerven durch.«
»Schon gut, Max. Wollen wir den Kuchen nicht jetzt schon anschneiden, zum zweiten Frühstück? Vielleicht hebt das deine Laune.«
»Ich habe keine schlechte Laune, weil ich hungrig bin, sondern weil ich endlich vorankommen will.«
Appelt duckte sich. »Der Anhänger ist ein sehr grob und stümperhaft eingefasster Jeton ...« Pause.
»Hanno!«
»Er ist aus Gold und stammt, der Aufschrift nach, aus dem hiesigen Spielcasino.«
»Aus echtem Gold?«, fragte Lukas Decker ungläubig.
»Exakt.«
»Moment. Die spielen hier mit echten Goldjetons?«
»Nicht mehr ...« Hanno Appelt sah kurz in Gottliebs Richtung und fuhr hastig fort: »Aber früher, in den guten Zeiten, in denen die Gäste schon mittags um zwei Uhr wie beim Schlussverkauf in die Säle gestürmt sind, da hat man zu hohen Feiertagen spezielle Tische geöffnet, an denen goldene Jetons gesetzt werden konnten.«
Sonja Schöller lächelte verträumt. »Wann war das?«
»Bis Mitte oder Ende der achtziger Jahre. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Umsätze damals gemacht wurden. Da konnte man als Croupier noch reich werden.«
»Woher weißt du das alles?«
»Könnt ihr euch noch an den Fall mit dem spielsüchtigen Bankangestellten ›Hansi‹ aus der Ortenau erinnern?«
Alle bis auf Lukas Decker und Gottlieb nickten.
»Klärt ihr uns bitte auf?«, seufzte Gottlieb und schielte zum Kuchen. So ein kleines Stückchen würde in der Tat seine Nerven beruhigen. Aber jetzt ging das nicht, er würde sich ja zum Gespött seiner Leute machen. Als er noch geraucht hatte, war es einfacher gewesen, sich abzukühlen. Pausen, in denen man gierig an einer Zigarette zog, waren weitaus akzeptierter als solche, in denen man sich ein Stück saftigen, leicht karamellisierten, mit gebräunten Mandelsplittern bestreuten Apfelkuchen einverleibte.
Gottlieb nahm Decker den Plastikbeutel aus der Hand, um sich von seinen Gelüsten abzulenken.
Auf dem kleinen runden Jeton stand »Spielbank Baden-Baden« und die Zahl »20«, und im Gegensatz zu dem Goldstück wirkten die grobe Einfassung und die dünne Kette unangemessen billig.
»›Hansi von der Bank‹ war Angestellter eines Bankinstituts und hatte Mitte der neunziger Jahre Kundengelder in Millionenhöhe veruntreut, um sie im Casino zu verzocken. Weit über tausendmal war er dort und hat mit hohen Beträgen gespielt und bis zu hunderttausend Mark am Abend verloren, und die damalige Geschäftsleitung will trotz vieler Hinweise nichts davon gewusst haben, dass Hansi mit gestohlenem Geld spielte.«
Alle Kollegen hingen an Appelts Lippen.
»Das war Mitte der neunziger Jahre. Aber wer hat dir das mit den Goldjetons aus den Achtzigern erzählt?«, fragte Lukas Decker schließlich.
An Appelts Hals erschienen kreisrunde rote Flecken, die sich schnell bis zu den Ohren ausbreiteten.
»Ach, die im Fall ›Hansi‹ ermittelnden Kollegen aus Offenburg haben hier ihren Stützpunkt gehabt, da habe ich einiges aufgeschnappt.«
Gottlieb wurde das Gefühl nicht los, dass Appelt auswich. Aber warum?
»Die Kollegen haben in dem Zusammenhang auch über die achtziger Jahre ermittelt?«, bohrte er nach.
Appelts rote Flecken hatten seine Wangen erreicht. »Nicht ganz. Ich, na ja, ich kannte damals persönlich jemanden im Casino«, nuschelte er, und es sah ganz danach aus, dass es ihm peinlich war. Wer dieser Jemand wohl gewesen war? Eine Geliebte vielleicht?
Gottlieb sah seinen Stellvertreter verwundert an. Hanno ein Schwerenöter? Es war doch schon eine Sensation gewesen, dass er sich mit Sonja Schöller zusammengetan hatte. Und was hörte er jetzt?
Er begann sich auszumalen, wie dieser überkorrekte Oberbeamte vielleicht jeden Abend heimlich am Roulettetisch saß und sein Gehalt aufs Spiel setzte.
Woran erkannte man eigentlich, ob jemand spielsüchtig war?