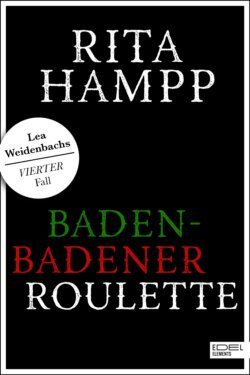Читать книгу Baden-Badener Roulette - Rita Hampp - Страница 7
ZWEI Mittwoch, 8. Juli
ОглавлениеGrübelnd saß Lea Weidenbach vor ihrem Bildschirm und versuchte, den Geräuschpegel der Redaktion auszublenden. Normalerweise gelang ihr das ohne Probleme, aber heute war es anders; sie war nervös und deshalb überempfindlich.
Ihr Schreibtisch war übersät mit Papieren und Notizzetteln, die Sensation zum Greifen nah – und doch war sie meilenweit davon entfernt, sie veröffentlichen zu dürfen, und das wurmte sie. Schließlich war es ihre Aufgabe als Reporterin des Badischen Morgens, jemanden aufzutreiben, der ihr wenigstens eine kleine offizielle Bestätigung lieferte, damit sie die Story aus dem Tümpel der Gerüchteküche reißen konnte. Aber sie fand niemanden, und es sah so aus, als würde sie für heute auf ihren geheimen Informationen sitzen bleiben und nur hoffen können, dass kein anderer Journalist in der Stadt von der Sache Wind bekam und vielleicht mehr Glück hatte als sie oder die Sensation ungeprüft veröffentlichte.
Und was für eine Sensation das war: Eine Handvoll Russen plante im Geheimen, für etliche Millionen Euro ein neues Museum in Baden-Baden zu bauen und darin Ikonen auszustellen, deren Wert den des Gebäudes um ein Vielfaches übersteigen würde. Das war an sich ein schönes Vorhaben. Was die Sache so heiß machte, waren zwei Dinge: Sie planten den Neubau ausgerechnet auf der Klosterwiese, also mitten in der allen Baden-Badenern heiligen Lichtentaler Allee, und sie knüpften an ihren Plan die Bedingung, im Gegenzug für sich und ihre weitverzweigten Familien unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigungen zu erhalten – und zwar unter sehr großzügiger Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen.
Es gab offenbar bereits Pläne, Voranfragen, Vorgespräche, Vortreffen, aber alles war top secret, auch sie hatte erst heute Morgen davon erfahren. Niemand, erst recht nicht ihre Informanten, wollte und konnte offiziell dazu Stellung nehmen. Angeblich drohten die Investoren, ihr Vorhaben im drögen Rastatt zu verwirklichen oder – schlimmer noch – den Bau direkt neben den Autobahnzubringer zu setzen, aber auf die Gemarkung der ohnehin schon viel zu reichen Nachbarstadt Sinzheim, sollte auch nur das Geringste an die Öffentlichkeit gelangen.
Lea betrachtete die Archivmeldungen über ein ähnliches Projekt, ein gigantisches Oldtimermuseum, das unter fast gleichen Vorzeichen vor einigen Jahren geplant worden und dann geplatzt war, weil die Investoren die Voraussetzungen nicht erfüllen konnten. Tatsächlich war es nach dem Gesetz möglich, eine unter Bürgern der ehemaligen Sowjetunion begehrte, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, wenn man nachweisen konnte, dass man pro Person mindestens eine viertel Million Euro investieren, mindestens fünf Arbeitsplätze schaffen sowie als Geschäftsführer dauerhaft vor Ort leben werde.
Wenn sie wenigstens herausbekommen könnte, wer die Interessenten waren. Vielleicht fand sich unter ihnen einer, der redete.
Lea schloss das Suchprogramm im Computer und stöhnte leise. Heute fühlte sie sich tatsächlich wie sechsundvierzig, ach, noch älter: antriebslos, ausgepowert, depressiv. Das lag bestimmt daran, dass sie wegen einer dummen kleinen Knöchelverletzung seit Wochen keine ordentliche Joggingrunde mehr gedreht hatte. Aber Sonntag, Sonntag würde sie wieder anfangen. Und das sogar mit ...
Wo hatte sie nur ihre Gedanken! Verdrossen schob sie den Stapel Papiere zusammen und überlegte angestrengt, wen sie noch anrufen könnte. Hoffentlich blieb die Sache wirklich geheim. Es wäre ihr persönlicher Alptraum, würde ihr jemand von der Konkurrenz zuvorkommen und die Story auch ohne die erforderlichen Absicherungen veröffentlichen.
Natürlich könnte auch sie die Bombe ins Blaue hochgehen lassen, aber es ging gegen ihre Ehre, unsaubere journalistische Arbeit abzuliefern.
Das Telefon riss sie aus ihren Überlegungen, und erneut entschlüpfte ihr ein leiser ungeduldiger Laut. Der Blick auf das Display verriet ihr, dass dies kein Anruf war, auf den sie sehnlichst wartete, im Gegenteil: Die Mobilnummer von Marie-Luise Campenhausen, ihrer Vermieterin und Vertrauten, leuchtete auf. Seit sie sich vor zwei Jahren endlich ein Handy zugelegt hatte, war die liebenswerte achtundsiebzigjährige Dame von der Telefonitis befallen, die sie sogar dann und wann ihre geheiligte Etikette vergessen und sie hemmungslos anrufen ließ, wann und wo immer ihr etwas spanisch vorkam in Baden-Baden. Sie spielte gern Hilfsdetektivin, was auch an der riesigen Menge an Krimis lag, die sie unablässig verschlang. In der Vergangenheit hatten sie deshalb schon einige Male ein hervorragendes inoffizielles Ermittlerteam abgegeben. Jetzt allerdings nervte sie.
»Verzeihen Sie bitte, ich glaube, ich rufe Sie in letzter Zeit zu oft an, Kindchen«, entschuldigte sie sich nach hastiger Begrüßung, »und ich habe lange gezögert, ob ich Sie in der Redaktion stören darf. Aber ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Es geht um meine Freundin Ingeborg ...«
Lea verdrehte die Augen. »Das ist die, die Sie gestern und vorgestern nicht erreichen konnten, nicht wahr?«
»Sie hat sich immer noch nicht gemeldet, nicht einmal gestern, als ihre Putzfrau nicht kam. Durch meine Schuld übrigens ...«
»Ich weiß, der Beinbruch.« Die Geschichte hatte sich Lea schon mehrfach anhören müssen. Allmählich wurde selbst eine noch so flotte Frau Campenhausen alt, daran war nichts zu rütteln.
»Genau. Ich habe Ihren Rat befolgt und Joseph gestern Abend noch gebeten, mich zu ihr zu fahren. Wir haben geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht. Es kann sich also um keine simple Telefonstörung handeln, wie es in Baden-Baden ja leider zur Tagesordnung gehört.«
»Vielleicht macht sie einen spontanen Kurzurlaub.«
»Nicht Ingeborg. Sie verlässt fast nie das Haus.«
»Haben Sie es bei den Nachbarn versucht?«
»Das ist es ja gerade. Die Villa links ist verwaist, und der andere Nachbar hat nichts außer einem Falschparker bemerkt.«
»Tja, also dann, Frau Campenhausen ...«
»Und Thorben, ihren Enkel, kann ich seit heute auch nicht mehr erreichen.«
Lea lehnte sich mit leiser Ungeduld in ihrem Stuhl zurück. »Sie befürchten also, dass ihr etwas zugestoßen ist. Warum informieren Sie nicht die Polizei?«
»Oh, Sie kennen Ingeborg nicht. Sie würde nie mehr ein Wort mit mir wechseln, wenn es falscher Alarm wäre. Es könnte durchaus sein, dass sie nicht ans Telefon geht, weil sie immer noch eingeschnappt ist. Vielleicht hält sie gerade ein Schläfchen oder liegt in der Wanne, und die Polizisten schlagen die Haustür ein und stürmen mit gezückter Waffe das Haus ...«
Lea musste lachen. »Jetzt geht Ihre kriminelle Phantasie aber mit Ihnen durch.«
»Meinen Sie nicht, Sie könnten den netten Herrn Gottlieb ganz privat um Hilfe bitten? Sie sind ja gut mit ihm bekannt.«
Lea lächelte. Gut bekannt war untertrieben. Max und sie waren seit zwei Jahren ein Paar, aber nur heimlich. Lediglich Frau Campenhausen wusste Bescheid, niemand in der Redaktion oder auf seiner Dienststelle durfte etwas davon wissen. Polizei und Presse – das passte nicht zusammen, das gab jede Menge beruflicher Schwierigkeiten.
Sie angelte ihr privates Handy aus dem Rucksack, drückte ein paar Tasten, bis sein Foto hochlud, das sie vor Kurzem im Elsass aufgenommen hatte: Sein gepflegter gestutzter Vollbart und die kurzen Haare waren inzwischen silbergrau geworden, seine karamellbraunen sanften Augen hinter der runden Hornbrille blitzten freundlich, und sein verlegenes Lächeln verriet, dass er sich nicht gern ablichten ließ. Aber sie hatte nicht widerstehen können, diese Aufnahme zu machen, denn es war ein himmlischer Abend gewesen. Ihr wurde warm, als sie das Bild betrachtete, dann aber drehte sie sich schuldbewusst um und vergewisserte sich, dass kein Kollege ihr über die Schulter sah. Schnell ließ sie das Handy wieder zurückgleiten.
»Sie wollen jetzt aber nicht, dass der Leiter der Mordkommission für Sie ganz privat über einen Zaun klettert, ein fremdes Grundstück betritt, ein Fenster einschlägt, in ein Haus eindringt, in dem die Besitzerin vielleicht gerade seelenruhig vor dem zu laut aufgedrehten Fernseher sitzt und einen Herzanfall erleidet, wenn sie ihn sieht?«
»Oh, wie dumm von mir. So weit hatte ich gar nicht gedacht. Das geht natürlich nicht. Aber wissen Sie was? Ich als Ingeborgs Freundin sollte das tun. Ja, genau, ich nehme gleich den Bus. Auf Wiederhören, ich melde mich dann später noch einmal.«
»Nein, Frau Campenhausen, so war das nicht gemeint. – Frau Campenhausen?«
Aufgelegt.
Halb belustigt, halb besorgt betrachtete Lea den Apparat. Frau Campenhausen war alles zuzutrauen. Was, wenn es in der Villa ihrer Freundin wirklich einen Notfall gab? In den letzten Monaten waren im Stadtgebiet mehrere wohlhabende Witwen überfallen worden. Ob sie Max vielleicht doch informieren sollte? Aber sie wusste ja nur den Vornamen dieser Freundin, und Frau Campenhausen, so stellte sie fest, als sie die Nummer zurückrufen wollte, hatte soeben ihr Handy vom Netz genommen und war »leider vorübergehend nicht erreichbar«.
***
Wolkenlockerer Biskuit, cremige Sahne, süße Früchte bestäubt mit einem Hauch von Puderzucker – das war, das war ...
»Diese Erdbeerrolle ist genau das Richtige für Ihren Einstand, Frau äh ...«, nuschelte Kriminalhauptkommissar Maximilian Gottlieb verzückt. »Selbst gebacken?«
Die neue Schreibkraft, die bisher im Raubdezernat gearbeitet hatte, nickte strahlend. »Mein Name ist übrigens ganz leicht zu merken:. Lydia Riebe. Riebe – das reimt sich auf Liebe. Da passen wir doch prima zusammen, gell, Herr Gottlieb?«
Gottlieb gab sich Mühe, sich nicht zu verschlucken. Natürlich kannte er ihren Namen, er wusste nahezu alles über sie: Vierunddreißig, geschieden, Dienstvermerk wegen Unpünktlichkeit, aber offenbar extrem effizient, wenn er der Kollegin Katz glauben konnte, und tierlieb. Ständig trieb sie sich bei der Hundestaffel herum, schäkerte mit den Kollegen, sorgte aber auch für deren vierbeinige Gefährten.
Wie aufs Stichwort war irgendwo in einem Büro oder auf dem Gang ein Fiepen zu hören, dann ein hastiges Bellen und ein leiser Fluch.
»Was ...?«
»Oh, das ist meine Ella. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich sie heute mitgebracht habe. Ich will nach Dienstschluss zu meiner Cousine ins Elsass fahren und ihr den Hund bringen. Ihr eigener ist im Herbst überfahren worden, und sie hätte so gern wieder einen. Und ich kann mich ja nur schlecht um die Kleine kümmern, wenn ich hier in der Mordkommission arbeite. Meine Vorgängerin hat mich schon unterrichtet, dass die Dienste recht unregelmäßig sein können.«
Gottlieb schnaubte. Wie viele Mordfälle hatte es denn in den letzten Jahren gegeben? Vier oder fünf. Da von unregelmäßigem Dienst zu sprechen, grenzte an Verleumdung.
Allmählich füllte sich der Aufenthaltsraum, neben den Kollegen von der kriminaltechnischen Abteilung kamen nun auch Hanno Appelt, sein pingelig-bürokratischer Stellvertreter mit nass nach vorn gekämmtem dünnen Haar und breiter Streifenkrawatte, die blondierte, dauergewellte, mütterliche, blitzgescheite Sonja Schöller mit dem sechsten Sinn, die seit einem Jahr dessen Verlobte war, und der junge, drahtige Lukas Decker, der keine Augen für die rosa-weiße Versuchung hatte, sondern mit seinem Lauf-Computer spielte und ihnen gleich mit seinen neuesten Marathonzeiten auf die Nerven gehen würde.
Alle scharten sich um die Neue, die für Gottliebs Geschmack gar nicht wie jemand aussah, der mit allen Sinnen gut und gern backte. Dazu war sie zu dünn, und ihre Fingernägel waren zu lang und zu rot, ihre Glitzerjeans zu eng, ihre Ohrringe zu auffallend und die Absätze ihrer giftgrünen Pumps zu hoch. »Streichhölzchen« würde als Spitzname für sie passen, fand er, denn auf ihrem extrem zierlichen Körper saß ein überproportional großer Kopf mit feuerroten Locken und einem kreisrunden, pfiffigen Gesicht.
Geduldig ließ sie gerade Lukas Deckers Rekorde über sich ergehen und fragte fachkundig nach, als sei sie selbst ambitionierte Läuferin. Wenn das mal gut ging.
Vorsichtig zog Gottlieb seinen Bauch ein. Lea joggte auch regelmäßig und wollte ihn nächsten Sonntag zu einer halbwegs versteckten Strecke mitnehmen, wo er quasi inkognito seine ersten Laufversuche machen sollte.
»Ausrede zwecklos«, hatte sie ihm lachend angedroht. »Ich werde Rücksicht auf deine fehlende Kondition und deine siebenundfünfzig Jahre nehmen, und wir werden nur kurze Stücke laufen und dann wieder bequem gehen. Das wird dir Spaß machen.«
Na ja. Spaß sah anders aus. Weiß und rosa zum Beispiel, wie das zweite Stück Kuchen auf seinem Teller.
Ein schauriges Jaulen schreckte alle aus ihren Gesprächen.
»Wo ist der Hund eigentlich?«, erkundigte sich Gottlieb eher beiläufig.
»In Ihrem Büro. Das war am nächsten, sorry.«
Streichhölzchen wurde zum Glühwürmchen und sprintete los, und Gottlieb legte wortlos seine erste Trainingseinheit ein.
Zu spät.
Ella saß wie ein schwarzes Häufchen Unglück mitten auf dem schönen Teppich vor seinem Schreibtisch und winselte schuldbewusst, während sich das Bächlein unter ihr immer weiter ausbreitete.
***
Marie-Luise hielt die Hand an die Krempe ihres leichten Strohhütchens und spähte durch das hohe Eisentor. Die gelbe, verspielte Villa mit den Sprossenfenstern und weißen Klappläden, Türmchen und Anbauten, der geschwungenen hochherrschaftlichen Auffahrt und dem riesigen Garten stammte aus dem Jahr 1927 und war Ingeborgs Elternhaus gewesen, in der die Familie auch den Krieg über gelebt hatte. 1952 war Ingeborg kurz nach ihrer etwas überstürzten Heirat mit Eugen Dahlmann nach Wiesbaden umgesiedelt, aber nach dem Tod ihrer Eltern wieder zurückgekehrt, weil sie sehr an dem Anwesen hing.
Marie-Luise konnte das nur zu gut verstehen. Alte Einfamilienhäuser hatten einen unverwechselbaren Charme, und manchmal haderte sie mit sich, weil sie sich entschlossen hatte, in ihrem großen Mietshaus in der Quettigstraße zu wohnen, obwohl es zwei Villen in der Stadt gab, die ihr Willi noch zu seinen Lebzeiten als Altersvorsorge gekauft hatte. Aber sie konnte eigentlich zufrieden sein: Die Räume in ihrer Wohnung waren großzügig geschnitten, und es waren immer Mieter in Reichweite, die ein Auge auf sie hatten, wie zum Beispiel die nette Lea Weidenbach.
Ingeborg hingegen hatte niemanden, nur Natascha, die dienstags kam, hin und wieder einen Gärtner und gelegentlich die Fußpflegerin, einen Nachbarn, dem sie aus gutem Grund aus dem Weg ging, und natürlich Thorben, der sie aber nur besuchte, wenn er Geld brauchte. Noch nie hatte Marie-Luise ihre Freundin über weitere Kontakte reden hören, und das war eigentlich verständlich, denn es war manchmal wirklich etwas mühsam mit ihr. Sie schnappte leicht ein, wusste alles besser und hatte in letzter Zeit oft einen quälenden Pessimismus an den Tag gelegt. Trotzdem. Sie waren Freundinnen seit der Schulzeit. Da gehörte es sich, gegenseitig nach dem Rechten zu sehen, wenn der Verdacht bestand, dass eine von ihnen Hilfe brauchte.
Marie-Luise betätigte die Glocke ein zweites Mal und drückte vorsichtig gegen die Eisenstäbe, darauf bedacht, ihre weißen Häkelhandschuhe nicht zu ruinieren, die sich gerade bei großer Hitze angenehm bewährten. Sie hatte letzte Woche ein neues Paar kaufen wollen und erfahren müssen, dass sie aus der Mode gekommen waren und nicht mehr hergestellt wurden.
Nichts rührte sich.
So kam sie nicht weiter. So hatte sie gestern mit Joseph auch schon am Zaun gestanden. Sie warf einen schnellen Blick zum Nachbargrundstück links. Alles verrammelt, vor allem das hohe Einfahrtstor. Russen hatten das Anwesen vor drei Jahren für zwei Komma sechs Millionen gekauft – in bar, wie es hieß – und nutzten es lediglich ein, zwei Wochen im Jahr als Feriendomizil oder wenn sie eine aufwendige Zahnbehandlung oder eine Schönheitsoperation brauchten.
Blieb also der Nachbar zur Rechten. Er pflegte genau wie Joseph seit Jahrzehnten seine festen Rituale und war, wie sie von Ingeborg wusste, um diese Uhrzeit mit dem Hund unterwegs. Das Tor seiner Einfahrt fehlte; offenbar wurde es ausgetauscht, wie auch der Pflasterbelag ganz neu war. Eine bessere Gelegenheit gab es nicht.
Ein paar Schritte, schon war sie an seinem Haus vorbei und suchte sich ihren Weg zwischen einem alten Kirschlorbeer und einem mächtigen Eibenbusch in das mit Unkraut zugewucherte Grenzbeet, in dem sich offenbar Katzen einen Pfad gebahnt hatten. Sie fand die unscheinbare, verrostete niedrige Pforte im freistehenden Zaun sofort und war ganz stolz darauf, denn immerhin hatte Ingeborg ihr von der Existenz dieser Geheimtür berichtet, als sie siebzehn gewesen war. Ja, auf ihr Gedächtnis war immer noch Verlass, auch wenn Lea Weidenbach neuerdings manchmal ungeduldig Luft holte, wenn sie ihr etwas erzählen wollte. Was sie dann dermaßen verunsicherte, dass sie gleich noch einmal von vorn anfing, obwohl sie im selben Moment merkte, dass sie sich wiederholte und viel zu ausschweifend wurde. Ach, alt werden war kein Zuckerschlecken, wahrlich nicht.
Eigentlich hatte Marie-Luise befürchtet, die Pforte verschlossen vorzufinden und darüberklettern zu müssen, aber zu ihrer Überraschung schwang das Törchen ohne Widerstand auf, ja, es quietschte nicht einmal. Als hätte es jemand vor Kurzem geölt. Aber wer sollte das getan haben? Nein, nein, das war eben noch gute alte Wertarbeit.
Der Abstand zur Bepflanzung reichte, um das Törchen bequem zu öffnen und hindurchzuschlüpfen, dann musste sie sich auf Ingeborgs Seite an einer stacheligen Fichte und einem mächtigen Rhododendron vorbeischlängeln, und schon stand sie auf dem weitläufigen Rasen. Kein Liegestuhl, wie Joseph spekuliert hatte, keine Ingeborg im Schatten außerhalb der Hörweite von Klingel und Telefon. Still lag das Haus da, fast gespenstisch.
Eine Amsel setzte sich wie eine Wächterin auf den Dachfirst und stimmte ein Begrüßungs- oder Warnlied an. Hinten im Gebüsch raschelte etwas, dann hüpfte ein Eichhörnchen über das Gras und kletterte behände den schiefen Stamm eines vergreisten Birnbaums hinauf.
»Ingeborg? Hallo?«, versuchte es Marie-Luise ohne viel Hoffnung.
Schweigen.
Unschlüssig blieb sie stehen. Obwohl die Sonne schier unerträglich auf die Rückseite der Villa brannte, waren die Läden offen, die Fenster hingegen geschlossen. Im Wohnzimmer war der schwere Vorhang aufgezogen, trotzdem konnte man durch die dichte Gardine so gut wie nichts erkennen.
Bei näherem Betrachten war jedoch der Rahmen der Terrassentür, die zur Küche führte, gesplittert, und ein Sprossenfeld hatte einen Sprung.
»Ingeborg?«
Selbst die Vögel verstummten, ebenso der Rasenmäher irgendwo in der Ferne.
Marie-Luise klopfte gegen den kaputten Türrahmen, erst vorsichtig, dann heftiger, drückte dagegen, dann drehte sie sich um und gab der Tür ganz undamenhaft mit dem Hinterteil einen Schubs Mit einem hässlichen Knirschen gab die beschädigte Tür nach. Um Gottes willen, was hatte sie getan? Konnte sie dafür belangt werden?
Nun, wo die Tür schon fast von allein nachgegeben hatte, konnte sie sie auch vorsichtig noch etwas weiter aufdrücken.
»Ingeborg!«
Jetzt könnte sie wirklich langsam antworten. Doch im Haus war es totenstill, kein Radio, kein Fernseher, der als Entschuldigung für Ingeborgs plötzliche Taubheit herhalten konnte. Und wenn Frau Weidenbach recht hatte und Ingeborg einen Ausflug machte? Vielleicht mit Thorben? Dann würde es etwas schwierig werden, diese Situation hier zu erklären.
Marie-Luise brach der Schweiß aus, was sie nicht leiden konnte. Seufzend holte sie ein frisches Stofftaschentuch aus ihrer Kostümjacke und tupfte sich damit die Stirn ab. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Vielleicht doch besser gehen und abwarten? Vielleicht lag morgen schon eine Ansichtskarte in ihrem Briefkasten.
Und trotzdem. Das war doch alles sehr merkwürdig hier.
Sie ging langsam durch die Küche und sah sich aufmerksam um. Es roch muffelig, als gammele seit Tagen Biomüll unter der Spüle. Auf dem Herd stand eine Pfanne mit den vertrockneten Überresten von etwas, das nach Rührei oder Haferbrei aussah. Auf dem Küchentisch standen sechs Tablettenboxen, für jeden Tag eine. Ingeborg richtete sich jeden Sonntagabend ihre Wochenration, seit vielen Jahren schon. Darin war sie pingelig. Es fehlte nur der Montag.
Eine böse Ahnung ergriff Marie-Luise wie ein hungriges Tier und nagte in ihrem Magen. Sie sollte die Polizei rufen, jetzt, sofort! Dies hier war doch Beweis genug, dass etwas nicht stimmte.
Aber sie konnte nicht anders, sie wollte sich mit eigenen Augen überzeugen. Bebend schlich sie weiter in die Eingangshalle. Auch hier war alles ruhig, wenn es auch sehr unangenehm roch. Marie-Luise hielt sich das Taschentuch vor die Nase. Das einzig Auffallende war vielleicht, dass die opulente Ming-Vase auf der antiken Kommode fehlte. An deren Platz hatte Ingeborg eine moderne, grellbunte Keramik gestellt, die wie ein Gockel mit zu langem Hals und zu kurzen Beinen aussah.
»Na ja«, murmelte Marie-Luise abschätzig, während sie sich wie in Zeitlupe der Wohnzimmertür näherte und sich unwillkürlich das Taschentuch noch fester vors Gesicht presste. Es roch ganz abscheulich hier, um nicht zu sagen entsetzlich faulig.
»Ingeborg?«, versuchte sie es ein letztes Mal und erschrak über das ängstliche Piepsen in ihrer Stimme.
Sie musste allen Mut zusammennehmen. Noch ein Schritt. Als Erstes fiel ihr Blick auf den Tisch mit den Notfalltropfen und einer Konfektschale, dann ...
»Ingeborg! Um Himmels willen!«
Die Gestalt, und als etwas anderes konnte man das Wesen in Ingeborgs weitem rosa Sommerkleid nicht mehr bezeichnen, lag reglos auf der geblümten breiten Couch, bäuchlings, die Füße ebenso mit rotem Klebeband gefesselt wie ihre Hände, die auf dem Rücken zusammengebunden waren. Das Gesicht war seitwärts zum Couchtisch gewandt, auch auf dem Mund klebte ein roter Streifen, aber das war es nicht, was Marie-Luise schier den Verstand raubte.
Überall in dem Gesicht wimmelte es. Maden krabbelten aus den Augenhöhlen, den Nasenlöchern, den Ohrmuscheln. Die Gesichtszüge waren zur Unkenntlichkeit aufgedunsen, die Haut hatte ihre natürliche Farbe verloren und schimmerte grün-bräunlich.
Marie-Luise schloss die Augen und drehte sich würgend um, doch es war bereits zu spät: Dieses Bild hatte sich in ihr Gedächtnis eingebrannt, und sie wusste, dass sie es nie mehr im Leben loswerden würde.
In ihrer Brust entflammte ein tiefer Schmerz, der immer größer wurde und drohte, sie zu zerreißen.
Wie in Trance öffnete sie ihre Handtasche und suchte nach ihrem Beruhigungsmittel, dabei glitt ihr das Mobiltelefon in die Hand, und ohne nachzudenken, schaltete sie es ein und drückte auf Wahlwiederholung.