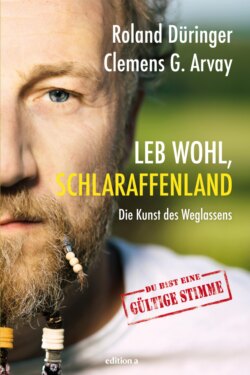Читать книгу Leb wohl, Schlaraffenland - Roland Düringer - Страница 11
Sinn im Leben
ОглавлениеClemens G. Arvay: Wir haben als Einzelpersonen eben beschränkte Möglichkeiten, wir können nicht die ganze Welt retten.
Roland Düringer: Das ist der springende Punkt: Viele glauben, sie müssten die Welt retten und schmieden gute Pläne, wie das gehen könnte. Sie haben Konzepte und Ideen dafür, gründen Vereine, vielleicht auch Parteien, Bewegungen. Ich aber glaube, dass kein Mensch auf die Welt kommt, um diese zu „retten“. Manche glauben natürlich auch, wir kämen auf die Welt, um uns selbst zu retten, um unsere Seele, unseren Geist zu retten. Wenn ich in meinem kleinen Umfeld einiges bewegen kann, wenn ich Sinn stiften kann in verschiedenen Bereichen, dann habe ich eigentlich die Welt gerettet. Denn was ist schon die Welt? Angeblich wissen wir das heutzutage: Seit jemand von oben ein Foto von unserem Planeten Erde gemacht hat, sehen wir zum Beispiel, dass die Erde rund ist, dass sie annähernd eine Kugel ist. Jeder von uns kann heutzutage in einem elektronischen Gerät nachsehen, was auf der anderen Seite der Erde passiert, wie es dort aussieht, das ist alles kein Problem mehr. Unsere Welt ist für uns also gleichbedeutend mit dem Planeten Erde, geht aber, wie mittlerweile ja bekannt, weit darüber hinaus. Immerhin waren ja schon Menschen auf dem Mond und wollen bis zum Mars und noch weiter. Wir wissen, dass es andere, fremde Galaxien gibt. Das sind für uns noch relativ neue Dinge. Die Lebenswirklichkeit des Menschen war aber schon immer seine eigene Umgebung. Wie weit ist man früher zu Fuß gekommen? Der Ort, in dem ich wohne, ist von Wien vielleicht 40 Kilometer entfernt. Der inzwischen verstorbene Opa meines Nachbarn und die Oma, die noch lebt, waren dennoch nicht öfter in Wien, als ihre Hände Finger zählen.
Ich bin mir sicher, dass ich hier in der Umgebung Menschen finde, die noch nie in Wien waren, weil es in ihrem Leben nicht notwendig war, dort zu sein. Das heißt, ihre Welt ist eigentlich die kleine Region, in der wir hier leben, und das war früher völlig normal. Du warst vielleicht in einem Tal aufgewachsen, wusstest, dass es hinter den Bergen weiterging, es war für dich aber nicht wirklich relevant. Sicher gab es immer Menschen, die über die Berge wanderten und etwas suchten, die weiter gingen als andere. Das sind die, über die uns die Geschichtsschreibung berichtet. Aber für einen durchschnittlichen Menschen hörte die Welt dort auf, wo eigentlich die Grenzen seines persönlichen Lebensumfeldes waren, die Grenzen seiner Erreichbarkeit. Und daran ist nichts Schlechtes.
Was die Welt ist, die wir retten wollen, ist also relativ.
Clemens G. Arvay: Es gibt offensichtlich seit dem Übergang der 1970er-Jahre in die 1980er-Jahre einen drastischen gesellschaftlichen Wandel, nämlich was die Lebenswerte betrifft. Zwischen 1966 und 2002 gab es in den USA eine mehrere Jahrzehnte andauernde Umfrage unter Studentinnen und Studenten, um herauszufinden, was ihnen im Leben wichtig war, was sie also als wesentlich für das eigene Leben beurteilten. Wenn man sich das Ergebnis dieser Umfrage ansieht, stellt man deutliche Veränderungen im Laufe der Zeit fest. Am Beginn der Studie war es für die meisten, nämlich für mehr als 80 Prozent, besonders wichtig, eine bedeutungsvolle Lebensphilosophie zu entwickeln. Für den geringeren Teil war es entscheidend, finanziell sehr gut aufgestellt zu sein und viel Geld zu verdienen. Dann begannen sich diese Einstellungen allmählich zu verändern. Im Jahre 1977 hielten sich die Angaben exakt die Waage: Viel Geld zu verdienen und die bedeutende Lebensphilosophie waren den Befragten in etwa gleich wichtig. Bis zur Mitte der Neunzigerjahre drehte sich das ursprüngliche Verhältnis dann um. Seither – und die Studie wurde bis 2002 fortgesetzt – spielt der finanzielle Status für den größten Teil der Studenten, nämlich für etwa 75 Prozent, die herausragende Rolle und nur mehr circa 40 Prozent gaben an, dass ihnen eine bedeutende Lebensphilosophie ein Anliegen sei5.
Meiner Meinung nach sagt das sehr viel aus und ich wundere mich eigentlich, wenn ich mir diese Entwicklung ansehe, nicht mehr darüber, dass die Lebensphilosophie, das „gute Leben“, gesellschaftlich betrachtet spürbar in den Hintergrund getreten ist. Diese Ausrichtung von immer mehr Menschen auf materiellen Erfolg ist in unserer Welt stark präsent.
Roland Düringer: Diese Tendenz habe ich auch beobachtet. Ich selbst bin ja im Jahr 1963 geboren und daher ein Kind der Zeit, in der sich die Werte laut dieser Statistik in den Siebzigerjahren völlig umgedreht haben. Ab da ging es mit dem Wunsch, finanziell besser aufgestellt zu sein, stark bergauf. Das Entscheidende war, dass man einmal materiell besser dastehen wollte, das hörte ich auch von meinen Eltern immer wieder: „Du sollst es einmal besser haben als wir.“ Mit „besser haben“ war immer gemeint, mehr zu besitzen, weil wir „mehr“ und „besser“ sehr leicht miteinander verwechseln. Natürlich hat meine Generation jetzt mehr: Mehr Stress, mehr Schulden, mehr seelisches Leid, mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mehr chronische Krankheiten und natürlich viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Zu viele Entscheidungsmöglichkeiten, die unsere Köpfe so richtig rauchen lassen.
Wir wissen, dass drei mehr als zwei ist, was auch völlig korrekt ist. Falsch wird die Rechnung erst, wenn man glaubt, dass drei auch besser als zwei sei und genau in diesem Wahn stecken wir momentan. Diese Sichtweise relativiert sich aber rasch: Bei Ohrfeigen zum Beispiel. Bei einer wirklich „festen Fotz’n“ – so würde man in Wien sagen – reicht eine einzige durchaus aus, da brauche ich nicht drei davon.
Heute lautet das Prinzip: „Mehr ist besser. Vor allem mehr Geld ist besser.“ Wir haben mehr Geld, alle, die gesamte Welt hat mehr Geld als jemals zuvor. Geht es uns deswegen wirklich besser? Die Leute schreien nach mehr Geld und sie bekommen mehr Geld, weil dieses Geld ja relativ einfach gemacht werden kann. Irgendjemand tippt Zahlen in einen Computer und dabei wird Geld „erschaffen“, das es vorher nicht gegeben hat. Virtuelles Geld. Das heißt, es gibt mehr Geld, nur macht das keinen Sinn mehr. Auch, wenn ich mir für unser Geld immer weniger kaufen kann, wenn ich also stetig weniger dafür bekomme, hat es keinen Sinn, mehr von dem Geld zu besitzen, denn wenn ich mit dem Mehr einer gewissen Sache letztendlich weniger von dem bekomme, was ich wirklich brauche, um gut zu leben, dann ist das ein vollkommener Unsinn. So ist es, wie ich glaube, in sehr vielen Bereichen des Lebens passiert. Wir haben das Gefühl für das richtige Maß verloren, für den Punkt, ab dem es genug ist und wo man sagen kann: „Gut, alles, was jetzt darüber hinausgeht, ist nicht mehr sinnvoll, ist schlecht.“
Bis zu einem gewissen Grad ist eine stetige Steigerung natürlich ein Gewinn. Ab einem gewissen Punkt kann sie hingegen sogar schädlich werden. In manchen Fällen ist die Steigerung zwar nicht schädlich, aber einfach nur sinnlos, zum Beispiel in einem Wirtshaus. Wenn ich dort fünf Euro eingesteckt habe, dann reicht das für ein Getränk. Wenn ich 25 Euro eingesteckt habe, reicht es für ein Getränk und etwas zu essen. Wenn ich 50 Euro dabeihabe, kann ich schon wirklich sehr, sehr gut essen und kann mir einiges leisten.
Wenn ich fürs Wirtshaus 200 Euro eingesteckt habe, kann ich sogar jemanden einladen. Wenn ich aber 5000 Euro ins Wirtshaus mitnehme, dann ist das völlig sinnlos. Ich kann damit nicht mehr machen, dann habe ich einfach nur mehr Angst, dass mir dieses Geld jemand wegnehmen könnte.
Wenn ich eine Million Euro eingesteckt habe, dann kann ich natürlich das ganze Haus samt Wirtshaus kaufen, obwohl ich ja eigentlich nur ein gutes Essen wollte.