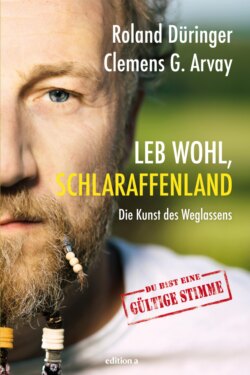Читать книгу Leb wohl, Schlaraffenland - Roland Düringer - Страница 7
Das gute Leben
ОглавлениеClemens G. Arvay: William James, Begründer der modernen wissenschaftlichen Psychologie und einer der einflussreichsten Philosophen der Vereinigten Staaten von Amerika, schrieb bereits 1902: „Glücklich zu werden, glücklich zu bleiben und Glück wiederzugewinnen, ist tatsächlich für fast jeden Menschen das geheime Motiv für alles, was er tut.“ Welche Rolle spielen Glück und Glücklichsein in deinem eigenen Leben und Schaffen?
Roland Düringer: Ich würde es gar nicht Glück nennen, denn das bekommt dann sofort diesen Beigeschmack, als wäre jemand anderer dafür verantwortlich, zumindest manchmal, ein bisschen. Glück kann man zum Beispiel in einer bestimmten Situation haben: „Na, da habe ich aber Glück gehabt!“ Es kann zum Beispiel Glück sein, wenn mir irgendetwas erspart bleibt. Wenn ich mit dem Motorrad fahre und nicht stürze, ist es oft Glück.
Manche erwarten auch von einem anderen Menschen, dass er sie glücklich macht. Das Unpassendste, das man jemandem sagen kann, den man liebt, ist: „Du machst mich glücklich.“ So hängt man ihm eine furchtbare Verantwortung um. Was geschieht, wenn dieser Mensch die Erwartungen nicht mehr erfüllt? Dann beginnt man womöglich, ihn abzulehnen, weil er plötzlich nicht mehr glücklich macht.
Ich bin nicht auf der Suche nach dem Glück, sondern – so, wie vermutlich viele Menschen – nach einem guten Leben. Das Schöne daran ist, dass es für jeden etwas anderes bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Daher suchen ja auch nicht alle dasselbe. Gott sei Dank, sonst müsste man ja um das gute Leben kämpfen. (lacht)
Ein gutes Leben ist für mich viel mehr und umfassender als bloß Glück zu haben. Zu einem guten Leben gehört, dass man manchmal mit dem Motorrad auch stürzt. Wenn man das einigermaßen übersteht, kann man daraus sehr viel lernen, weil man dann weiß, wie es ist, zu stürzen. Ein gutes Leben ist für mich daher nicht zwingend ein stets nur glückliches Leben. Ein gutes Leben macht manchmal glücklich, dann auch wieder unglücklich, aber es ist eben dennoch ein gutes Leben. Stetig Unglück zu haben ist natürlich kein gutes Leben.
In diesem Punkt hat sich meine Sichtweise in den letzten Jahren sehr verändert. Die Frage „Was ist ein gutes Leben?“ beantworte ich heute anders als früher. Nachdem ich mich vor mehr als 30 Jahren entschlossen hatte, den Beruf zu ergreifen, den ich heute noch ausübe, war für mich ganz klar, was ein gutes Leben ist: Gut zu leben bedeutete für mich damals, auf der Bühne erfolgreich zu sein, ein applaudierendes Publikum zu haben. Es bedeutete, von vielen Menschen gerne im TV gesehen zu werden oder dass viele Zuseher in die Kinosäle strömten, wenn es einen Film mit mir zu sehen gab. Ich glaubte, in der Presse von Journalisten gelobt zu werden, führe zu einem guten Leben, auf der Straße erkannt zu werden, freundlich begrüßt zu werden. Das waren meine Vorstellungen vom guten Leben, die relativ lange anhielten. In dieser Phase verdiente ich viel Geld – und zwar auf eine sehr einfache Art und Weise, indem ich nämlich schlichtweg das tat, was mir am meisten Spaß machte: schauspielen. Rückblickend kann ich behaupten, dass dies eher „Glück“ war, dass ich also in einer glücklichen Lage war, mit der Tätigkeit Geld zu verdienen, die ich gerne ausübte und die ich auch dann fortgesetzt hätte, wenn ich dafür hätte bezahlen müssen.
Vor dieser Zeit hatte ich tatsächlich bezahlt, um meinen Beruf ausüben zu können. Ich musste nämlich zuerst einem sogenannten „Brotberuf“ nachgehen, um es mir leisten zu können, auf einer Bühne zu stehen und vor einer Handvoll Zusehern das zu sagen, was zu sagen mir wichtig war. Neben dem Schauspiel fuhr ich also mit einem Lieferwagen. Das war das, was ich konnte: Auto fahren. Ich arbeitete im Lager einer Handelsfirma und lieferte 30 Stunden pro Woche kleine Elektronikbauteile aus. Abends spielte ich manchmal Theater. Am Anfang hatten wir mit unserer Kabarettgruppe „Schlabarett“ im Schnitt geschätzte sieben Zuseher, an Wochenenden manchmal fünfzehn, weil wir dann acht Verwandte mit hineinzerrten. Irgendwann bemerkten wir, dass wir, wenn wir sehr sparsam lebten, vom Theaterspielen über die Runden kommen konnten. Dann wagte ich den Schritt und sagte mir selbst: „Ich höre auf zu arbeiten, ich lebe jetzt wirklich von der Kunst, oder besser gesagt von meiner künstlerischen Tätigkeit.“ Das war zur Mitte der Achtzigerjahre.
Dass ich diese Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte, war eben Glück, denn in dieser Situation sind sehr wenige Menschen. Ich glaube sogar, dass für viele durch ihren Arbeitsplatz mehr Leid als Freude entsteht.
Es ist doch wirklich eine unglaubliche Gnade, etwas zu tun, das man sehr gerne tut und worüber man sagt: „Ich will genau das, ich möchte nichts anderes, mir ist es aber völlig egal, wie viel Geld ich damit verdiene. Ich möchte gerade so viel haben, um durchzukommen und überleben zu können.“ Das hätte schon genügt und darin besteht ja im Grunde bereits das gute Leben. Als aber dann ganz plötzlich wirklich irrsinnig viel Geld in meine Kasse floss, weil sich immer mehr Menschen für das, was ich tat, zu interessieren begannen, war mein gutes Leben nicht mehr nur, das zu tun, was ich gerne tat, sondern noch dazu, mir alles kaufen zu können, was ich wollte. Ich fing an, mehr zu kaufen, als ich brauchte, und sogar mehr, als man wollen kann, aus dem einfachen Grund, dass ich die finanziellen Mittel dazu hatte. Irgendwann standen 30 Autos bei mir zu Hause – das geht weit übers Wollen hinaus. Vom Brauchen ganz zu schweigen.
Schon bald bemerkte ich, dass ich, nachdem ich mir irgendein neues Auto gekauft hatte – eine Corvette oder eine Dodge Viper, einen sogenannten „Traumsportwagen“ – letztlich nicht mehr Freude daran hatte als viele Jahre davor, als ich mir ein Paar Turnschuhe gekauft hatte. Das war eigentlich genau das gleiche Glückserlebnis, aber der Überfluss war ein Teil meines Lebens geworden und entsprach dem, was ich damals als gutes Leben empfand. Ich konnte alles haben, was ich wollte.
Irgendwann fing der Überfluss an, mir zu wenig zu sein. Interessanterweise deshalb, weil ich bemerkt hatte, dass ich mich eigentlich sehr mit äußerlichen Dingen beschäftigte, die keine echte Befriedigung darstellten. Ich konnte all das Materielle gar nicht benutzen, weil ich keine Zeit dafür hatte. Ich war ausgelastet durch meine künstlerische Arbeit, die vielen Auftritte – bis zu sechs mal pro Woche – durch das Drehen von Filmen, aber auch durch das Kaufen von Dingen, die ich nicht nutzen konnte, weil mir ja wie gesagt die Zeit dazu fehlte.
Ich begab mich dann erneut auf die Suche. Es war nicht so, dass ich mir dachte „ab jetzt ändere ich mein Leben“, sondern ich stellte mir die Frage, ob meine Vorstellungen vom guten Leben nicht vielleicht Irrtümer gewesen waren – ob es da nicht mehr gab. Inzwischen hat sich für mich herausgestellt, dass weniger mehr ist. Meine Sichtweise eines guten Lebens hat sich bis in die Gegenwart sehr verändert und sie wandelt sich noch immer. Wenn man mir heute, am 5. Juli 2013, die Frage stellt, wie man ein gutes Leben führt, antworte ich:
Ein gutes Leben hat man dann, wenn man an das Leben selbst wenige Ansprüche stellt – oder besser gesagt, nicht ans Leben, sondern an die eigene Lebensgeschichte. Ist es nicht schon ein Denkfehler, zu glauben, dass man ein Leben hat? Ist es nicht vielmehr so, dass wir ein Leben sind? Wenn man also mit wenig sehr gut auskommt, mit wenig zufrieden sein kann, seine Lebensgeschichte nicht über das Haben sondern über das Sein definiert, und daher auch wenig Ungeliebtes tun muss, um eine schöne Lebensgeschichte zu schreiben, dann ist es ein gutes Leben.
Für meine eigene Vergangenheit stimmt diese Definition nicht ganz, da ich ja für den materiellen Überfluss und die Anerkennung nicht viel Ungeliebtes tun musste, außer Zeit zu investieren. Die Leistung selbst, das Schauspielen, ist mir gewissermaßen in den Schoß gefallen. Es liegt mir ganz einfach und es fiel mir immer sehr, sehr leicht. Ich sagte niemals: „Jetzt muss ich mich da reinhängen, das muss noch besser werden. Ich muss und muss und muss …“ Ich tat es einfach, weil ich es konnte. Erst vor ein paar Jahren fing ich an, über Reduktion nachzudenken: „Okay, ich spiele nicht mehr sechsmal pro Woche Theater, sondern nur mehr dreimal. Ich spiele im Sommer gar nicht mehr und drehe in den Sommermonaten keine Filme. Ich verbringe mehr Zeit für mich und mit meiner Familie.“ Bereits das war eine bedeutende Reduktion, da somit von meinen finanziellen Einnahmen ein großer Teil wegfiel. Ich musste zwangsläufig auch das Materielle reduzieren, das wiederum nichts anderes als Luxus war. Wenn man auf Luxus verzichtet, fällt ja nichts weg, was wirklich Einfluss auf das gute Leben hat.
Nachdem mein Weg der Reduktion ein freiwillig gewählter ist, kann man ihn auch gerne als ein Experiment bezeichnen, das ich an mir selbst durchführe.