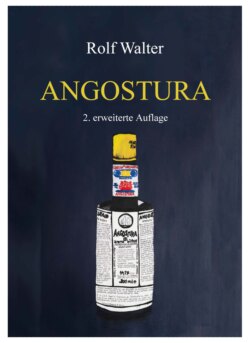Читать книгу Angostura - Rolf Walter - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHeimweh Ben Siegerts beim Gedanken an das ferne Schlesien
Die lange Wanderung durchs „Tränenthal“, wieder Licht am Horizont und Briefverkehr ab 1832
Benjamin Siegert war wirtschaftlich und gesellschaftlich bisher alles gut gelungen. Doch nun meldete sich auch die bittere Reue über seinen Bruch mit dem ältesten Bruder, und dadurch in gewisser Weise mit der Heimat. Er hatte in all den Jahren nichts mehr von sich hören lassen und seinen Geschwistern überhaupt nicht mehr geschrieben. An ihm nagte lange Jahre eine quälende Selbsterniedrigung, an der er nicht schuldlos war. Dies blieb das Schlimme, der Schmerz, das Niederschmetternde. Andererseits wurde ihm bei kritischer Betrachtung der eigenen Biografie immer deutlicher, dass aus Erniedrigung so etwas wie individuelle Größe erwachsen kann. In dieser Phase befand er sich nach einem Dutzend Jahren in Angostura. Dennoch fand er nicht selbst die Motivation, den ersten Schritt zu tun – ihn erreichte die Todesnachricht seiner Mutter – aber er nutzte die ihm aufgezeigte Chance und antwortete auf das Schreiben. Sein Lebensweg führte unverkennbar aufwärts. Das gab ihm die Kraft, sich mitzuteilen und aus dieser Stärke heraus tätige Nächstenliebe zu pflegen. Am 30. Juli 1832 fasste er sich ein Herz und wandte sich mit einem Brief an seine Schwester Friederike Pretzel in Saabor, die inzwischen selbst Witwe war. Der Inhalt zeugt von der abgrundtiefen Scham und dem unsagbaren Leid, das er empfand, und bringt die seit seiner Emigration verinnerlichte Betroffenheit jäh zum Ausdruck. Es war ihm ein elementares Anliegen, sich für das Geschehene zu entschuldigen, was vor dem Hintergrund der allgemeinen gesellschaftlichen Ehrhaftigkeit eigentlich nicht mehr möglich erschien. Aber als bibelkundiger aufgeklärter lutherischer Christenmensch – und nicht nur als solcher – kannte er auch Formen der Gnade, Demut, Nachsicht, Verzeihung, der Abbitte, der tätigen Reue, Bescheidenheit und Ausdrucksformen der Glaubwürdigkeit durch Entsagung. Durch den unvermuteten Brief seiner Schwester und seine liebenswürdige couragierte Beantwortung mag ihm ein Stein vom Herzen gefallen und etwas Ruhe in sein jahrelang aufgewühltes Herz und seine Seele gekommen sein. Schlimme, melancholische Phasen lagen hinter ihm. Er berichtet Ende Juli 1832 eingehend über dieses Aufgekratzt-Sein, das „Tränenthal“, das seine Familie wegen seiner Abreise sicherlich hatte erleiden müssen, genau wie er es nun wegen der Todesnachrichten aus der Heimat durchschritt und aufrichtige Trauerarbeit leisten musste:
„Innigst geliebte Schwester,
welche unaussprechliche Freude nach so langen Jahren meiner Abwesenheit aus dem geliebten dt Vaterlande und gänzlicher Trennung der Meinigen endlich einen Brief von meiner Familie, von einer geliebten Schwester, so fast ganz unverhofft zu sehen! Am 12.ten des Monats war es, wo ich Dein so wertes Schreiben vom 2.ten Dezember vergangenen Jahres empfing. Ach! Schon beim ersten Anblick desselben konnte ich die schmerzlichen Gefühle nicht unterdrücken, die sich meiner bei so unangenehmen Erinnerungen an die Vergangenheit sobald bemächtigten, und die Ahnung, traurige Nachrichten daraus zu schöpfen, liessen mich überdies nur mit weinenden Augen und stark klopfendem Herzen den Brief erbrechen. Oh! Wie plötzlich war ich dann auch nun von der Wahrheit meiner schlimmen Vorgefühle durch seinen Inhalt überzeugt. - Die Anzeige von dem Tode meiner alten, guten und zärtlichst geliebten Mutter, der ich bestimmt so manche unruhige und quälende Augenblicke und Stunden durch meine jugendliche Übereilung veranlasst haben werde, ohne zu wissen, ob sie vor ihrem Scheiden aus diesem Tränenthale zur ewigen Ruhe mir meine begangenen Fehler und Vergehungen grossmütig verziehen haben wird und mir ihren letzten mütterlichen Segen noch hat zukommen lassen, war und ist für mich der grösste Dolchstich ins Herz! - Viele Tränen habe ich bereits um sie vergossen, aber nie kann ich genug vergiessen, denn dieser Verlust ist unersetzlich, und das Bewußtsein, so undankbar an ihr gehandelt zu haben, veranlassen mir fortdauernd die härtesten Vorwürfe, welche auch … trotz aller philos.en Überlegungen mich öfters [in] melancholische Stimmungen [zu setzen] vermögen.
Denselben Tage noch, als ich Deinen Brief erhielt, liess ich alle Vorbereitungen treffen, um am nächsten Tage mir, meiner lieben Frau, die gehörige Trauer anzulegen, welche ich ein ganzes Jahr hindurch mir vorgenommen habe zu beachten.“ 69
Der Brief brachte Ben Todesnachrichten, die er insgeheim befürchtet haben wird. Nun aber mit der entsetzlichen Nachricht endgültig konfrontiert zu werden, entzog ihm fast den Boden unter den Füßen. Sowohl die „alte, gute und zärtlichst geliebte Mutter“ als auch der zweitälteste Bruder Gottfried waren inzwischen verstorben.9 Er bedauert zutiefst die Qual und das Leid, das er durch sein undankbares Handeln über sie gebracht hatte. Ben klingt in dem Moment zermürbt und fassungslos, sicher am meisten über sich selbst. Gleichzeitig charakterisiert sein soziales Verhalten, dass er sich in dem Brief nach der Familie und den Kindern sowie den Vermögensverhältnissen des verstorbenen Bruders erkundigt und zukünftige Unterstützung anbietet, die er später wahrhaftig auch erfüllt.
Er bittet Friederike reumütig um Vermittlung mit dem Bruder Johann in Halberstadt, an welchen direkt zu schreiben er sich scheut. Offenbar zu tief und schmerzvoll, unüberwindlich scheinend, sitzen 1832 noch die Scham und das Schuldgefühl über die entwendeten 100 Taler. Erst jetzt kommt allmählich ein leidenschaftlicher Briefwechsel in Gang, zunächst mit seinem ihm im Alter am nächsten stehenden Bruder Carl in Tarnowitz und schließlich auch mit den Brüdern in Halberstadt. Am emotionalsten erfasste ihn jedoch permanent das Versöhnungsbegehren mit dem Sanitätsrat Johann Christoph. Er fleht förmlich um dessen Nachsicht und Vergebung. Er möchte gern alles wiedergutmachen, und es geht ihm ja selbst materiell mehr als zufriedenstellend, mental jedoch keineswegs.
Seine jährlichen Einnahmen gibt er mit etwa 7500 Dollar an, eine in der damaligen Zeit sehr hohe Summe. Er schreibt: „Ich lebe hier auf dem bestmöglichsten Fusse und lasse durch gute Pflege meinem Körper nicht das Geringste abgehen, wodurch ich meine Gesundheit zu erhalten glaube.“70 Denn er hatte eine Vorliebe für gutes Essen wohl von seinem Vater geerbt, der ja in Liegnitz auf der Ritter-Akademie Küchenmeister gewesen war. So hat er sich später oft aus Tarnowitz im fernen Schlesien von seiner Nichte Emilie, verheiratete Böhm, gepökelte und geräucherte Schinken schicken lassen. Er schreibt anfangs recht wehmütige Briefe an seine Geschwister, denn die Wiederversöhnung mit seinem Bruder Johann liegt ihm schwer am Herzen. Er sandte auch oft Goldmünzen an die lieben Verwandten und deren Nachkommen sowie Zigarren und Tabak für seine Brüder. Die Qualität des venezolanischen Tabaks war auf der Welt bekannt. Emilie hatte wohl im Auftrag 2000 Stück Zigarren bei Benjamin bestellt.71
Ben schreibt darüber hinaus: „Briefe an mich sollen nicht frankiert werden, dagegen werde ich keine unfrankiert senden.“ Zwei glückliche Operationen trugen ihm nach eigener Auskunft eine Sondereinnahme von 600 und 400 Talern ein. So konnte er sich 1834 ein schönes Haus in der Bolívarstraße 132 für 2000 spanische Taler kaufen. Seinen Einnahmen standen aber freilich hohe Ausgaben gegenüber: die ansehnliche Familie und viele Dienstboten, zusammen 22 Köpfe, galt es zu versorgen. Außerdem konnte er als „gute Köchin“ eine Afrikastämmige von 36 Jahren für 50 Taler beschäftigen.
Nachdem sich die Beziehungen zu seinen Angehörigen in Deutschland zufriedenstellend gestaltet hatten, bekam er 1839 den Besuch seiner 23-jährigen Nichte Berta Siegert aus Halberstadt, der Tochter seines 1829 verstorbenen Bruders Gottlieb, die ihm alles aus der Heimat berichten musste. Wie ein trockener Schwamm saugte er neugierig bis zum Äußersten die detaillierten Nachrichten aus Europa auf. Über die weite Reise ihrer Tochter hatte die Mutter in einem hinterlassenen Schreiben angstvoll geklagt.
Vielseitigkeit als wertvolle Marke Siegerts und der Kulturlandschaft
Ben Siegert blieb weiter äußerst vielseitig tätig. Er musste es auch wahrlich sein, könnte man da kritisch einwerfen. Im Grunde war es mehr als „einfache“ Vielseitigkeit. Schon eher war es Komplexität in einem gesellschaftlich-sozialen und – weiter noch – qualitativen, subjektiv-moralischen Sinne. Wieder könnte man einwenden: Das verlangt ja bereits sein Beruf als Arzt; in Angostura anfänglich und über Jahre hinweg als einziger medizinischer in der Tropen-Metropole am sich verengenden Orinoco. Jedoch mag sich so mancher Zeitgenosse an Quacksalber erinnern, denen Verantwortungsbewusstsein und ethische Überlegungen völlig abgingen. Benjamin Siegert hingegen zählte zu jenen, die ihre Profession schon immer als Berufung auffassten und eine gewisse Freude daran hatten, dem Nächsten Heilung und Schmerzfreiheit angedeihen zu lassen. Nichts brachte ihm größere Freude, als wenn ein Patient ihm nach der Genesung ein warmes Dankeschön in materieller und/oder ideeller Form überbrachte. Er war sich dessen sehr bewusst, dass er nicht nur das „handwerkliche“ Geschick und Feingefühl des Chirurgen beherrschen, sondern die ganzheitliche psychische Dimension im Blick haben musste. Die Indios und die farbige Mehrheit in seinem gesellschaftlichen Ambiente bestärkten ihn gewiss in dieser Vorstellung. Andererseits lehrten ihn seine ärztlichen Positionen für die Kommune und das Miliär, die er seit 1842 innehatte, dass es nichts gibt, was es nicht gab. Seine Stellung als Direktor des Stadt-Krankenhauses in der Orinoco-Metropole mochte diese Vielschichtigkeit massiv unterstrichen haben.72 Sicherlich lebten Ben und seine Familie von diesen multiplen Gesellschafts- und Berufsanforderungen recht gut. Anfang März 1847 schrieb er an den Bruder Carl, er behaupte noch seinen Posten als Oberarzt und Wundarzt im Militärhospital von Ciudad Bolívar und fungiere seit fünf Jahren auch als Stadt-Physikus und Direktor des Stadt-Krankenhauses. Diese Posten brächten ihm monatlich 100 Taler ein. Seine Praxis bringe ihm jährlich 1600 bis 1800 Taler ein und er besitze zwei schöne Häuser. Das erste habe er vermietet und erhalte daraus monatlich den Gegenwert von ca. 23 Talern Miete. Gleichwohl merkte Siegert an, dass der Lebensunterhalt in Angostura sehr teuer sei und „ich viel auf die Erziehung meiner Kinder verwenden muss.“73 Dies war ihm ein eminent wichtiges Anliegen. In dieser Zeit gab es ja weder in Venezuela noch in den meisten deutschen Ländern so etwas wie eine Schulpflicht und schon gar keine Bildung zum Nulltarif. Ben Siegert stammte jedoch aus einer schlesischen Familie, in der auf profunde Kenntnis und Erziehung sehr geachtet worden war. Immerhin hatten er und sein ältester Bruder nicht nur eine erstklassige Schulbildung genossen, sondern auch Medizin studiert. In Bens Selbstverständnis war klar, dass auch seine Kinder die bestmögliche Ausbildung erhalten sollten, geradezu avantgardistisch auch die Töchter. Das ließ er sich wahrhaftig auch gerne einiges kosten. Gerade in der heutigen Zeit der Informations- und Wissensgesellschaft kann man dies nicht stark genug betonen. Insoweit hatten Siegert und seine Familie Elemente der Moderne stillerdings vorweggenommen. Und dies galt von Anfang an für beide Welten: für Geist und Natur.
Ben und die Seinen gehörten sicher zu jenen Menschen, die ihren neuen reichen Lebensraum nicht nur schätzten und gelegentlich liebevoll beschrieben, sondern ihn auch durch ihre Wesenheit erfüllten und sich als organischen, natürlichen Bestandteil davon betrachteten. Sie begingen, bearbeiteten und bewohnten ihr „ökumenisches“ Areal nicht nur, sondern waren intensiv dabei, ihren „Kulturraum“ zur Entfaltung zu bringen. Ihre Moral und Ästhetik, innovative Aktion, Kontemplation und Konzentration, wenn es denn nötig erschien, prägten ihr Umfeld wesentlich mit. Sie brachten sich in Angostura ein, so gut sie konnten – und sie konnten es. Sie und die anderen Zuwanderer pflegten sicher nicht die strikte Trennung von Gefühl und Sexualität, wie das „alte“ Spanien, und davon in Nuancen die spanische Kolonialmacht und die meist christlichen Immigranten. Und Sinnlichkeit war gewiss nicht ihr schlimmster Feind, wie Nietzsche im „Antichrist“ sah. Freilich war Südamerika auch nicht Arabien, wo sich mit dem Christentum das Geschlecht als etwas Unheilvolles verbindet, das die Seele verderben kann und das Ungesittetste, was es am Menschen gibt, sein Geschlecht sei. Ben Siegert und seine Angehörigen waren sicher weder Antichristen, noch war die Idee der Liebe für sie etwas Sündhaftes. Sie waren weder Freunde plumper Vergnügungen noch spartanischer Enthaltsamkeit. Aber andererseits waren Angostura und seine Menschen ein feiner Kompromiss, mit menschlicher Schuld und Unschuld und tolerant gegenüber Andersdenkenden. Wirken und Wollen befanden sich eher in Übereinstimmung. Angostura war nicht das Lateinamerika, das Spanien, das Amerika, ja noch nicht einmal das Venezuela. Guayana war einer von vielen Landstrichen mit den urigsten Naturerscheinungen Venezuelas. Und Angostura sicher eine seiner wundervollsten, attraktivsten, lebendigsten, aber auch in vieler Hinsicht gefährlichsten Städte.
Der Orinoco als Pulsader zur Außenwelt spülte nicht nur frisches Wasser, reichlich Fische, gefräßiges Getier und Schiffe mit wertvollen Gütern vom globalen Markt in das tropische Nest, sondern vor allem mehr oder weniger zivilisierte Menschenströme aus allen Teilen der belebten Erdkugel.
Ciudad Bolívar, Südost, 1867
Ciudad Bolívar von Westen, 1867
Ben Siegert geriet in einen sonderbaren Schmelztiegel indigener, amerikanischer, afrikanischer, christlicher, hebräischer, islamischer Kultur, also sehr differenzierter ökumenischer, ökologischer und ökonomischer Varianten, die er ein halbes Jahrhundert lang nach Kräften bereicherte.
Ben und Bonifacia: Eine neue Partnerschaft erblüht
Eines Tages begegnete Ben in Angostura einer attraktiven Venezolanerin, die seine Wege schon öfter gekreuzt hatte. So meinte er zumindest, ohne sie familiär genau zuordnen zu können. Ihre dunklen Mandelaugen und vollen roten Lippen verrieten eine spanische Abstammung. Die Ähnlichkeiten mit seiner verstorbenen Frau waren frappierend. Nicht nur war sie bildhübsch und von einer gewissen wilden Schönheit der Weiblichkeit des tropischen Regenwaldes, sondern auch sie kannte die Natur, Flora und Fauna der Region auffallend gut. Sie war überdies bestens in der venezolanischen Kultur verwurzelt. Dies sollte sich bald herausstellen, als Ben einige „Encuentros“ mit ihr hatte und sie sich wiederum im Rahmen eines rauschenden geselligen Ereignisses mit Musik und Tanz gesprächsweise näherkamen. Ben mochte die Aufgeschlossenheit der blutjungen María Bonifacia Gómez de Záa, die ihm für ihr Alter von wiederum nur 17 Jahren erstaunlich reif schien. Sie entstammte einer überaus angesehenen Familie spanischer Einwanderer, die womöglich aus Andalusien stammten. Benjamin bewunderte ihre Geschmeidigkeit und das Temperament, das sie bei einem Flamenco an den Tag legte.74 Er äußerte seine Bewunderung für die ebenso ungeplante wie graziöse Tanzeinlage, und angesichts der fortgeschrittenen Stunde lud er sie auf einen kleinen Spaziergang in sternenklarer Nacht ein. Die tiefblaue Dunkelheit am offenen Himmelszelt brachte die ersehnte Abkühlung und sie konnte es sich nicht verkneifen, Benjamin ihre Gefühle zu offenbaren. Er war nun 34 Jahre alt und Bonifacia gerade halb so jung wie er.
Ben begehrt Boni – die Liebe und die Wildnis
Eine ihrer frühen Begegnungen wurde gar auf eine harte Probe gestellt. Als die beiden Poussierenden sich nach einem der illustren Begegnungsabende mit viel Musik und Tanz wie so oft in der Nähe des Orinoco-Ufers aufhielten, sich in brennender Heftigkeit ins partnerschaftliche Abenteuer begaben, näherte sich ihnen leise unbemerkt ein Caimán. Es war eines jener am Orinoco häufig vorkommenden Geschöpfe der Familie der Alligatoren innerhalb der Krokodile. Ja, Benjamin kannte diese Spezies nicht zuletzt aus seiner ärztlichen Praxis, denn in der Zeit des Befreiungskrieges, den er ja als Heereschirurg begleitet hatte, war ihm eines Tages ein stark blutender englischer Soldat als Patient gebracht worden, dem das rechte Bein von einem Caimán abgebissen worden war, bevor die herbeigeeilten Kameraden das zänkische Ungetüm zur Strecke bringen konnten. Benjamin wusste also nur zu gut um die Gefährlichkeit dieser gefräßigen Orinoco-Krokodile, die im erwachsenen Stadium bis zu sechs Meter Länge erreichen konnten. Sie ernährten sich jedoch für gewöhnlich von Fischen, Vögeln und Säugetieren; Menschen standen nicht obenan auf ihrem Speiseplan. Aber sie verachteten solche saftigen Frischfleisch-Leckerbissen auch nicht. Benjamin hatte die wilde Amphibie mit ihrem erwartungsvoll geöffneten Sägegebiss gerade noch rechtzeitig erspäht und flüchtete mit seiner „Braut“.
Caimán. Das Orinoco-Krokodil frißt einen Fisch
Freilich ist der Caimán keineswegs das einzige wild lebende Tier, das einem im guayanesischen Venezuela den Schlaf und das Leben rauben konnte. In der Tropenregion am Orinoco leben obendrein gefährliche Schlangen wie die gewaltige Anakonda aus der Familie der Boas. Diese Monsterschlangen lieben das Wasser und sonnen sich gerne an den Ufern von still dahinfließenden Strömen. Sie sind Lauerjäger. Solange sie sich nicht bedroht fühlen, unterlassen sie in der Regel einen Angriff auf Menschen, den sie jedoch gegebenenfalls bis zur Bewusstlosigkeit würgen. Dann pflegen sie den armen Teufel oder die bedauernswerte Fee in ihren Riesenrachen zu schieben, nachdem sie der menschlichen Kreatur die Knochen gebrochen, das Opfer gewissermaßen essfertig zubereitet hatten.
Angriff einer Anakonda
Die Anakonda ist zwar nicht giftig, vermag allerdings die Venen des erbeuteten Säugers, zu dem durchaus der einfache Mensch gehören kann, zu umschlingen und wie angedeutet so lange zu würgen, bis das Herz- und Kreislaufsystem kollabiert und die Regungslosigkeit eintritt. Die Anakonda ist glatt in der Lage, einen jungen Caimán zu verschlingen. Dazu kann sie ihren Unterkiefer ausklinken und einen enormen Schlund öffnen, in dem die Beute verschwindet. Danach zieht sich die Schlange zum Verdauen für einige Tage zurück und ist in dieser Phase ziemlich wehrlos. So viel zur Tier-Tier- und Mensch-Tier-Koexistenz der wilden und zivilisierten Lebewesen entlang des Orinoco.
Ben erkannte jedenfalls anlässlich eines weiteren Schäferstündchens die sich aalglatt dahinschlängelnde Gefahr und entschied sich, mit Boni schleunigst die nächste Bambushütte aufzusuchen, in der sie zunächst ziemlich atemlos verharrten. Das Pärchen zog es in nächster Zeit verständlicherweise vor, innerhalb gemauerter oder zumindest lehmiger Wände unter festem Dach zu schlafen. Noch zu tief saß ihnen der Schreck in den Gliedern, als dass sie nicht in Zukunft mit gesteigerter Aufmerksamkeit die Ufer des unergründlichen Orinoco entlanggeschlendert wären. Noch lange sprachen sie über die hochgefährliche oder doch gefahrdrohende tierische Begegnung und freuten sich wiederholt ihrer glücklichen Unversehrtheit. Diese hielt gar im Wesentlichen mehrere Jahrzehnte an. Wie schön! Kleinere Blessuren oder „Kratzer“, wie Ben die häufig bluttriefenden Verwundungen ebenso verharmlosend wie beruhigend zu nennen pflegte, blieben freilich nicht aus.
Bei passender Gelegenheit erzählte Bonifacia ihrem begehrten Ben einige recht unappetitliche, pestilenzialische aber gegebenenfalls existenzerhaltende Geheimnisse. Sie erklärte ihm beispielsweise, man könne die Caimáne riechen, bevor man sie zu Gesicht bekäme. Solcherlei überlebenswichtigen Elementarkenntnisse gab Ben häufig in Briefen an die Verwandten in Deutschland weiter. Über die Moschus liebenden Krokodile berichtete er beispielsweise 1835 in einem Brief an seinen Bruder Carl: „Möchte vielleicht die specifische Wirkung zum Teil in den Moschusteilchen bestehen, wovon der Caimán ganz durchdrungen ist so dass dieses starken Geruches wegen man dieses gefährliche Wasser- und Raubtier schon auf grosse Weite spüren kann und wenn es gar zufälligerweise einen Wind gehen lässt, so ist der davon sich dispersierende Moschusgestank so arg, dass man in der Nähe in diesem Qualme nicht atmen kann. Oft ereignete es sich daher, dass man in den entlegensten Teilen der Stadt bei günstigem Winde den Caimán wahrnimmt, der sich in deren Nähe aufhält, welches oft genug geschieht und daher man sich ohne einiger Gefahr auszusetzen, nicht frei im Orinoco baden kann“.75 Das Resultat derartiger Unachtsamkeit hatte er immer wieder auf seinem Operationstisch. Doch häufig kam leider jede Hilfe zu spät. Der Tod war ein treuer Begleiter.
Siegerts zweite Vermählung 1830
Am 20. Februar 1830 heiratete Ben wie angedeutet das zweite Mal. Er hatte 1829 nicht schon als junger Witwer sein Dasein fristen wollen und benötigte eine Gemeinschaft, die genauso der seinigen bedurfte. Zudem war er über alle Maßen verliebt in diese wild-hübsche Schönheit, die sein neuer Lebensraum in beeindruckender Fülle bereithielt.76
María Bonifacia Isabel Gómez de Záa y Doazán wurde um 1813 geboren, und Siegert heiratete wiederum eine sehr junge – ja jugendliche – Frau, was angesichts der geringeren Lebenserwartung in den südamerikanischen Gefilden jener Zeit – und nicht nur dort – keineswegs ungewöhnlich erschien. Es war die temperamentvolle und liebenswürdige Tochter des angesehenen Don Carlos Gómez de Záa, eine Spanierin, mit der er sieben Kinder haben sollte, von denen sechs überlebten. Seine attraktive Schwiegermutter war Isabel Daason de Gómez. Bonifacia verkörperte wie ihre Mama eine anmutige Schönheit, die außerdem einige Gemeinsamkeiten mit Benjamins ersten Gattin María aufwies. Auch Boni kannte sich in der Botanik der Tropen hervorragend aus und liebte Tiere. Den vier Kindern aus Siegerts erster Ehe wurde sie eine verständnisvolle und charakterstarke Ersatzmutter, was manches Mal nicht ganz ohne Reibereien blieb. Ben Siegert vermerkte dies gelegentlich kritisch in seiner Korrespondenz mit der dt Verwandtschaft, namentlich mit dem Bruder Carl im März 1847 aus der erfahrungsgesättigten Retrospektive: „Meine jetzige Frau ist noch nicht älter als 34 Jahre und sehr lebenslustig, dabei sehr gesund, betriebsam und eine sehr gute Mutter und Gattin. Ich lebe ganz glücklich mit ihr, obgleich kleine Zwistigkeiten wegen der Stiefkinder auch wohl mitunter vorgefallen sind, welche ebenfalls mir den Kopf bisweilen warm gemacht haben, jedoch scheint es, dass diese kleinen Streitereien von Tag zu Tag immer mehr nachlassen wollen, bis sie endlich hoffentlich ganz aufhören werden.“77
Bens Bonifacia verfügte über eine beachtliche Disziplin, erfreulicherweise auch Selbstdisziplin. Das hatte sie mit ihrem Gatten gemeinsam. Manch kleine Streiterei konnte durch die Milde seiner größeren Lebenserfahrung geschlichtet werden. Dazu kamen seine grundsätzliche Toleranz und Hilfsbereitschaft. Bei Boni bezogen sich letztere stark auf Tiere. Sie liebte von Kindesbeinen an ihren kleinen „Zoo“, den sie sich im Laufe der Jahre aufgebaut, um nicht zu sagen „erstritten“, hatte. Jedes Tier, das mit geringeren oder schweren Verletzungen in ihrer Nähe auftauchte, durfte mit ihrer unglaublichen Güte, Zuneigung und heilenden Hand rechnen. Eines ihrer Lieblingstiere war ein Leopard, der im Säuglingsalter von einem anderen wilden Tier schlimm zugerichtet worden war. Sie nannte ihn „Lio“ und nahm ihn in ihren kleinen Zoo auf, umsorgte und verpflegte ihn bis in seine Jugend hinein. Ben war inzwischen der Meinung, „Lio“ gehöre langsam ausgewildert, da sein Temperament inzwischen deutliche Spuren hinterließ. Er dachte daran, dass „Lio“ sich nicht nur als phantastischer Kletterer herausstellte und kein Baum mehr vor ihm sicher war, sondern an zahlreiche Besuche seines italienischen Freundes Toni Lamborghini, einer der besten Schreiner von Angostura. Der hatte es regelmäßig mit angeknabberten Bänken, Holzzäunen und Besenstielen zu tun. Einmal platzte gar Ben der Kragen, als „Lio“ wieder einmal das Gestell eines hölzernen Sessels mit einem saftigen Fleischknochen verwechselte und das schöne Holz samt dem glänzenden Samtbezug in einen Haufen Etwas zerlegte. Boni fand selbst angesichts des entstandenen „Müllhaufens“ relativ milde Worte: „Liiiooo, Duu, Liochen, warst mal wieder pöööse, Duuuu, freche Katze, freche, Duuu!“ Leo „Lio“ zog das Genick ein und machte sich schleunigst aus dem Staub. Doch Ben, der eben mit einer Schimpfkanonade beginnen wollte, überlegte es sich schlagartig anders, weil er sich erinnerte, dass seine Boni sowieso wie bisher immer tierlieb-uneinsichtig bleiben würde. Es war nicht das erste Mal, dass er sich seines lebenserfahrenen Französisch-Lehrers in Schlesien erinnerte, der in solchen brenzligen Situationen schweren Herzens Gentleman blieb, sich seinem Schicksal fügte und äußerte: „Ce que la femme veut, Dieu le veut!“ Gott will es immer wie die Frau!
Bonifacia war zwar streng, ließ den Kindern jedoch den nötigen Spielraum und besaß überdies ein sonniges Gemüt. Benjamins geliebte Gattin war, als er sich mit ihr befreundete und bald danach heiratete, noch recht „grün“, aber schon ziemlich abgeklärt und von beträchtlicher Statur. Aus der Küche schallten oft schöne Lieder ihrer wunderbaren Altstimme, und Ben betonte oft, wie gerne er bereits in der Phase ihres Kennenlernens Boni am Klavier begleitete und die beiden sich in eine umwerfende Stimmung musizierten. Ben sang einen kräftigen Bariton und komponierte einige Stücke, die sie nun gemeinsam einübten und bei festlichen Anlässen zum Besten gaben. Das gemeinsame Singen und Spielen schloss auch die Kinder ein, und so war das Haus Siegert binnen kurzem als äußerst musikliebender Treff in Angostura bekannt.
Jahre später gehörten in den Villen von Siegert und Blohm ebenso wie bei den Familien Wuppermann, Wätjen und Mönch das Singen und Musizieren sowie das Tanzen als fester Bestandteil zur Festkultur. Gelegentlich waren ganze Schiffsmannschaften bei den Europäern in Angostura eingeladen und schwärmten später geradezu euphorisch von diesen herrlichen Begegnungen. Sie genossen die varietéartigen Bankette in vollen Zügen. Boni war zudem als begnadete Köchin und humorvolle Gastgeberin bekannt, die von ihrer spanischen Familie das Tanzen von Tango und Flamenco mitbekam und bei guter Gelegenheit sich anschickte, letzteren auf einem abgeräumten gehobelten Chaparroholz-Tisch vor rhythmisch klatschender Kulisse zum Besten zu geben. Ihr Temperament ging gelegentlich mit ihr durch, und Benjamin vergötterte sie und ihre dynamische Lebendigkeit sowie die umwerfend erotische Erscheinung. Die ausgelassenen Feiern, die natürlich auch von entsprechenden Instrumenten und geistvollen Getränken in gehöriger Menge getragen waren, gehörten zum obligatorischen „guten Ton“ im Hause Siegert.
Aus dieser glücklichen Liaison Bens mit mit Bonifacia ging als Erstgeborener Carlos Damaso hervor. Er war Jahrgang 1830 und entwickelte sich zu einem fähigen und begabten Stammhalter des Siegertschen Unternehmens, das den weltberühmten Angostura Bitters hervorbrachte.
Bens neue Schwiegerfamilie und deren Verbindung zu Alexander von Humboldt
Die Jugend der Braut war wie gesagt nichts Ungewöhnliches – ungewöhnlich war allenfalls das Haus, aus dem María Bonifacia stammte. Es handelte sich um eine in Venezuela alteingesessene Familie, die dereinst bereits keinem Geringeren als Alexander von Humboldt Quartier gewährt hatte. Von daher ist es nicht nur denkbar, sondern geradezu höchstwahrscheinlich anzunehmen, Ben habe mit seinen neuen Schwiegereltern sowie mit deren Tochter viel über Humboldt gesprochen. Quasi aus erster Hand und partiell eigener Anschauung erfuhren sie gegenseitig gewisslich eine Menge über den berühmten Gelehrten.
Alexander von Humboldt, Bonpland und ihre Begleiter hatten am 11. Mai 1800 den Zugang zum Casiquiare gefunden, jenem Fluss, der den Beweis des Zusammenfließens zwischen Amazonas und Orinoco, oomezHumboldt eine Kartenskizze anfertigte, die die Vereinigung des feingliedrigen Flusssystems zeigt.78 Das und vieles mehr wurde metrologisch und meteorologisch präzise erfasst und später Wissenschaft und Gesellschaft zugänglich dargelegt.
Dem naturkundigen und gesellschaftlich gehobenen Milieu samt bemerkenswerten Begegnungen mit namhaften internationalen, forschungsreisenden Geistesgrößen entstammte also Bonifacia, Bens zweite Ehefrau.
Persönliche Wohlfahrt: Bens Einkommens- und Vermögenslage, nominal und real
Dr. Ben Siegert kam, wie wir wissen, mit wenig Geld – um nicht zu sagen, mit fast gar nichts pecuniärem – im August 1820 in Angostura an. Die 100 Taler, die er vom Bruder Johann „ausgeliehen“ hatte, waren längst aufgebraucht. Zunächst schlugen da die Fahrtkosten mit der Postkutsche Anfang September 1819 nach Hamburg zu Buche. Dort musste er ein Quartier finden, das er vom 5. September 1819 bis zum 24. Februar 1820 bezog, also ca. 173 Tage. Sodann kam die Schiffsreise von Hamburg nach St. Thomas, die 59 Tage dauerte. Der Aufenthalt in St. Thomas dehnte sich auf 45 Tage bzw. Nächte, wonach Ben am Mittwoch, dem 7. Juni, mit dem Segelschiff nach Angostura aufbrach. Diese Reise währte bis zum Dienstag, dem 1. August 1820. Die folgenden Wochen wird Ben benötigt haben, um sich mit der neuen Umgebung anzufreunden, ein Dach über dem Kopf zu finden und seine Tätigkeit als Heereschirurg aufzunehmen. Immerhin waren bis zu seiner endgültigen Ankunft an dem Ort, der für eine halbes Jahrhundert seine neue Heimat werden sollte, über 333 Tage vergangen. Damals hatte er die Kutsche von Halberstadt in die Hansestadt an der Elbe bestiegen. Die immense Erfahrungsdichte dieser kuriosen elf Monate musste er erst einmal verarbeiten und freilich auch finanzieren. Seitdem war er definitiv auf sich selbst gestellt, musste sich im Krankheitsfall selbst versorgen oder in fremde Obhut begeben und auf sein menschliches Umfeld vertrauen. Er erlangte zwar die persönliche Unabhängigkeit in jeder Hinsicht, doch musste er in ideeller und materieller Hinsicht auf sich selbst bauen.
Sein staatlicher Arbeitsvertrag mit der Republik Großkolumbien, die eigentlich erst mit dem Kongress von Angostura 1819 konzipiert und mit der Schlacht von Carabobo 1821 von der spanischen Oberherrschaft befreit wurde, hatte ja bereits seit der Unterschrift in Hamburg Gültigkeit, d.h. eine feste Entlohnung war vertraglich zugesichert. Die Schiffsreise nach St. Thomas musste jedoch zunächst an den Kapitän der „Vesta“ aus eigener Tasche bezahlt werden, wie wir von Heinrich Achaz von Bismarck wissen, der den Kapitän für seine Überfahrt von Hamburg nach St. Thomas auf 40 Friedrichsdor heruntergehandelt hatte. Dieser hatte zunächst 50 Friedrichsdor verlangt. Es darf angenommen werden, dass Ben Siegert eine ähnliche Summe bezahlen musste.
Das eigentliche Grundgehalt von Siegert belief sich nach offiziellen Quellen auf 50 Pesos pro Monat als Stadtphysikus und 30 Pesos monatlich als Militärchirurg im Range eines Obrist-Leutnants. Offiziell waren für den Chirurgen eigentlichen 50 Pesos monatlich vorgesehen.79 Er schreibt in seinem Brief an die Schwester: „Nachdem ich meine Papiere beim Gouvernement und dem damals hier etablierten Congress vorgezeigt hatte, erhielt ich sogleich von der hiesigen Municipalität die Ernennung als Stadtphysikus mit der Anweisung von 50 Thalern monatl. Gehalts, welches auch später von den Medizin Behörden in Caracas bestätigt wurde… [Das Gouvernement,] welches mich dann auch als Erkenntlichkeit zur Belohnung der gemachten und zu leistenden Dienste im folgenden Jahr (wohl 1821, R.W.) als Oberarzt und Wundarzt (Medico y Cirujano Mayor) beim hiesigen von mir damals zu etablierenden Haupt- und Provinzial Militär Lazarett ernannt nebst einer Anweisung von 30 span. Thalern monatlichen Gehalts, das mir immer pünktlich bezahlt worden ist. Meine Civilpraxis beläuft sich jetzt, ausser meinem fixierten Gehalt, jährlich gegen 4000 Thaler … Seit 4 Jahren (1828, Anm. R.W.) habe ich hier eine Stadt-Apotheke, welche mit zwei Gehilfen versehen ist, […] Bald hätte ich vergessen zu sagen, dass ich meinen Posten als Medico und Cirujano Mayor die Militär-Charge als Obrist-Leutnant spanischer Ordonanz bekleide …“80 Dafür müsste er noch monatlich besoldet worden sein, und zwar mit 150 Pesos.81 So erhielt er aus öffentlichen Kassen jährlich ca. 2.760 Pesos und aus seiner privaten Praxis weitere 4.000, d.h. er hatte jährlich mindestens 7.000 Pesos zur Verfügung, da er für die ärztlichen Untersuchungen an denjenigen, die mit dem Schiff im Hafen von Angostura anlegten, pro Kopf 3 Pesos abrechnen durfte. Damit gehörte Dr. Ben Siegert zweifellos zu den vermögenden Personen der dortigen Gesellschaft. Wir wissen aus seinen Briefen an die Verwandtschaft, dass er darüber hinaus spätestens in den 1830er Jahren ein Landgut besaß und gehörige Einnahmen aus dem Verkauf von Fleisch, Agrarprodukten, Tabak etc. gehabt haben dürfte, ganz zu schweigen von den Erlösen vom Angostura Bitters, seiner heilsamen aromatischen Innovation, mit der er den Grundstein für das Weltunternehmen legte.
Die Frage ist nun, wie teuer der Lebensunterhalt in Angostura war, d.h. wie sind die genannten nominalen Besoldungen und Einkünfte real zu bewerten?
Hierzu können einige Befunde über die alltäglichen Märkte zu Rate gezogen werden. Es ist die Frage nach der Kaufkraft der Währung, zunächst des Peso und ab 1859 dann des Bolívar. Grob über den Daumen gepeilt, entsprach der Peso etwa einem Taler preußisch Courant. Was kostete z. B. in Angostura um 1830 oder 1850 ein Kilo Brot, ein Liter Milch, ein Pfund Schweinefleisch, ein Kilo Rindfleisch, ein Pfund Ziegenkäse, ein Kilo Zucker o.ä.? Was hatte man für einen Lastesel oder ein Pferd zu bezahlen? Wie teuer war eine Schiffsreise? Wieviel hatte man für 10 Stück Ananas oder einen Liter Rum, Cognac, Bier, Wein zu geben? Was kosteten Kaffee, Kakao, Indigo, Leder (Häute) oder Gold, Silber, Diamanten und Perlen? Nur so lässt sich über die materielle Situation der Zeitgenossen urteilen. Dass die Lebensqualität, die Gesundheit, Bildung, Kommunikation, Infrastruktur zum Teil erheblich litten, wird noch darzulegen sein. Im Übrigen ist zu bedenken, dass das 19. Jh. zumindest in seiner ersten Hälfte, noch keineswegs einheitliche Maße und Gewichte sowie Münzen kannte. Der Zentner hatte keineswegs 50 kg, die Elle oder der Fuß von Region zu Region höchst unterschiedliche Längen, die Hohlmaße für Getreide oder Flüssigkeiten differierten von Ort zu Ort und von Land zu Land, und so war es auch mit den Entfernungen: Meile muss nicht gleich Meile gewesen sein, lengua nicht gleich lengua und Unze nicht gleich Unze, von fanegas, quintales, libras (Pfunden), barriles (Fässern), galóns etc. einmal ganz abgesehen. Dies nur als kleiner Hinweis aus der Werkstatt des Historikers. Wir wollen aber nichts übertreiben.
Ben vermerkte in einem seiner Briefe 1832 wörtlich: „Das gute Essen und Trinken ist hier höllisch teuer.“82 Sein Haushalt kostete ihn täglich drei bis fünf Taler, also monatlich etwa 120 Pesos. Jedoch erhielt er für einen Peso (oder Taler preußisch Courant) immerhin „20 bis 30 Pfund gutes Rindfleisch.“ Das Brot, etwa 3 Pfund Cassabe-Brot, das aus der geriebenen Juca-Wurzel bereitet wird, war mit ½ Groschen ebenfalls extrem billig10. Qualitativ besser und teurer war das aus „türkischem“ Weizen gebackene Weißbrot, Semmelbrot oder Arapa-Brot. Dies wurde von den „wohlhabenderen Ständen“ (zu denen er inzwischen gehörte) bevorzugt. Fisch konnte man jahreszeitlich „im Überfluss“ auf den Tisch bringen, entsprechend preisgünstig konnte man ihn erstehen:
„einen Korb voll für geringes Geld.“ Die Tutugas (sic!), die von ihm so begehrten „essbaren Wasserschildkröten“, von denen „eine einzige bisweilen über 120 Pfund wiegt, und aus ihren Eingeweiden … mehrere
100 Eier herausgenommen werden“, erhielt man ebenfalls zum Schnäppchenpreis: „Eine solche Amphibie kostet, wenn sie sehr teuer ist, 1 ½ bis 2 Taler.“
Johann Gottlieb Benjamin Siegert (1796-1870)
Des Weiteren notiert Ben Siegert: „Es gibt hier im Orinoco eine Art Karpfen, welche Sapoeras (sic!) heißen und eine sehr gute Speise ausmachen, zu gewisser Jahreszeit, der Laichzeit, 12 bis 15 Stück für den Wert eines halben Groschens … ihr Gewicht ist gewöhnlich 2-6 Pfund.“ Auch Wildfleisch erwies sich als erschwinglich: „Das Wildpret ist hier ebenfalls in großem Überfluss und jedermann kann hier frei und ungehindert nach den Gesetzen des Landes jagen und fischen gehen. Das wäre ein herrliches Land für euren Eduard, wenn er sich hier befände,
indem er Tag und Nacht so viel jagen und schiessen könnte als er wollte. Rote Fasanen und wilde Enten gibt es in ausserordentlicher Menge!“83
Siegert schreibt am 30. Juli 1832 an seine verwitwete Schwester Friederike Pretzel: „Im nächst kommenden Monat November, den 22.ten werde ich das 36.te Jahr vollbringen“. Er sei schon trotz des heißen Klimas „ziemlich dick geworden“ und werde täglich dicker. Seine genauen Maße sowie seine Größe übermittelte er Friederike in dem Brief, und kommentierte, er sei „sogar etwas gewachsen.“84
Grosso modo wird man folgern können: Die Lebensmittel des täglichen Bedarfs erwiesen sich als wohlfeil. Der Haushalt war geradezu subsistent. Die anderen Ausgaben lagen dagegen auf deutlich höherem Niveau. Aber dazu gilt zu bedenken, dass Siegerts Erwartungen und Ansprüche nicht gering waren: „Meine Ausgaben sind […] bedeutend! Seit vielen Jahren unterhalte ich eine zahlreiche Familie, viele Dienstboten, ein paar Reitpferde und dergleichen mehr. Ich lebe hier auf dem bestmöglichen Fusse und lasse durch gute Pflege meinem Körper nicht das Geringste abgehen, wodurch ich meine Gesundheit mir zu erhalten glaube. Meine jährlichen ordinären Ausgaben kann ich zusammen mit über 4000 Dollar anschlagen, jedoch hat es Jahre gegeben, wo durch besondere Umstände noch die Hälfte mehr darauf gegangen sind, sodass ich im ganzen genommen noch keine grossen Schätze habe konglomerieren können, jedoch führe ich ein sehr bequemes und wohlhabendes Leben, und es fehlt mir auch nicht an einigen zurückgelegten Notpfennigen. Auf meinem Tisch fehlt es nie an einer guten Suppe, einem guten Stück Rindfleisch, Brot und einigen Sorten Wein, einer guten Flasche Bier, das gewöhnlich von Nordamerika und England hierher kommt, und einigen Süssigkeiten, um die Bitterkeiten des Lebens zu mindern.“ Also war zwar nicht alles Gold, das glänzte, doch im Großen und Ganzen war Ben zu Recht stolz auf seinen täglichen Lebenswandel und sein Vermögen. Das wollte er seine Verwandten in Schlesien aus guten Gründen unbedingt wissen lassen. Schließlich blieb da der Makel seines vom Bruder „geliehenen“ Geldes, der ihm lebenslang Sorgen und Gewissensbisse bereiten sollte. Davon bestmöglich einiges wieder gutmachen zu wollen, ehrt ihn sicher, war aber andererseits nicht wirklich mehr reparabel. Manche Briefzeilen sind als Versuch zu verstehen, sein lädiertes Renommee wieder aufzupolieren und die Geschwister um Vermittlung zu bitten oder auf dieselbe zumindest zu hoffen. In diesem Sinne sind die folgenden Zeilen zu verstehen: „Unter anderen schönen Möbeln, die ich besitze, zähle ich auch ein gutes Fortepiano, das ich vor einigen Jahren von Lübeck bekommen habe und mir mit allen Unkosten 500 Thaler gekostet hat. Es dient nicht nur allein mir in den Stunden der Muße zur grössten Annehmlichkeit und Unterhaltung, sondern auch meiner Familie und vielen Freunden […] Ich trage […] eine angemessene Uniform, die aus dunkelblauem Tuche mit silbergestickten Kragen und Verschnürung nebst Degen und Hut besteht. Die Beinkleider sind auch dunkelblau oder von weissem Kaschmir mit breiten silbernen Tressen11 besetzt, wozu noch ein Paar weisslederne Handschuhe und ein mit goldenem Knopfe besetztes spanisches Rohr kommt.“ Weiter schreibt er der Schwester: „So bin ich (in) fröhligerem (sic!) Staate bei gewissen Tagen gekleidet, und wenn Du mich in dieser Tracht einmal sähest, Du mich schwerlich kennen würdest! Diese Beschreibung mache ich Dir nicht etwa der Eitelkeit halber, sondern blos um Dir eine Idee von meinen betreffenden Verhältnissen zu geben.“
Interessanterweise kommt Ben Siegert gelegentlich auf das gewerb- liche Umfeld zu sprechen: „Die besten Erwerbszweige unter den Professionisten sind hier die Medizin, Chirurgus, Schneider, Schuhmacher, Tischler, Goldschmied sind sehr gesuchte Handwerker, nur müssen sie ihre Sache gut verstehen.“ Er wiederholt solcherlei Passagen in seinen Briefen nicht zuletzt deshalb, weil er seine Nichten und Neffen in Schlesien animieren wollte, zu ihm auf Besuch oder zum dauerhaften Verbleib nach Angostura zu kommen: „Wie sehr wünsche ich, dass einer meiner Verwandten davon Augenzeuge sein könnte, und bei mir lebte. Schreibe mir, ob jemand Lust hat von meinen nahen Verwandten, zu mir zu kommen und wer es ist. Es würde für mich und meine Familie die grösste Freude sein! Die Reisekosten würde ich gern tragen wollen, es muss aber ein ordentlicher, gebildeter und gesitteter Mensch sein.“85 Tatsächlich sollte es zu kleineren Migrationen, Besuchen und Gegenbesuchen zwischen Siegerts aus Schlesien und Ciudad Bolívar kommen. So besuchte ihn 1839 seine damals 23-jährige Nichte Berta Siegert aus Halberstadt, die Tochter seines Bruders Gottlieb. Und sein Neffe Carl Friedrich Siegert, der Sohn von Bens drittältestem Bruder Carl Gottlob Ziegert aus Tarnowitz, emigrierte 1852 nach Venezuela, um in den Bergwerken Ostvenezuelas sein Glück zu machen. Umgekehrt sandte Ben ein Paar seiner eigenen Kinder nach Deutschland, um dort eine solide Ausbildung zu genießen oder ihr Studium zu absolvieren.
9 Die Mutter Anna Regina geb. Richter war am 18.11.1823 in Mühlvorwerk bei Grünberg im Alter von 66 Jahren verstorben. Der Bruder Carl Gottfried Siegert starb am 18.5.1829 in Halberstadt mit 47 Jahren.
10 1 Groschen courant; 24 courant oder gute Groschen = 1 Taler. 1 T = 48 halbe Groschen; Brotpreis also 1/48 Taler.
11 Tressen = Borten.