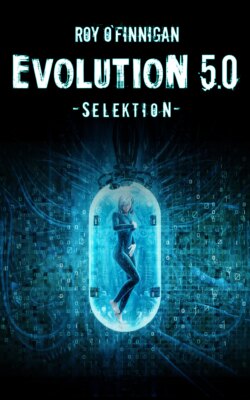Читать книгу Evolution 5.0 - Selektion - Roy O'Finnigan - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. Verhaftet
ОглавлениеSam und Vilca kehren erst spät abends wieder heim. Sam öffnet die Luke zu dem Schacht, den sie gegraben haben, um sich aus dem Bunker zu befreien. Nacheinander steigen sie die Leiter hinab. Der Erste, dem sie unten begegnen, ist Paul.
»Na, endlich!«, begrüßt er sie.
Vilca sieht ihn irritiert an.
»Du wusstest doch, dass wir aufgehalten wurden. Wir haben doch über Funk Bescheid gegeben.«
»Ja, schon, », antwortet Paul. »trotzdem habe ich mir nach all den Überfällen Sorgen gemacht.«
»Zum Glück gab es keine weiteren Zwischenfälle. Habt ihr uns noch was vom Essen übriggelassen?«, erkundigt sich Sam. »Ich habe Hunger wie ein Bär.«
»Es ist noch genug da.«, ruft Urs aus dem großen Gemeinschaftsraum des Bunkers. »Ihr müsst es euch nur aus der Küche holen.« Während er das sagt, kommt ihnen Aya entgegen und verdreht die Augen.
»Urs hat mal wieder seinen sozialen Tag. Ihr müsst müde sein. Geht schon mal rein. Paul und ich bringen euch was zu essen.«
Urs Aufmerksamkeit hängt an Sams und Vilcas Lippen, als sie ihr Abenteuer in allen Einzelheiten erzählen. Die Stelle mit den Tarnmänteln weckt ganz besonders sein Interesse. »Ha, sie funktionieren also!«, ruft er dazwischen.
Sam lehnt sich zurück und zieht einen Mundwinkel nach unten.
»Natürlich funktionieren sie. Ich habe sie schließlich erfunden.«
Urs merkt nicht mal, dass er Sam mit seiner Bemerkung kränkte.
»Daran besteht für mich kein Zweifel. Aber dass sie so gut sind, dass jemand in weniger als einem Meter Abstand an einem vorbeiläuft und nichts merkt, ist einfach fantastisch.«
Der Bodybuilder grinst über das ganze Gesicht. Danach wird es still. Schließlich unterbricht Paul das Schweigen.
»Und was unternehmen wir als Nächstes?«
»Tja.«, sagt Sam. »Ich fürchte, früher oder später müssen wir für uns herausfinden, was wir wollen. Wir haben das jetzt lange genug vor uns hergeschoben.«
»Ich will zurück nach Berlin.«, schießt Vilca los. »Ich kann mir nicht vorstellen, bis an mein Lebensende hier in diesem Bunker zu versauern.«
»Hier haben wir aber alles, was wir brauchen. Das reicht für die nächsten Jahre.«, sagt Sam vorsichtig. »Du hast doch gesehen, wie angespannt die Lage allein schon in den umliegenden Dörfern ist. In Großstädten wie Berlin wird sie noch sehr viel schlechter sein.«
Vilca bekommt Unterstützung von Urs. »Ich halte das auf Dauer auch nicht aus. Wenn wir konzentriert brainstormen, finden wir bestimmt eine Lösung, wie wir das alles hier unbemerkt nach Berlin bringen können.«
Aya wirft ihm einen skeptischen Blick zu.
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir Vorräte für die nächsten fünfzig Jahre unbemerkt nach Berlin schmuggeln können. Selbst wenn, stell dir vor, was passiert, wenn das rauskommt. Auf das Horten von Lebensmitteln in dieser Größenordnung steht die Todesstrafe.«
Sam muss unwillkürlich in die Richtung ihrer Vorratskammer blicken.
»Du hast recht, Aya, aber es spielt keine Rolle, wo die Vorräte aufgehoben werden.«
Aya wird blass, als ihr bewusst wird, dass sie de facto bereits im Konflikt mit dem Gesetz stehen.
»Wir müssen mit den Behörden reden. Die sollen das Zeug abholen. Ich habe keine Lust, deswegen hingerichtet zu werden.«, sagt sie entschieden.
Urs schüttelt den Kopf. »Einfach so alles weggeben? Und wovon sollen wir dann leben? Du hast doch die Leute in den Dörfern gehört. Das Letzte, was die brauchen können, sind noch ein paar mehr zum Durchfüttern.«
Die Augen der Chinesin wandern unstet hin und her. »Sie werden uns doch sicher einen fairen Anteil lassen, oder?«
Das Schweigen in der Runde spricht Bände. Schließlich wird es von Sam durchbrochen.
»Nach allem, was wir bisher gehört haben, ist mir da zu viel Willkür im System. Erinnert euch an das, was die zwei Bauern gesagt haben. Das System von Arbeitssoll und Zuteilung erscheint völlig beliebig. Keiner versteht es. Weiter ist da die Sache mit der Stadt, in der Vilca und ich waren. Dort haben die Polizei und die lokalen Banden zusammengearbeitet.
Aya hat recht. Wir müssen mit den Behörden sprechen. Aber hier lokal ist mir das zu unsicher. Ich schlage deshalb vor, wir nehmen mit Berlin Kontakt auf.«
»Mit der Regierung?«, fragt Paul. »Wen willst du denn da anrufen? Ich weiß, du kennst eine Menge Leute, aber das sind doch alles Politiker. Denen kann man in dieser Sache nicht trauen.«
»Stimmt.«, entgegnet Sam trocken. »Mit denen zu sprechen, wäre mir aber auch nicht im Traum eingefallen. Ich hatte eher daran gedacht, unsere guten Kontakte zur Cyberterror-Abwehr auszunutzen.«
***
Sam und seine Freunde brauchen fast zwei Tage, um eine Verbindung herzustellen. Schließlich treffen sie sich im Holovers mit einem Agenten Namens ProxyClobber. Sie alle sitzen auf der Veranda einer kleinen Strandbar an einem karibischen Strand. Klassisch, mit schneeweißem Sand und der obligatorischen Palme, die erst waagrecht aus dem Boden wächst, um dann über dem Wasser in die Höhe zu schießen. Ein lauer Wind vom Meer weht Brandungsgeräusche zu ihrem Plätzchen hoch.
»Natürlich können wir Leute mit euren Fähigkeiten hier brauchen.«, lässt sich ProxyClobber aus, der im wirklichen Leben Werner Hofer heißt. Seine Leutseligkeit passt zur Urlaubsstimmung. Mit der Sonnenbrille, den Shorts und dem roten Hawaiihemd reiht er sich in der Touristenmasse ein, die so auffällig unangepasst ist, dass man sie freiwillig gerne ignoriert. Genau das möchte er als Geheimdienstler. Nur hier am Strand ist er der einzige Tourist und sticht somit heraus wie ein bunter Papagei unter Krähen. »Hier hat sich seit dem EMP einiges verändert. Am Anfang war alles Chaos, aber mit Hilfe der ANEBs haben wir die Lage schnell unter Kontrolle bekommen.«
Seine Begeisterung scheint keine Grenzen zu kennen.
»Ich sage euch, es ist unglaublich, wie effizient diese Programme sind, wenn man sie lässt. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. All das Getue mit Demokratie, Diskussion im Parlament und Politiker entscheiden lassen, kostet nur Zeit und macht das Regieren ineffizient. Jetzt werden die Beschlüsse von den ANEBs gemacht und auch gleich umgesetzt. Das hat weltweit Milliarden Menschen das Leben gerettet.«
»Die ANEBs treffen jetzt die Entscheidungen?«, fragt Phire ungläubig.
»Ja. Die Programme haben direkten Zugang zu allen Daten, die irgendwo auf der Welt gespeichert sind oder gerade gesammelt werden. Und was nicht automatisch erfasst wird, geben wir per Hand ein. Aber das ist sehr wenig.«
Arnold wirft ProxyClobber einen grimmigen Blick zu.
»Das heißt ja, es gibt überhaupt keinen Datenschutz mehr.«
»Das ist auch gar nicht mehr nötig!«, erwidert der Agent unbekümmert. »Die Daten bekommen doch sowieso nur noch Computer zu sehen, da die Entscheidungen nicht mehr von Menschen nachvollzogen werden müssen.«
»Ah ja.«, sagt Cyclone trocken. »Und die Demokratie habt ihr gleich mit abgeschafft!«
»Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ohne die ANEBs würde immer noch Chaos herrschen. Gut, ich gebe zu, es waren ein paar Umstrukturierungen nötig. Wir arbeiten jetzt alle zusammen, um die Befehle der ANEBs möglichst effizient durchzuführen.«
»Befehle?«, fragt Zero. »Du meinst wohl Empfehlungen.«
Ohne eine Antwort von ProxyClobber abzuwarten, stellt Arnold eine weitere Frage. »Wer ist wir?«
»Na, wir alle.«, erwidert ProxyClobber. »Die Politiker, die Parteien, Beamte, Militär, Polizei, Richter, Geheimdienste, Ministerien, Behörden und so weiter und so weiter.«
Dann wechselt er unvermittelt das Thema.
»Ihr müsst nach Berlin kommen. Ich sagte schon, dass wir Leute mit euren Fähigkeiten brauchen. Ich bin mir sicher, es wird euch hier gefallen. Der Bunker ist doch so abgelegen, da wollt ihr ganz bestimmt nicht bleiben. Wir werden euch in zwei Tagen abholen und in die Hauptstadt bringen. Bis dahin habt ihr Zeit eure Sachen zu packen und euch reisefertig zu machen.«
Cyclone ist beunruhigt, aber jetzt ist die Katze schon aus dem Sack. ProxyClobber weiß von ihrer letzten Begegnung her wo ihr Bunker ist und mit diesem Treffen ist nun auch bekannt, dass sie noch am Leben sind. Egal, was sie versuchen, der Geheimdienstchef lässt sich nicht umstimmen. Nicht einmal die Abholung können sie um ein paar Tage verschieben.
Während der folgenden zwei Tage packen sie ihre Sachen und treffen Vorbereitungen, den Bunker zu verlassen. Die Stimmung ist gemischt. Vor allem Vilca und Urs freuen sich darauf nach Berlin zu kommen. Sie haben genug von den Beschränkungen des Bunkers. Sam und Aya sehen die Sache kritisch. Paul geht es vor allem darum, möglichst viel von ihren Vorräten in Sicherheit zu bringen. Er findet in Urs einen Verbündeten. Ihr Versuch, wenigstens einen Teil davon in der Nähe zu vergraben, scheitert an der Effizienz ihrer Werkzeuge.
Am frühen Morgen des dritten Tages trifft das Abholkommando ein. Es besteht aus einem Militärkonvoi mit mehreren LKWs, Begleitfahrzeugen und einer Hundertschaft Soldaten. Sogar zwei Panzer haben sie dabei.
»Wie bitte?«, fragt Sam den Major, der den Konvoi anführt. »Sie wollen meinen Bunker besetzen, um ihn als Militärstützpunkt zu benützen?«
»Genau! Der Bunker ist hiermit beschlagnahmt.«, erwidert der Offizier befehlsgewohnt. »Er ist jetzt Eigentum der Armee der Vereinigten Staaten von Europa.«
Sam verschlägt es die Sprache. Bevor jemand Urs zurückhalten kann, legt der los.
»Moment mal. Was geht hier vor sich? Sie können hier nicht einfach das Privateigentum von Bürgern beschlagnahmen. Das ist gegen jedes Gesetz. So war das nicht abgemacht. Ich möchte auf der Stelle Ihren Vorgesetzten sprechen.«
Der Major lässt sich nicht beeindrucken.
»Die Gesetze, die Sie meinen, gelten nicht mehr. Wir haben Ausnahmezustand. Die Armee kann jederzeit und überall beschlagnahmen, was wir für notwendig erachten, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und im Falle dieses Bunkers halten wir es für notwendig. Sie können gerne meinen Vorgesetzten sprechen. Wenn Sie in Berlin sind.«
Man kann zusehen, wie Urs zu kochen beginnt.
»Nein, ich möchte ihn sofort sprechen. Bevor wir ihn nicht gesprochen haben, gehen wir hier nicht weg.«, poltert Urs nur mühsam beherrscht los.
»Ich habe Anweisung, Sie unverzüglich nach Berlin zu bringen. Entweder Sie verlassen den Bunker freiwillig und kommen als unsere Gäste mit oder als unsere Gefangenen. Mir ist das egal.«
Um den Worten ihres Vorgesetzten Nachdruck zu verleihen, greifen die Soldaten demonstrativ nach ihren Waffen und entsichern sie. Aya hat ihren Freund die ganze Zeit über beobachtet. Sie weiß, wann er kurz vor der Explosion steht. In so einer Situation kann Urs sehr wohl durchschlagende Argumente vorbringen, aber selbst wenn sie die zwanzig Soldaten im Gemeinschaftsraum hier unten überwältigen, warten oben immer noch die restlichen achtzig. Deshalb legt sie ihm entschlossen die Hand auf den Arm und schüttelt energisch den Kopf, um ihn daran zu hindern, etwas Dummes zu tun.
»Lass gut sein Urs.«, beschwichtigt Sam. »Es hat keinen Zweck, mit diesen Befehlsempfängern zu diskutieren. Wir werden das in Berlin klären.«
Dann wendet er sich an den Major. Bevor er spricht, mustert er ihn demonstrativ von oben bis unten. Der Offizier hat breite Schultern, ist durchtrainiert, ein paar Zentimeter größer als Sam und trägt eine Uniform mit Tarnmuster. Seine kurzgeschorenen Haare sind mit einem grünen Barett bedeckt.
»Ich protestiere offiziell gegen die Beschlagnahmung meines Bunkers.«, sagt Sam. »Laut Gesetz steht mir eine Bestätigung zu, dass der Bunker beschlagnahmt wurde.«, ergänzt er.
Der Major mustert Sam genauso wie er ihn. Dann greift er in seine Tasche und händigt ihm einen Briefumschlag aus. Der ehemalige Besitzer des Bunkers verzichtet darauf, den Umschlag zu öffnen. Er seufzt resigniert, blickt nacheinander seine Freunde an und verlässt wortlos den Raum.
Während der Fahrt nach Berlin grübelt Sam darüber, was er falsch gemacht hat. Er sitzt mit seiner Freundin und Paul in einem leicht gepanzerten geländetauglichen Kraftwagen des Militärs und macht sich Vorwürfe. Was hatte er sich dabei gedacht, einfach jemanden von der Cyberterror-Abwehr anzurufen und dann zu glauben, dass sie ihm alle Wünsche von den Augen ablesen und sie in ihren Kreis aufnehmen würden? Natürlich muss die Regierung Leute mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten unter ihre Kontrolle bringen. Er schilt sich einen Idioten, nicht vorher daran gedacht zu haben.
Schließlich reißt Vilca ihn aus seinen trüben Gedanken. Sie kennt ihn viel zu gut und weiß deshalb genau, was in seinem Kopf vor sich geht.
»Du solltest dir keine Vorwürfe machen. Früher oder später wären wir sowieso entdeckt worden.«
»Wahrscheinlich.«, sagt Sam. »Aber wir hätten uns Zeit lassen sollen, um uns besser vorzubereiten. Dann hätten wir eine Verhandlungsposition gehabt.«
»Meinst du?«, fragt sie ihn. »Es war doch klar, dass es mehr oder weniger so endet. Selbst, wenn sie den Bunker nicht beschlagnahmt hätten, hätten sie doch darauf bestehen müssen, dass wir die Lebensmittel, unsere Computer und unsere sonstigen Ressourcen hergeben müssen.«
Sam wirft seiner Freundin einen dankbaren Blick zu, sagt aber nichts weiter. Seine Stimmung wird immer düsterer, je näher sie ihrem Ziel kommen. Ihn plagen Vorahnungen.
In Berlin angekommen, werden sie gleich auf ihre Zimmer im Zentralgebäude des Geheimdienstkomplexes gebracht. Sam stellt erstaunt fest, dass sie groß und luxuriös eingerichtet sind. Vilca und er bekommen eine Suite und er nimmt an, dass für Urs und Aya das Gleiche gilt.
Man sagte ihnen, dass es um neunzehn Uhr ein festliches Abendessen geben wird und dass sie ihre Garderobe angemessen auswählen sollen. Falls man der Meinung sei, nicht über die geeignete Ausstattung zu verfügen, könne gerne ausgeholfen werden, hieß es. Sie haben etwas mehr als eine gute Stunde, um sich frischzumachen.
»Erst beschlagnahmen sie unseren Bunker und dann geben sie uns solche Zimmer.«, beschwert sich Sam bei Vilca, die sich gerade im Bad auszieht. Für einen kurzen Moment sieht sie ihn nachdenklich an.
»Ich nehme an, die wollen was von uns.«, sagt sie, dreht sich um und steigt in die Dusche.
»Die haben doch schon alles.«, erwidert Sam.
»Wirklich?«, fragt Vilca und sieht ihn mit einem Du-weißt-genau-wovon-ich-spreche-Blick an, über den nur Frauen verfügen.
Sam beschleicht eine dunkle Ahnung. Wenn es das ist, was er vermutet, befindet er sich in einer Zwickmühle. Ihm wird bewusst, dass sie weder von Hofer noch von sonst jemand offiziell begrüßt wurden. Unwillkürlich beginnt er, sich Gedanken um mögliche Fluchtwege zu machen. Die Fenster ihrer Suite führen in einen Innenhof. Sie sind zwar nicht vergittert, aber selbst wenn sie es aus dem sechsten Stock nach unten schafften, könnten sie von dem Innenhof aus nicht einfach so aus dem Gebäude spazieren. Sie brauchen auf jeden Fall einen Plan, den sie auch noch untereinander abstimmen müssen.
Sam versinkt so in trübe Gedanken, dass er gar nicht bemerkt, wie Vilca aus dem Bad kommt. »H-hm.«, räuspert sie sich, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er hebt den Kopf und reißt die Augen auf. In dem knöchellangen, schulterfreien grünen Kleid sieht sie atemberaubend aus. Mal wieder. Oder besser, wie immer, findet er. Keine Ahnung, wo sie das her hat.
Die Farbe harmoniert perfekt mit ihren smaragdgrünen Augen. Sogar die passenden Schuhe hat sie irgendwo aufgetrieben. Bestimmt ist es kein Zufall, dass ihm der Seitenschlitz ihres Kleides einen exklusiven Blick auf ihre Beine gewährt. Wie erwartet bringt ihn das auf andere Gedanken, aber die Dame schüttelt den Kopf.
»Hilf mir bitte mit den Haaren.«
Gemeinsam flechten sie ein kompliziertes Muster. Sam hat seiner Freundin schon oft dabei geholfen. Als Dank erhält er einen dicken Kuss. Mehr aber auch nicht.
»Du hast noch elf Minuten, dich fertig zu machen.«, verkündet sie Richtung Dusche zeigend. Nur ungern trennt er sich von dem Anblick ihrer einzigartigen Frisur.
Das Abendessen wird in einem Saal serviert, eingerichtet im Stil Ludwig XIV. An den Wänden hängen goldumrahmte Spiegel, von den Decken Kronleuchter und zu ihren Füßen liegt ein echtes Holzparkett, das bei jedem Schritt so ehrwürdig knarzt, dass man ihm ein Alter von vierhundert Jahren gerne zugesteht. Der Tisch ist festlich für neun Personen gedeckt.
Sam und Paul tragen einen klassischen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd, wie es für einen solchen Anlass erwartet wird. Beide verzichteten auf Accessoires. Im Gegensatz zu Urs halten sie nicht viel davon. Dieser sorgt für das Kontrastprogramm in einer umgekehrten Farbkombination. Am Revers trägt er das Hologramm einer roten Rose, die täuschend echt aussieht und an seinen Hosen einen Galonstreifen, der langsam zwischen Rot und Schwarz wechselt.
Sam und seine Freunde müssen nicht lange warten, bis sie ihren Gastgeber kennenlernen. Er braucht sich nicht vorzustellen. Es ist Marjo, einer der bekanntesten und beliebtesten Talkmaster der europäischen Unterhaltungsszene. Begleitet wird er von der spanischen Schauspielerin Marita Gomez und einer weiteren Dame mit brünetten Haaren und einem klassischen schwarzen Cocktailkleid. Alles an ihr ist so unauffällig, dass sie nur vom Geheimdienst sein kann. Solche festlichen Anlässe scheinen überhaupt nicht ihr Ding zu sein. Der Moderator stellt sie als Anna Schmidt vor.
»Eigentlich hätte ich Werner Hofer erwartet.«, kommt Sam ohne Umschweife zum Punkt.
»Herr Hofer ist verhindert.«, antwortet die Geheimdienstlerin. Dabei macht sie ein Gesicht, als ob man sie gezwungen hätte, einen halben Liter Lebertran zu trinken. »Er hat mich gebeten ihn zu vertreten. Er wird so bald wie möglich nachkommen.«
Sam will gerade etwas erwidern, als ihm Vilca die Hand auf den Arm legt und den Kopf schüttelt.
»Nicht jetzt, Sam.«, flüstert sie. »Dafür ist später noch Zeit. Ich habe einen Bärenhunger und freue mich auf die Show. Mal sehen, was sie zu bieten haben.«
Schmidt nutzt die Ablenkung und verdrückt sich an das andere Ende des Tisches. Dort überlässt sie das Weitere den Profis vom Showgeschäft.
Mario und Marita begrüßen ihre Gäste überschwänglich und legen sich so ins Zeug Stimmung zu machen, dass Sam die faulige Absicht dahinter 1000 Meilen gegen den Wind riecht. Im Gegensatz zu ihm scheinen Urs, Aya und Vilca die Aufmerksamkeit zu genießen. Er wirft einen kurzen Blick auf Paul und stellt fest, dass sich dieser auch nicht wohl fühlt. Im Grunde hat Sam nichts gegen die Show, die die beiden abziehen. Je mehr sie sich jedoch ins Zeug legen, umso misstrauischer wird er. Vilca spürt seine Stimmung und beschließt, etwas dagegen zu tun. Sie greift nach seiner Hand.
»Jetzt mach nicht so ein Gesicht.«, flüstert sie ihm ins Ohr. »Genieß endlich die Show und das Essen. Wer weiß, wann wir so etwas noch einmal geboten bekommen. Egal, wie das hier ausgeht. Nimm, was du kriegen kannst.«
Sam tut ihr den Gefallen, lacht über einen Witz und kehrt doch wieder zu seinen düsteren Grübeleien zurück. In Kürze wird er eine Entscheidung treffen müssen, von der ihr Schicksal abhängt. Der Gedanke daran verdirbt ihm den Appetit. Obwohl vor ihm ein Galadinner aufgefahren wird, das selbst vor dem EMP seinesgleichen gesucht hätte, kann er nichts davon genießen.
Schmidt sitzt steif am Tisch und schweigt, was letztendlich dazu führt, dass sie in Vergessenheit gerät. Sam entgeht aber nicht, dass sie ihn und seine Freunde aufmerksam beobachtet.
Nach dem Essen beteiligt sich Vilca mit ein paar Liedern an dem Programm. Auf ihre unnachahmliche Art bringt sie die Stimmung innerhalb kurzer Zeit zum Kochen. Selbst ihren Freund reißt sie mit. Je mehr die Sängerin die Aufmerksamkeit auf sich zieht, umso mehr verhärten sich die Züge von Schmidt.
Auf dem Höhepunkt öffnet sich plötzlich die Tür und Werner Hofer tritt ein. Schlagartig wird es still. Sein Timing ist so perfekt, dass er diesen Moment abgepasst haben muss. Sam hat ihn in seinem Anzug erst auf den zweiten Blick erkannt.
»Ah, der Herr Hofer.«, begrüßt ihn Sam. »Wie es scheint, haben ihnen die Computer erlaubt auszugehen. Wie lange dürfen Sie wegbleiben? Bis elf Uhr? Oder hat Mama Computer Sie für den Verrat an uns großzügig belohnt und Sie dürfen bis Mitternacht bleiben?«
Hofer zwingt sich ein Lächeln ab.
»Herr Lee, bitte. Ich habe für Sie und Ihre Freunde mehr getan, als sie sich vorstellen können.«
»Stimmt.«, erwidert Sam zynisch. »Nachdem wir euren Arsch gerettet haben, hätte ich mir nie vorstellen können, dass Sie das Militär beauftragen unseren Bunker zu beschlagnahmen.«
»Herr Lee, bevor Sie uns verurteilen, sollten Sie sich unser Angebot anhören. Ich bin sicher, es wird Ihnen zusagen.«
»Was haben Sie schon anzubieten?«, provoziert Sam.
»Also bitte. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie uns doch Ihre Zusammenarbeit angeboten.«
»Das war bevor unser Bunker beschlagnahmt wurde.«
»Den Bunker hätten Sie sowieso nicht behalten können. Das muss Ihnen doch klar sein, Herr Lee. Allein der Besitz der Lebensmittel dort verstößt gegen das Gesetz. Außerdem wäre das Talent von Ihnen und Ihrem Team in so einer abgelegenen Gegend doch reine Verschwendung. Hier in Berlin haben wir ganz andere Möglichkeiten.
Denken sie doch auch einmal an Ihre Freunde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Vilca abgeschieden in der hintersten Provinz versauern möchte. Sie braucht Öffentlichkeit und Anerkennung. Das kann ihr nur Berlin bieten.«
»Laut Gesetz kann jeder frei entscheiden, wo er leben möchte.«
»Die Dinge haben sich geändert. Solchen Luxus können wir uns nicht mehr leisten. Jetzt zählen Handlungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen. Dafür brauchen wir ein System, das durchgehend effizient und zielorientiert arbeitet. Anders wäre die Situation unter den gegebenen Umständen nicht zu kontrollieren.
Wie dem auch sei, es hat keinen Sinn, noch länger darum herumzureden. Sie sind hier, weil wir die Symbots brauchen.«
»Ihr habt doch schon alle Symbots in euren Gehirnen.«, entgegnet Sam. »Noch mehr Symbots werden euch auch nicht schlauer machen.«
Hofers Mundwinkel zucken.
»Sie wissen genau, was wir wollen. Wir haben keine Möglichkeit, die Symbots herzustellen. Ich gestehe, die ganze Welt bewundert Sie, wie Sie das gemacht haben. Seit Jahren ist es niemanden gelungen, Symbots zu kopieren. Wir brauchen diese Technologie.«
»Wozu? Für die meisten Menschen sind die Symbots nutzlos, weil sie keinen Computer mehr haben und auch keinen Zugang zum Cybernet.«
»Wir werden ihnen den Zugang verschaffen. Die ANEBs haben das bereits simuliert. Innerhalb weniger Monate können wir so viel Rechenleistung in Betrieb nehmen, dass wieder alle Menschen Zugang zum Cyberspace haben. Es wird auch genügend funktionierende Holoports geben. Das muss Sie doch freuen. Ich weiß genau, dass Sie das schon immer wollten.«
Urs knallt die Faust auf den Tisch, dass die Gläser klirren.
»Ah, so läuft das also. Und so ganz nebenbei könnt ihr kontrollieren, was die Menschen so treiben, und welche Informationen sie bekommen. Das wird der totale Überwachungsstaat.«
»Zum Wohle aller Menschen.«
»Oder zu deren Hölle.«
»Alle Menschen werden glücklich und zufrieden in der virtuellen Welt leben. Ihre körperlichen Bedürfnisse werden sich auf ein Minimum reduzieren. Die ANEBs haben das genau ausgerechnet. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen reichen in diesem Fall für ungefähr sechs Milliarden Menschen.«
»Und was ist mit den anderen vier Milliarden?«, fragt Sam misstrauisch.
»Für mehr reicht es leider nicht.«
Sam studiert das Gesicht von Hofer. Es ist ihm unmöglich, dort eine emotionale Reaktion zu lesen.
»Und wer trifft die Auswahl?«
Hofer starrt ihn aus eisgrauen Augen wortlos an.
Vilca begreift es als Erste.
»Die ANEBs werden nur Menschen vom Typ B auswählen. Nur solche, bei denen die linke Gehirnhälfte dominiert und die wie ein Computer denken, werden überleben.«
Sie ist dabei blass geworden und schlägt sich die Hände vor den Mund, als ihr klar wird, dass außer Aya weder sie noch einer ihrer Freunde diese Bedingung erfüllt.
Langsam steht sie auf.
»Niemals werdet ihr die Symbots bekommen. Niemals!«, schreit sie.
Hofer ignoriert Vilca und fixiert weiterhin Sam. Ein Blick auf seine Freunde bestätigt Sam, dass sie Vilca zustimmen. Seine Gesichtszüge versteinern.
»Niemals.«, antwortet er schließlich.
Das scheint der Moment zu sein, auf den Schmidt den ganzen Abend gewartet hat. Zufrieden steht sie auf und brüllt einen Befehl.
»Wachen!«
Krachend schlägt die Tür auf und ein Dutzend schwer bewaffnete Polizisten stürmt herein.
»Abführen!«