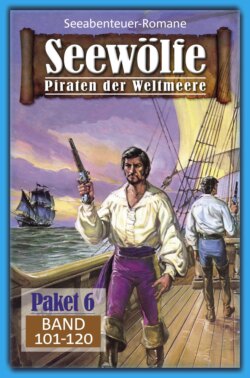Читать книгу Seewölfe Paket 6 - Roy Palmer - Страница 52
4.
ОглавлениеThorfin Njal und seine neun Männer hatten keine Schwierigkeiten gehabt, die Eingeborenenmädchen zu verfolgen. Deutlich waren die Spuren zu sehen: Niedergetretenes Gras, Fußstapfen im weichen Untergrund. Und immer wieder raschelte es verräterisch vor ihnen ihm Dikkicht.
Dann aber ertönte wie aus weiter Ferne ein Donnergrollen.
Thorfin Njal blieb stehen. Der Stör, der gleich hinter ihm marschierte, trat ihm fast auf die Hacken.
Sie verharrten alle, und Muddi meinte: „Teufel, schon wieder ein Erdstoß. Wenn das so weitergeht …“
„Unsinn“, sagte Eike. „Das war ein Kanonenschuß. Darauf gehe ich jede Wette ein. Übrigens wackelt die Erde auch gar nicht.“
„Stimmt“, entgegnete Thorfin Njal. „Bei allen Göttern – es hat Ärger in der Ankerbucht der Schiffe gegeben. Wir müssen sofort zurück. Kehrt marsch, Männer, unsere Leute brauchen bestimmt Hilfe.“
Er hatte die letzten Worte gerade ausgesprochen, und der Stör wollte sie getreu seiner Angewohnheit nachplappern, da raschelte es wieder im Gebüsch, diesmal ganz in ihrer Nähe. Dem Stör blieb das Echo im Halse stecken. Er packte den Griff seiner Steinschloßpistole. Die anderen zückten auch ihre Feuerwaffen.
Mike Kaibuk zuckte zusammen. Er hatte nach rechts geschaut und ein Augenpaar entdeckt, das ihn aus dem dichten Grün des Blättervorhangs anstarrte.
„Verdammt“, ächzte er, hob seine Muskete und wollte auf diese dunklen, forschenden Augen anlegen.
Thorfin Njal hatte den Kopf gewandt, sah aber nicht nur das eine Augenpaar, sondern auch ein zweites und das dazu gehörende Gesicht, dann eine Gestalt, die langsam aus den Sträuchern hochwuchs.
Überall, rund um die Zehner-Gruppe, erhoben sich jetzt braunhäutige Menschen. Sie standen in den Büschen, kauerten in Baumkronen, waren mit einemmal einfach da und betrachteten die Eindringlinge in einer Mischung aus Neugierde und Mißtrauen.
„Schweinerei“, zischte Muddi. „Da haben wir den Salat. Was ist, auf was warten wir? Putzen wir die Kerle weg.“
„Augenblick mal“, sagte Thorfin Njal mit dröhnendem Baß. Täuschte er sich, oder zuckten die Eingeborenen wirklich zusammen, als sie seine Stimme vernahmen? „Die haben ja gar keine Waffen. Wollt ihr auf Wehrlose schießen? Untersteht euch.“
Der Boston-Mann schaute in die Runde und musterte die braunhäutigen Menschen genauer. Wirklich, sie trugen weder Pfeil noch Bogen noch Blasrohre noch irgendwelche andere Waffen bei sich. Einige hatten zwar Messer im Lendenschurz stecken, trafen aber keine Anstalten, sie zu zücken.
Thorfin Njal kratzte sich am Kupferhelm. Was sollte er jetzt tun? Etwas Derartiges hatte er noch nicht erlebt. Er zählte die Männer. Es waren gut zwei Dutzend. Wahrscheinlich waren sie von den verstörten Mädchen alarmiert worden, hatten sich dann angeschlichen und versteckt, bevor die Weißen heran gewesen waren. –
So einfach war das.
Thorfin Njal gab sich einen Ruck und trat auf den zu, der genau vor ihm stand. Der Wikinger war ein Mann der Tat, Ungewißheiten und ratloses Aufder-Stelle-Treten haßte er wie die Pest.
„Also, hör zu“, begann er. „Wir haben nichts Arges gegen euch im Sinn. Bestimmt nicht. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Den Mädchen haben wir ja auch nichts getan, wie ihr wißt. Ich habe meinen Kerlen hier sogar gesagt, sie sollen die armen Dinger nicht anglotzen. Deswegen und weil wir keine Halunken sind, sollten wir Freundschaft schließen.“
Er streckte die rechte Hand aus.
Sie war ungefähr so groß wie eine Ankerklüse, schwielig und mit einigen Messernarben versehen.
Der Inselmann blickte nachdenklich darauf. Er schien nicht zu wissen, wie er sich verhalten sollte. Es flackerte zwar immer noch kein Haß in seinen Augen auf, aber er schickte sich auch nicht an, die ihm dargebotene Pranke zu ergreifen.
„Er versteht dich nicht“, sagte der Boston-Mann.
„Versuche doch, es ihm auf spanisch zu verklickern“, schlug Eike vor.
Thorfin raffte im Geist alle Brokken Spanisch zusammen, die er kannte, holte tief Luft und hielt seine Ansprache noch mal. Es wurde ein grauenvolles Kauderwelsch, schlimmer als Carberrys übelstes Spanisch, aber der Eingeborene lächelte plötzlich und verneigte sich.
Mit Thorfin Njals Hand wußte er immer noch nichts anzufangen. Er drehte sich aber um, winkte auffordernd und schritt in die Richtung, in der die fünf Mädchen verschwunden waren.
„Zwei Mann laufen zur Bucht und sehen nach, was da los ist“, entschied der Wikinger. „Pedro Oritz und Diego Valeras. Hastig, beeilt euch. Ich will wissen, was es mit dem Schuß auf sich hat. Aber die Gelegenheit, das Dorf dieser Burschen hier zu sehen, will ich auch nicht verpassen.“
Die Portugiesen hasteten davon. Die Eingeborenen blickten ihnen ein wenig verwundert nach, unternahmen aber nichts, um sie aufzuhalten.
Es raschelte und scharrte im Gebüsch, die Inselmänner bildeten eine Gruppe vor Thorfin und seinen Begleitern und führten sie raschen Schrittes voran.
Etwas weniger als eine halbe Meile weiter öffnete sich tief im Wald eine große Lichtung. Staunend schauten die fünf Wikinger, der Boston-Mann, Muddi und Mike Kaibuk auf die vielen schilfgedeckten Hütten, die sich dort aneinanderreihten und einen Halbkreis bildeten. Ein paar Kinder erschienen als erste auf der Bildfläche, dann rief der Anführer der braunhäutigen Männer etwas und der Rest des Stammes trat aus den Hütten.
Gutaussehende, tadellos gewachsene Menschen – keine „häßlichen Wilden“ wie die Kannibalen und Kopfjäger, die die Seewölfe auf ihren Reisen kennengelernt hatten.
Die Männer trugen geflochtene Lendenschurze, die Frauen und Mädchen Baströcke und Kleidungsstücke, die die Brüste bedeckten. Thorfin Njal erkannte zwei von den fünf Mädchen wieder, die sie beim Baden in dem Teich gesehen hatten. Sie lächelten und schienen jetzt gar nicht mehr so große Angst zu haben.
„Das sind aber freundliche Leute“, sagte Oleg. „Ja, haben die denn keine Angst, daß wir sie umbringen und ihre Hütten abbrennen? Ich versteh das alles nicht so recht.“
„Ich werde es euch erklären“, antwortete jemand, aber es war nicht Thorfin Njal oder ein anderer Mann des Trupps.
Der Sprecher schlüpfte aus dem Eingang der vordersten Hütte. Er trug einen Lendenschurz wie die anderen Männer des Stammes, und doch unterschied er sich ganz erheblich von ihnen.
Er war ein Weißer.
In reinstem Kastilisch sagte er: „Natürlich haben wir eure Ankunft beobachtet, aber wir dachten, ihr stecktet mit Ciro de Galantes unter einer Decke. Deswegen haben wir uns verborgen. Als dann die Späher gesehen haben, daß sich eins eurer Schiffe auf den Schuß hin gegen die Galeone von de Galantes gewandt hat, haben sie es mir sofort gemeldet. Da habe ich ihnen gesagt, daß wir von euch wahrscheinlich keine Feindseligkeiten zu erwarten haben, und daß sie euch einladen sollten hierher zu kommen.“
„Das kapiere ich nicht ganz“, sagte Thorfin Njal in seinem holprigen Spanisch. „Wer bist du überhaupt?“
„Mein Name ist Thoams Federmann.“ Er trat dicht vor den Wikinger hin und sah ihn eindringlich aus seinen blauen Augen an. „Ich bin ein Abkömmling der Welser. Aber du – du bist garantiert kein Spanier.“
„Bei Odin“, stieß Thorfin grollend hervor. „Willst du mich beleidigen? Ich bin ein Nordmann.“
„Ach so. Ein Wikinger, hier in Polynesien? Das ist ja ein richtiges Wunder.“
„Und ein Deutscher?“ rief Njal. „Ist das nicht genauso merkwürdig?“
Federmann nickte. „Wir können uns aber auch auf englisch unterhalten, wenn euch das lieber ist“, sagte er. Er streckte die Hand aus. „Meine Kameraden hier kennen die Geste nicht, die man bei uns anwendet, wenn man Freundschaft schließt. Sie verneigen sich nur. Ich kann jetzt bloß hoffen, Bundesgenossen in euch gefunden zu haben.“
„Hältst du es mit den Spaniern?“ wollte Thorfin Njal wissen.
„Ich bin unabhängig“, erwiderte Federmann ernst. „Ich bin ein neutraler, friedliebender Mensch, der hier gelernt hat, daß es eigentlich keinen Krieg zu geben braucht.“
Da grinste der Wikinger von ganzem Herzen und drückte die Hand des Deutschen. Federmann verzog keine Miene, obwohl der Wikinger ihm fast die Finger zerquetschte.
Er war ein schlanker, sehniger Mann, dieser Thomas Federmann, und seine Hand war nur halb so groß wie die des bulligen Wikingers. Trotzdem schien eine Menge Kraft in ihm zu stecken.
„Willkommen“, sagte er. „Meine Freunde, die Polynesier, sind von jetzt an auch die euren.“
Der Wikinger lachte. „Danke, es freut mich wirklich, solche Worte zu hören. Es ist schon lange her, daß wir bei Fremden einen solchen Empfang gehabt haben. Ich hätte dich viel zu fragen, Thomas, aber laß mich eines vorwegnehmen: Wer ist dieser Cira de Galantes?“
„Ein spanischer Meuterer und Seeräuber“, entgegnete Federmann. „Er hat seinen Schlupfwinkel auf Oahu, einer der nördlichen Nachbarinseln. Es ist ihm gelungen, die dort ansässigen Eingeborenen für seine verbrecherischen Ziele zu gewinnen. Sie fahren mit ihm auf der großen Galeone, und schon seit einiger Zeit schleichen sie um unsere Insel herum, um auch uns zu unterjochen.“
„Wie nennt ihr diese Insel?“ erkundigte sich Mike Kaibuk.
„In der Sprache der Polynesier heißt sie Hawaii.“
„Klingt schön“, meinte der Stör.
„Halt den Rand“, sagte Thorfin Njal. „Merkst du nicht, daß sich was zusammenbraut? Dieser de Galantes hat sich an unsere Ankerbucht ’rangepirscht und uns ein Ding vor den Bug gesetzt, wenn ich richtig verstanden habe. Wir stehen kurz vor dem Kampf, und da redest du von Schönheiten.“
Plötzlich fuhren sie alle herum, denn jemand stürzte durchs Unterholz auf die Lichtung. Es waren die beiden Portugiesen – und Bill the Deadhead.
„Wir haben uns unterwegs getroffen!“ rief Diego Valeras. „Bill ist von Siri-Tong losgeschickt worden, damit er uns unterrichtet. Vor der Bucht ist ein fremdes Schiff aufgetaucht und …“
„Das wissen wir schon“, erwiderte Thorfin Njal. „Der Bursche hat einen Warnschuß abgegeben – und dann?“
„Hasard ist ihm nach“, sagte Bill the Deadhead. „Soviel habe ich noch gesehen.“
„Und die Rote Korsarin?“ fragte der Boston-Mann.
„Liegt mit dem schwarzen Schiff in der Bucht, wartet auf uns und hält den Seewölfen den Rücken frei“, erwiderte Bill.
„Das halte ich nicht für sehr taktisch“, wandte Thomas Federmann ein. „De Galantes ist gut armiert und wird eure Freunde in eine Falle lokken.“
„Also“, erklärte Oleg, „weißt du überhaupt, wer Hasard ist? Du wirst noch staunen. Man nennt ihn den Seewolf, aber in Wirklichkeit heißt er Philip Hasard Killigrew. Er ist bei den Killigrews in Cornwall aufgewachsen, doch sein wirklicher Vater war ein Malteserritter – Godefroy von Manteuffel.“
Jetzt war Federmann wirklich überrascht. Er öffnete weit die Augen und wußte nicht, was er sagen sollte. von Manteuffel? Das war ja ein deutscher Name!
Plötzlich wehte wieder Donnergrollen heran. Thorfin Njal stieß einen Fluch aus. Die Polynesierfrauen schauten ihn verwundert an, aber sie verstanden ja nicht, was er da von sich gab.
Das Wummern wiederholte sich und schien plötzlich überall Echos zu finden. Nein, es war nicht die Erde, die bebte – die Geräusche drangen von der See herüber, zwar nur schwach, weil das meiste vom Wind davongetragen wurde, aber Thorfin Njal wußte auch so gut genug, was das zu bedeuten hatte.
„Hölle und Teufel“, stieß er hervor. „Jetzt wird es aber Zeit, daß wir an Bord des schwarzen Seglers zurückkehren. Los, Männer, nichts wie zur Bucht! Thomas Federmann, wir sehen uns später wieder!“
Er drehte sich um und stürmte los. Die anderen liefen hinter ihm her, aber plötzlich waren sie nicht mehr elf Weiße, sondern zwölf. Thomas Federmann hatte sich ihnen angeschlossen. Und die Polynesier-Männer hasteten an ihnen vorbei und winkten aufgeregt.
„Wir kennen eine Abkürzung zum Westufer!“ rief Federmann.
Die „Isabella“ war noch ein Stück weitergesegelt, weiter an dem schwarzen Felsenufer der Insel entlang, das sich wie eine drohende Mauer hochtürmte.
Hasard hatte unablässig Ausschau gehalten und vor allen Dingen auch einen Blick nach Backbord achtern geworfen – und nur deshalb sichtete er die geheimnisvolle Galeone wieder, bevor es für ihn zu spät war.
Sie schob sich plötzlich aus einer Felsenbucht hervor.
Diese Bucht lag so ideal hinter einer Gesteinsnase versteckt, daß man sie erst einsehen konnte, wenn man sie passiert hatte. Sie war groß genug, um zwei nebeneinanderliegenden Schiffen Platz zu bieten, und die Felsen ragten so hoch auf, daß das Mastwerk völlig verdeckt wurde.
Der Kapitän der Galeone hatte das Kunststück vollbracht, sich den Seewölfen zu entziehen, hineinzulavieren und sein Schiff zu wenden. Nur eine fähige Besatzung, die außerdem die Inselwelt bis ins letzte Detail kannte, war in der Lage, ein solches Manöver so schnell und geschickt zu vollziehen.
„Achtung!“ rief Hasard. „Wir haben die Kerle Backbord achteraus!“
Diesmal war er wacher als sein Ausguck. Dan fuhr im Großmars herum und kriegte regelrechte Stielaugen. Am liebsten hätte er sich geohrfeigt.
„O Hölle und Teufel!“ schrie er. „Penne ich denn?“
Shane, der sich auf die Entdeckung des Seewolfes hin schnell in die Steuerbordhauptwanten geschwungen hatte und nun auf enterte, rief ihm zu: „Nun reg dich nicht auf, Dan. Das kann schon mal passieren. Hauptsache, wir haben den Bruder rechtzeitig entdeckt.“
„So was darf einfach nicht passieren“, sagte Dan. Wütend und mit geballten Händen blickte er zu der herangleitenden Galeone.
Big Old Shane hatte den Großmars jetzt erreicht und kletterte über die Segeltuchverkleidung. Er verlor nicht einen Augenblick die Ruhe.
Er grinste. „Gut, dann beantrage ich eben bei Hasard, daß du die Nacht und den ganzen morgigen Tag über in die Vorpiek gesperrt wirst.“
Dan hörte gar nicht hin. Er beugte sich weit vornüber und beobachtete aus schmalen Augen. Das schwache Büchsenlicht verwandelte den Schiffskörper drüben in ein graues Gebilde, in dem Einzelheiten kaum noch zu erkennen waren.
Trotzdem sichtete Dan jetzt etwas, daß sein Blut in Wallung brachte. „Deck!“ schrie er. „Die Galeone hat noch zwei zusätzliche Stückpforten im Bug, zu beiden Seiten des Vorstevens!“
„Verstanden!“ rief der Seewolf zurück. „Achtung, Männer, gleich geht der Tanz los.“
Oben im Großmars stieß Shane den jungen O’Flynn an und lachte. „Na bitte, du hast eben immer noch die schärfsten Augen.“
Auf dem Achterdeck hatten sich Ben Brighton und Old O’Flynn zu Hasard gesellt.
„Deswegen also das ganze Theater vor der Ankerbucht“, sagte Ben. „Zwei Gegner waren diesem Bastard zuviel, und er hat uns hierhergelockt, um wie ein Wolf über uns herzufallen.“
„Dabei schneidet er sich ins eigene Fleisch“, prophezeite der alte O’Flynn.
„Das würde ich nicht zu früh sagen“, entgegnete der Seewolf. „Unsere „Isabella“ ist keine eiserne Festung, und wir sind auch nicht unverwundbar.“
Er verstummte und hockte sich hinters Schanzkleid, denn drüben wummerten jetzt die beiden Buggeschütze der Galeone los. Die Mündungsblitze stachen wie Lanzen in das Halbdunkel. Mit feinem Heulen flogen die Kugeln heran. Die Distanz zwischen den Schiffen betrug nicht mehr als eine Viertelmeile.
Eine gute Schiffskanone mit ausreichend langem Rohr feuerte eine Seemeile weit.
Längst hatte Hasard seinem Rudergänger Pete Ballie Anweisungen gegeben, höher zu laufen. Die „Isabella“ luvte jetzt an und lag auf Steuerbordbug, aber sie bot dem Gegner immer noch genügend Angriffsfläche.
Die zwei Kugeln waren heran und bohrten sich tief in die Bordwand der „Isabella“. Es krachte und knirschte, Trümmer wirbelten, und unten auf der Kuhl schrie jemand auf.
Old O’Flynn fluchte wie der Leibhaftige. Hasard wurde von einem durch die Luft segelnden Holzstück getroffen – er kriegte es genau in den Rücken. Er krümmte sich vor Schmerzen, lag für ein paar Sekunden benommen auf den Achterdecksplanken, richtete sich dann aber wieder auf.
„Ben, Ed!“ schrie er. „Wieder abfallen!“
„Abfallen!“ brüllte Ben Brighton zurück.
„Und Segelfläche wegnehmen!“
„Weg mit dem Zeug“, wiederholte Carberry auf der Kuhl, und seine Stimme hatte etwa die Lautstärke wie die Trompeten von Jericho.
Die „Isabella“ legte sich wieder platt vor den Südost. Hasard taumelte den Backbordniedergang hinunter und lief am Ruderhaus vorbei. Ben Brighton wollte ihm etwas zurufen und fragen, ob er wieder wohlauf sei, unterließ es dann aber doch.
Der Seewolf war wieder fit, das sahen sie jetzt alle. Er flankte auf die Kuhl hinunter, warf einen huschenden Blick zum Feind hinüber, prüfte die Schußstellung der „Isabella“ und gab dann selbst den Befehl.
„Feuer!“
Acht Culvertinen standen an der Backbordseite der Kuhl. Die Geschützführer, unter ihnen Al Conroy, Blacky und Matt Davies, senkten die Lunten auf die Bodenstücke. Gierig fraß sich die Glut durch die pulvergefüllten Zündkanäle und traf auf das Zündkraut. Die Kanonen schienen sich aufzubäumen. Brüllend spuckten sie ihre Ladungen aus, rumpelten zurück und wurden von den Brooktauen gebremst.
Das typische Heulen erfüllte wieder die Luft, und dann waren es die Seewölfe, die triumphieren durften. Berstende Geräusche von der Gegnerseite verkündeten, daß die meisten 17-Pfünder-Kugeln gesessen hatten.
„Hurra!“ schrie Dan O’Flynn. „Wir haben ihnen den Bugspriet weggeputzt und den Bug angeknackst!“
„Heizt ihnen ein!“ johlte Old O’Flynn vom Achterdeck. Er schwang eine seiner Krücken und stellte sich dann hinter eine der Drehbassen, um aktiv mit einzugreifen, sobald sich die Gelegenheit bot.
„Nachladen“, befahl Carberry. Eigentlich war das überflüssig – die Seewölfe hatten die Backbordgeschütze schon wieder in Ladestellung gebracht und hantierten mit fliegenden Fingern.
„Nach Steuerbord anluven!“ rief der Seewolf. Er wollte nicht zu sehr nach Legerwall gedrückt werden, und außerdem hatte er vor, dem Feind jetzt die Steuerbordbreitseite zu entbieten.
Ein Blick nach achtern – das Ruderrad wirbelte unter Pete Ballies Fäusten. Hasard lief zu Carberry und konstatierte, wie ein paar Männer an die Brassen und Schoten stürzten.
Mitten in Holztrümmern und fetten Rauchschwaden stand der Profos wie eine eherne Bastion. Der Seewolf war bei ihm angelangt.
„Der Hundesohn geht in den Wind“, meldete Dan O’Flynn.
„Soll er“, grölte Carberry. „Wir spielen also beide Brummkreisel. Wollen doch mal sehen, wer schneller … Sir, was ist denn los?“ Er hatte Hasard erst jetzt neben sich entdeckt.
„Ich habe eben einen Schrei gehört, Ist jemand verletzt?“
„Ja, Batuti.“
Wieder der Gambia-Neger! Hasard stieß einen Fluch aus und hetzte in der von Carberry angegebenen Richtung. Da sah er den schwarzen Goliath liegen – nicht weit von der rechten Kante der Kuhlgräting entfernt. Der Kutscher war schon zur Stelle, hatte Verbandszeug mitgebracht und verarztete den Mann.
Bei der Schlacht gegen die Sabreras-Flotte hatte Batuti auch Federn lassen müssen. Fast wäre er mit dem Seewolf zusammen aus dem Vormars abgestürzt und hätte sich dabei sämtliche Knochen im Leib gebrochen.
Hasard kauerte sich neben ihn hin. „So ein verdammtes Pech, Batuti. Wo hat es dich erwischt?“
„Bein“, sagte Batuti grinsend. „War aber nur blöder Holzsplitter. Hat Kutscher schon wieder ’rausgezogen.“
„Das ist wirklich glimpflich abgegangen“, kommentierte jetzt auch der Kutscher.
Hasard atmete auf. „In Ordnung. Ich werde aber trotzdem einen Ersatzmann für dich in den Vormars abkommandieren, Batuti. Gary Andrews beispielsweise …“
Der Gambia-Neger fuhr hoch. „Ssörr!“ sagte er mit rollenden Augen. „Verdammich – Batutis Platz am Vormars. Will auf der Stelle tot umkippen, wenn ich nicht Pfeile abschießen kann.“
„Kannst du denn überhaupt aufrecht stehen?“ fragte Jasard.
Sofort erhob sich der schwarze Mann. Er stand stramm und verzog keine Miene, obwohl ihm die Fleischwunde noch weh tun mußte, und zwar nicht unerheblich.
Von achtern ertönte jetzt das Böllern der beiden Drehbassen. Die „Isabella“ hatte so weit angeluvt, daß Ferris und Old O’Flynn diese kleinen Geschütze hatten bedienen können. Ein Knirschen drüben auf dem Gegnerschiff und das Jauchzen des Alten verkündeten gleich darauf, daß sie nicht danebengeschossen hatten.
Batuti blickte nach oben. Es war noch dunkler geworden, so daß der Brandpfeil, den Bug Old Shane jetzt von der Bogensehne schnellen ließ, wie ein Fanal durch den Himmel stieß.
„Ssörr“, sagte Batuti fast wehmütig.
„Also gut, ab mit dir“, sagte der Seewolf.
Der schwarze Hüne lief zur Back, klomm den Niedergang hoch und enterte mit Pfeil und Bogen in den Wanten auf. Das schlimme Bein schien ihm plötzlich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr zu bereiten, und wenn, dann überwand er tapfer die Schmerzen.
Die Seewölfe hatten die Segel für kurze Zeit wieder gesetzt, aber jetzt hingen sie erneut im Gei, denn die „Isabella“ lag mit dem Vorsteven im Wind.
Sie hatte das Manöver eher vollendet als die feindliche Galeone – und das geriet jetzt zu einem unschätzbaren Vorteil.
„Feuer!“ schrie Hasard.
Rotgelbe Schlitze zerteilten vor der Bordwand der „Isabella“ den herabsinkenden Vorhang der Nacht. Blakender Rauch zog wieder in dicken Schwaden übers Oberdeck und brachte die Männer zum Husten.
Shane und Batuti sandten unablässig Brandpfeile zu der gegnerischen Galeone hinüber. Plötzlich stand die Takelung des stolzen, prunkvollen Dreimasters in hellen Flammen. Plötzlich barst der Fockmast nach Backbord weg, knickte ab und stürzte, in zwei Teile zerbrochen, außenbords. Gellende Schreie wehten zur „Isabella“ herüber, aber sie nötigten Hasard und seinen Freunden kein Mitleid ab.
„Sie haben es ja nicht anders gewollt“, murmelte Hasard. „Sie haben uns den Hinterhalt gelegt, aber dabei haben sie nicht bedacht, daß wir die Luvposition gewinnen und beibehalten könnten.“
Ja, er keilte die fremde Galeone zwischen Luv und Legerwall ein. Rasch hatten die Seewölfe wieder die Segel gesetzt, und die „Isabella“ fiel ab, wandte sich südwärts und halste, um dem Widersacher von neuem die Backbordbreitseite zu präsentieren.
Zwar feuerten die Gegner mit den zwölf Geschützen ihrer Backbordbatterie zurück. Aber ihr Kampfgeist hatte inzwischen manches eingebüßt, und das wirkte sich empfindlich auf die Zielsicherheit aus. Manche Kugeln saßen jetzt zu niedrig, sie rissen nur rauschende Fontänen vor der „Isabella“ hoch. Andere wieder waren zu hoch gezielt und rasten flach über das Oberdeck weg.
In diesem bedrohlichen Moment lagen Hasard und die Crew wieder auf den Bäuchen und schützten die Köpfe mit den Händen. Sie hatten sich „platt wie die Flundern“ gemacht, wie der Profos das nannte.
Der Großmars kriegte einen Stoß ab, aber er bebte nur. Die Siebzehnpfünder-Kugel, die ihn gestreift hatte, flog zur anderen Seite hin in die Dunkelheit hinaus, ohne weiteren Schaden anzurichten.
Zwei Geschosse knallten in die Bordwand der „Isabella“. Sie veranstalteten einen Höllenlärm und schienen den ganzen unteren Schiffsleib aufzutreiben. Old O’Flynn, Ben Brighton und Ferris Tucker fluchten zusammen. Der rothaarige Schiffszimmermann sauste nach unten, um den Bauch des Schiffes zu inspizieren.
Hasard eilte ihm nach. Er turnte die Niedergänge zu den Frachträumen hinab, arbeitete sich im Stockdunkeln bis zu dem mittleren vor und sah seinen Schiffszimmermann schließlich vor einem riesig wirkenden Loch in der Bordwand stehen.
„Das sieht nur so wüst aus!“ schrie Ferris. „Aber wir haben noch Glück, daß die Treffer nicht unterhalb der Wasserlinie liegen. Ich dichte das Leck jetzt notdürftig ab.“
„Paß auf, daß die Lumpenhunde dir kein Loch in den Balg blasen“, sagte der Seewolf. „Ich schicke dir noch Bill zum Helfen hinunter, dann wirst du mit der Reparatur schneller fertig.“
„Danke, Sir!“ brüllte Tucker gegen das Wummern und Grollen der Kanonen an.
Hasard kehrte ans Oberdeck zurück, kommandierte Bill in den Frachtraum ab und hastete dann zum Achterdeck, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen.
Das Feindschiff war inzwischen auch wieder abgefallen und hatte die Steuerbordkanonen abgefeuert. Nennenswerte Treffer waren diesmal auf der „Isabella“ nicht zu registrieren – von einem Loch im Großmarssegel abgesehen. Einer der geggnerischen Geschützführer hatte wohl Big Old Shane aus dem Großmars schießen wollen, um das mörderische Pfeilfeuer abzuwenden.
Aber Shane und Dan O’Flynn lachten nur höhnisch. „Da müßt ihr früher aufstehen, ihr Bastarde!“ rief Dan. „Uns kann keiner was anhaben, merkt euch das.“
Das war natürlich maßlos übertrieben, aber es gab die Stimmung wieder, die jetzt plötzlich unter den Seewölfen herrschte.
Die große Galeone der Gegner lief nach Nordwesten ab. Sie war eine schwimmende Feuerlohe, von der fast unausgesetzt das Schreien der Verwundeten herüberdrang.
„Wir segeln auf Parallelkurs mit“, entschied Hasard, als er neben Ben und Old Donegal stehenblieb. „Ich will sehen, was der Schurke vorhat. Verholt er sich wirklich? Oder hofft er auf Verstärkung?“
„Woher soll die wohl kommen?“ meinte der alte O’Flynn. „Falls er hier irgendwo Verbündete hätte, wären die doch längst aufgetaucht.“
„Trotzdem – wir müssen nach wie vor höllisch auf der Hut sein“, erwiderte der Seewolf. „Ich traue diesem Kapitän dort nicht über den Weg, auch dann nicht, wenn er untergeht. Ich sage euch, er ist einer der ausgekochtesten Halunken, denen wir je begegnet sind.“
Er wußte nicht, wie recht er hatte. Eine drastische Bestätigung sollten seine Worte allerdings erst sehr viel später erfahren – als keiner mehr daran dachte.