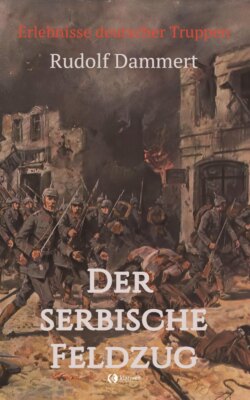Читать книгу Der serbische Feldzug - Rudolf Dammert - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Serbiens Aufstieg und Untergang.
ОглавлениеSerbien ist der Allgemeinheit das Land der Königsmörder. Man weiß, es ist eine krankhaft ehrgeizige, größenwahnsinnige, kriegerische Nation. Damit ist das Urteil abgeschlossen. Auch wenn man der großen Masse des Volkes zugutehält, dass es mit der grauenhaften Chronik der Gewalttätigkeiten nichts gemein hat, sagt doch ein gesundes Empfinden, dass ein Volk, das eine derart blutbeladene Dynastie und Regierung duldet und in Wahlen unterstützt, an deren Schuld und Schicksal mit vollem Recht teilhaftig ist. Mord und Umsturz sind diesem Balkanstaat freilich andere Begriffe als uns. Das verschwommene Urteilsempfinden der Masse beugt sich willenlos der hohen Weisheit der in Belgrad Regierenden, »die das Land zu mehren verstanden und denen die französischen Millionen nach Wunsch zuflossen. Eine blühende Entwicklung war allerorten bemerkbar. Der Zweck ihres Handelns war offensichtlich von guten Folgen, also schienen dem Volk auch die Mittel verständig und notwendig.
Unruhig, in seinen Stimmungen und Temperaturen wechselnd wie das Land, ist die Geschichte des Balkans. Er ist die Brücke, die vom Abendland zum Orient führt. Ungezählte Völker haben sich über diese Weltstraße ergossen und oft genug grausam vernichtet, was eben ansässig Gewordene errichtet hatten. Spät erst waren die Bulgaren und Serben stark genug geworden, weitere Überflutungen abzuwehren. Aber nun entbrannte ein Vernichtungskampf zwischen den beiden Rivalen. Im 12. Jahrhundert war die Straße von Belgrad nach Konstantinopel im Besitz der Bulgaren, während die Serben ihren Stammsitz im heutigen Novibazar hatten. Um die Bulgaren zu vertreiben, zogen« die Serben die Byzantiner ins Land, denen sie später selbst unterlagen. Dieses Volk hat aus Ländergier schon immer mit seinem Schicksal gespielt.
Die seltsamen Täler, die heute von deutschen Soldatenliedern widerklingen, waren einst erfüllt von dem Waffengeklirr deutscher Kreuzritter und den Gesängen frommer Pilger. Hier marschierte Friedrich Barbarossa auf der Fahrt ins Heilige Land. In Nisch beugte sich vor seinem Glanze der Serbenfürst, dem damals die Krone von Byzanz das Haupt umnebelte. Demütig bat er, ein deutscher Lehensfürst werden zu dürfen. Barbarossa wies ihn ab. In der Schlacht auf dem Amselfelde wurde bald darauf Serbien türkischer Besitz. 420 Jahre kam das Land dadurch zu der ihm ungewohnten Ruhe. Eine türkische Provinz im eigentlichen Sinne ist jedoch Serbien auch in dieser Zeit nicht gewesen. Die Herren von Konstantinopel besetzten zwar das Fürstentum mit ihren Truppen. Im Übrigen blieben aber die Serben in ihren Sitten, in ihrer Sprache und in ihrer Religion unangetastet. Ihr Ehrgeiz und Tatendurst konnte sich freilich in dieser Zeit nur an den Heldengesängen und geschichtlichen Erinnerungen austoben, von denen die blinden Rhapsoden, die das Land durchzogen, erzählten. Anfangs des 18. Jahrhunderts kam Serbien an Österreich, nur kürzere Zeit. In den späteren Kämpfen fochten die Serben bald auf der Seite der Türken, bald auf der der Österreicher.
Im Jahre 1804 setzte die serbische Freiheitsbewegung ein. Georg Petrowitsch, der „Schwarze Georg“ (Karageorgewitsch) genannt, ein Vorfahr des Königs Peter, führte die Aufständischen, besiegte die Janitscharen und erstürmte Belgrad. Aber schon nach diesem ersten Erfolg zeigten sich innere Zerwürfnisse. Eine neue Partei wünschte, dass sich das Land unter den Schutz Russlands stellte, während andere dem Lande die soeben errungene Selbständigkeit erhalten wollten. Die Russen ließen die Serben ihre Macht fühlen. Sie brachten sie im Bukarester Frieden von 1812 um die Früchte der Siege, die sie in dem Jahre zuvor gegen die ottomanischen Truppen erfochten hatten. Karageorgewitsch unterlag in dem folgenden Jahr einem neuen Ansturm der Türken. 1815 befreite Milosch Obrenowitsch mit zusammengerafften schwachen Kräften das Land aufs Neue von der Türkenherrschaft. Karageorgewitsch, der nach seiner Niederlage nach Österreich geflohen war, kehrte in die Heimat zurück und fiel einem Meuchelmord zum Opfer.
Milosch Obrenowitsch wurde 1817 zu Belgrad in einer Versammlung von Vertrauensmännern aus dem Volk zum Fürsten von Serbien ausgerufen. Die Türken gestanden den Serben das Recht zu, ihren Fürsten zu wählen, ihr Land selbst zu verwalten, die Rechtspflege zu handhaben und eigene Steuern einzuziehen. Serbien hatte seine Freiheit wiedererlangt.
Die Abhängigkeit gegenüber der Türkei bestand nur noch in der Entrichtung eines Jahrestributs. 1862 räumten die Türken die Mehrzahl der serbischen Festungen, 1867 wurde der Halbmond auch auf dem Kalimegdan in Belgrad niedergeholt.
Während des russisch-türkischen Krieges fiel die serbische Armee in Bulgarien ein und zwang dadurch den in der ungeschützten Flanke getroffenen Türken den Frieden von San Stefano (1878) ab, der Serbien die Gebiete von Nisch, Pirot und Lefkovac eintrug. Die Bulgaren, damals noch in den Anfängen ihrer Unabhängigkeitskämpfe, mussten den Übergang dieser bulgarischen Gebiete in serbische Hände dulden. Erst in dem großen europäischen Krieg der Jetztzeit war es ihnen vergönnt, sich diese Gebiete wieder zu erobern.
Milosch Obrenowitsch hat sich 1830 die Erblichkeit seiner Dynastie verbriefen lassen. Er baute das neue Staatsgebilde mit fester Hand auf. Er war Analphabet und konnte die Staatsdokumente nur mit drei Kreuzchen unterzeichnen, hat aber in seinen Gesetzen eine achtenswerte autodidaktische Allgemeinbildung bekundet.
Als die von russischer und englischer Seite geschürten aufständischen Bewegungen immer deutlicher darauf abzielten, das Parteiwesen auf Kosten des Thrones erstarken zu machen, dankte er müde und enttäuscht zugunsten seines Sohnes Milan ab, der jedoch wenige Wochen später starb. Miloschs zweiter Sohn Michael, der die Regierung übernahm, musste vier Jahre später nach Österreich flüchten. Nun wurde der Sohn des „Schwarzen Georg“, Alexander Karageorgewitsch, von einer Volksversammlung zum Fürsten von Serbien erwählt.
Auch er konnte sich gegen die Ränke der Parteien nicht behaupten und wurde als abgesetzt erklärt. 1859 holte man den achtzigjährigen Milosch Obrenowitsch zurück. Er starb jedoch schon im folgenden Jahr. Sein begabter Sohn Michael der Dritte, der vor dem Belgrader Theater ein stattliches Standbild hat, fiel 1867 einer Verschwörung zum Opfer, die die Familie Karageorgewitsch gegen den Obrenowitsch angezettelt hatte. Er wurde im Park seiner Sommerresidenz überfallen und mit seiner Tante getötet. Die Empörung über dieses ruchlose Verbrechen war im Volke so stark und allgemein, dass die Urheber des Anschlags ihren Zweck nicht erreichten. Die große Skuptschina gab dieser Stimmung Ausdruck, indem sie dem einzigen noch lebenden Obrenowitsch, dem vierzehnjährigen Milan, die Königskrone anbot. Nachdem eine Regentschaft von Ministern vier Jahre lang das Zepter kraftlos im Wirrwarr der Parteien geführt hatte, übernahm 1871 Milan der Vierte die Regierung. Er hat das serbische Reich durch innere Reformen gekräftigt und durch Waffenerfolge in der äußeren Stellung gehoben. 1882 nahm er den Königstitel Milan I. an und proklamierte Serbien zum Königreich. Aber der wachsende Einfluss der russophilen Radikalen verwandelte die Regierung immer mehr in eine Oligarchie hinterhältiger, zänkischer Parteiautokraten. König Milan hatte keine Lust, sich zu einer Strohpuppe herabwürdigen zu lassen und dankte, verbittert und der Umtriebe überdrüssig, zugunsten seines Sohnes Alexander ab.
Von dem jungen König sagte mir einer seiner früheren Minister, er war eine geistige Kapazität, aber ohne Initiative. Er hatte eine rasch durchdringende Auffassung, aber keine Entschlussfähigkeit. Milans nachgiebiger Verzicht auf die Krone hatte die aufstrebende radikale Partei noch übermütiger gemacht. Bei dem Topola-Aufstand 1883 riss ein ehrgeiziger junger Ingenieur, der spätere Ministerpräsident Paschitsch, die Führung an sich.
Die Empörung wurde blutig unterdrückt; Paschitsch entkam jedoch über die Grenze. Die Macht seiner Partei ermöglichte ihm seine baldige unbehelligte Rückkehr. Mit zunehmendem Missfallen musste die russische Regierung feststellen, dass sich die Obrenowitsch nicht als Werkzeug ihrer Balkanpolitik gebrauchen ließen und dass Milan sowie König Alexander freundnachbarliche Beziehungen zu Österreich-Ungarn pflegten.
In dem Schwiegersohn des Königs Nikita, dem Peter Karageorgewitsch, hatte man dagegen einen Thronanwärter und gefügigen Vollstrecker des russischen Willens zur Verfügung. Cetinje wurde zum Spinnennest europäischer Politik. Es war dem schlauen Bauernkönig gelungen, zwei seiner schönen Töchter an den russischen Hof zu verheiraten. Schwiegermutter und Schwägerinnen waren denn auch nicht müssig, den arbeitslosen guten Peter aus dem Cetinjer Schloss, wo er den Schwiegereltern zur Last fiel, auf den Belgrader Thron zu bringen. Es setzte sich in russischen und russophilen serbischen Köpfen, zu denen vor allem die in Petersburg ausgebildeten serbischen Offiziere gehörten, der Gedanke immer fester, König Alexander vom Thron zu stürzen. Die altgewohnten Methoden der Verärgerung und Zermürbung blieben ohne Erfolg. Als die Parteidemagogen es mit dem jungen König gar zu schlimm trieben, erschien unerwartet der Vater Milan im Lande, um Ordnung zu schaffen.
Eine teuflische russische Intrige spielte nun dem jungen König die hübsche Kokotte Draga, die Witwe eines Ingenieurs Maschin, in die Hände. Die ehrgeizige Frau, deren Liebhaber man in Belgrad an den Fingern beider Hände herzählte, bekam den König in ihre Gewalt. Der russische Zur half bei der Kuppelei nach Kräften mit. Er stellte für die Hochzeit kaiserliche Geschenke in Aussicht und versprach, die Neuvermählten in Petersburg zu empfangen. Damit schienen die äußeren Schwierigkeiten beseitigt. Im Lande selbst hofften die beiden den Entschluss ihrer Neigung durchkämpfen zu können. Unter den neuerdings gefundenen Papieren befindet sich auch der Briefverkehr zwischen Alexander und Draga. Die Briefe der beiden sind natürlich und schlicht wie die zweier in Liebesempfindungen eingesponnener einfacher Menschen. Auch die Worte der königlichen Braut halten sich fern von Geziertheit und Aufdringlichkeit.
Deutscher Offizier am Beobachtungsapparat an der Donau.
Belgrad, vom Bahnhof Semlin aus gesehen.
Truppenverladestelle an der Donau.
Versenkte serbische Dampfer.
Königin Draga war eifrig bemüht, sich durch soziale Taten Volkstümlichkeit zu erwerben. Sie gründete wohltätige Institute, schuf Arbeitsgelegenheiten. So verdankt ihr das Teppichgewerbe in Pirot einen neuen Aufschwung.
Als das junge Paar nach der Hochzeit in Peterhof anfragte, ob sein Besuch nun willkommen sei, antwortete man ausweichend. Da starb, den Verschwörern sehr gelegen, der im Volke angesehene und von den Radikalen wegen seiner Entschlossenheit gefürchtete König Milan.
Nun geriet das Lebensschifflein des letzten Obrenowitsch Alexander in eine rasch anschwellende Brandung. Man verstand es, dem Volke klar zu machen, dass die Eheverhältnisse des Königs den Stolz der Nation verletzten. Man ging jedoch diesmal vorsichtiger zu Werke als bei der Ermordung des Fürsten Michael.
Damals verhinderte die empörte Volksstimmung die Rückkehr des Karageorgewitsch. Man spielte daher Komödie, hing sich das nationale Mäntelchen um und zeigte sich scheinbar entgegenkommend, wohl wissend, dass Alexander ebenso die Wahl seines Herzens wie seinen Thron aufs äußerste verteidigen werde.
Eine Offiziersdeputation machte dem König drei Vorschläge. Der erste lautete, sich von seiner Frau zu trennen; der zweite, mit ihr zu verbleiben, aber als König in Pension zu gehen; der dritte, mit der Geliebten den Tod zu wählen. Verletzt und trotzig erklärte Alexander, er werde mit ihr sterben. Einige Tage später — am 29. Mai 1903 — lagen die zuckenden Leichname des Königspaares im Vorgarten des Konak.
Die russische Diplomatie hatte triumphiert und lenkte die serbische Politik jetzt voll und ganz in ihr Fahrwasser. Der neue König wurde in höchsten Gnaden in Petersburg empfangen. Der Glanz des Zarenhofes überschimmerte sein blutbeflecktes Königskleid. Er erwies sich gelehrig und beflissen und spann seinen Faden gegen den Nachbar jenseits der Donau. In dem ersten Balkankrieg wurde der türkische Besitz auf europäischem Boden zertrümmert und das Glacis für den russischen Vormarsch gegen Konstantinopel vorbereitet.
In Bulgarien erkannten weitsichtige Staatsmänner frühzeitig die tieferen Gründe russischer Liebe für die Balkanstaaten; die wahre Absicht, aus diesen ehemaligen Wilajets russische Provinzen zu machen, die Balkanvölker vor den russischen Siegeswagen zu spannen, der den zweiköpfigen russischen Aar nach Konstantinopel fahren sollte.
Der leichte Triumph über die von drei Seiten angefallene Türkei erhitzte die heißen serbischen Köpfe noch mehr. Sie brachen das waffenbrüderliche Abkommen mit den Bulgaren und machten ihnen im zweiten Balkankriege mit dem Schwerte streitig, was sie ihnen im vorangegangenen ersten Kriege gegen die Türkei zugesichert und verbrieft hatten. Immer dunkler zog sich das europäische Gewölk zusammen.
Russland hatte sich von dem japanischen Kriege erholt und sann auf neue Ablenkungen von inneren Gefahren. Konstantinopel war das Ziel, die Schwächung Deutschlands, die Zertrümmerung des vielgestaltigen Österreich-Ungarns ein verlockender Gedanke.
Aber einen Mann fürchteten die russischen Panslavisten, der emsig am Werke war, die habsburgischen Streitkräfte zu Lande und zur See zu vereinheitlichen und zu kräftigen: den Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Er musste so rasch wie möglich beseitigt werden. Die in Meuchelmord geübte serbische Brudernation erwies ihnen diensteifrig den Gefallen.
Eine Bagage- und Munitionskolonne überschreitet die Donau auf einer schmalen Schwimmbrücke.
Ein kleiner Soldatenfriedhof bei Belgrad.
Ein Landungsplatz in den serbischen Bergen.
Blick von Belgrad auf die Save.
Die Geschichte Serbiens ist eine grauenvolle Aufeinanderfolge von Verschwörungen, Aufständen, Verbannungen, Mordanschlägen, Bedrohungen und kriegerischen Raubzügen.
Es ist das Schicksal eines Volkes, das begabt, ausstrebend, regsam, aber ohne Charakter ist, ohne Selbstzucht und ohne Augenmaß für die Politik im Bismarckschen Sinne, für die Kunst des Möglichen. Tüchtigkeit, Kunstsinn, Verständnis für die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben der Neuzeit gehen dem Volke nicht ab, aber der erregsame, leicht beeinflussbare, unstete Geist des serbischen Bauern wurde zum Spielzeug macht- und geldsüchtiger Demagogen.
Die natürliche Intelligenz, die leidenschaftliche Vaterlandsliebe und sein aufstrebender Ehrgeiz hätten das serbische Volk befähigt, dem Lande eine gesicherte und machtvolle Stellung in Europa zu schaffen und sich zu großer Wohlhabenheit zu entwickeln. Es gibt wenige Gebiete in Europa, die mit Serbien an landschaftlicher Schönheit und Fruchtbarkeit wetteisern können. Es hätte mit seinen fruchtbaren Tälern und Niederungen eine Vieh- und Kornkammer für Europa werden können, und seine ungeheuren Schätze an Stein- und Braunkohlen, Kupfer, Eisen, Silber, Gold, Blei, Marmor usw. lieferten ihm Quellen des Reichtums in Hülle und Fülle. Aus dem fetten, des Düngers nicht bedürftigen Ackerboden wuchs dem Bauer die Ernte ohne viel eigene Mühe zu. Das ist sein Verhängnis geworden.
Er hatte ohne viel Arbeit, was er brauchte, und dadurch umso mehr Zeit, sich der Politik zu widmen, die das Hirngespinst seines Lebens wurde.
In keinem Dorf der Welt wurde so viel politisiert wie in dem serbischen. Die Parteien buhlten um diese Wirtshauspolitiker und peitschten ihre Leidenschaften auf, um sich ihrer umso besser bedienen zu können. Die radikale Partei mit ihrem Führer Paschitsch war russenfreundlich und schon aus diesem Grunde den Karageorgewitsch zugeneigt. Die liberale Partei stand auf Seiten der Obrenowitsch, hielt ursprünglich mehr zu Österreich-Ungarn, spaltete sich später und verlor dadurch ihren Einfluss. In den letzten Jahren standen sich in dem kleinen Lande elf Parteien gegenüber. Seit der Thronbesteigung des Königs Peter war die Autokratie der radikalen Partei unbestritten, und der König selbst hatte sich ihr zu fügen. Sie verstand es, durch Mittel der Drohung und der Bestechung ihre Gegner unschädlich zu machen. In einer Zeitung der Radikalen stand schon im Jahre 1894 der Satz: Herr Paschitsch gelte in Russland mehr als der König von Serbien. Es ist nicht zu bestreiten, dass unter seiner Regierung das Land eine fortschreitende Entwicklung nahm. Besonders für die Schulen ist viel geschehen. Wir finden selbst in kleineren Dörfern stattliche, wohlausgerüstete Schulhäuser. Die freundschaftlichen Beziehungen zu Russland öffneten der radikalen Regierung die französischen Taschen, aus denen innerhalb eines Jahrzehntes nicht weniger als 600 Millionen Franken nach Serbien flossen. So kam es, dass die Regierung des Herrn Paschitsch für sachliche wie persönliche Zwecke stets Geld zur Verfügung hatte· Das imponierte den Bauern und ließ sie zu umso gefügigeren Dienern dieser Regierung werden. Alle kraftvollen Herrscher Serbiens, die ja selbst aus dem Volke hervorgegangen waren, haben einen Kampf auf Leben und Tod gegen die Führer der jeweils herrschenden Partei führen müssen und darin ihre Kraft verzettelt. Sie hatten zu wählen zwischen einer Unterwerfung unter den Willen dieser Volkstribunen und Parteiführer oder einem gewaltsamen Ende. Das serbische Volk hat seit seiner vor nunmehr hundert Jahren erfolgten Selbstbefreiung nicht den Beweis erbracht, dass es reif ist, sich selbst zu regieren, sich die Selbstzucht aufzuerlegen, ohne die ein geordneter Staat nicht bestehen kann. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass der in Serbien vorherrschende Parteianarchismus nicht nur dem Lande selbst eine Ruhe, Sammlung und Entwicklung unmöglich macht, sondern auch Brandstoff für das übrige Europa und in besonders bedrohlicher Weise für die angrenzende österreichisch-ungarische Monarchie aufschichtet. Der Feuerherd ist erstickt. Einem gesicherten Frieden der Zukunft droht aus diesem Lande eruptiver nationaler Leidenschaften keine Gefahr mehr. Der opferschwere Krieg, der auf uns lastet, hat hier verheißungsvolle Arbeit getan.