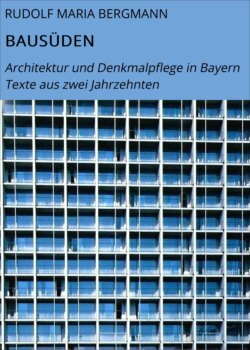Читать книгу BAUSÜDEN - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 10
EICHSTÄTT Umhegte Weite. Schneeräume Ein einzigartiger Ort in diesen Wintertagen: der Eichstätter Residenzplatz
ОглавлениеDehio, sein flammendes Plädoyer gegen den Wiederaufbau des Heidelberger Schlosses könnte derzeit eine erhellende Lektüre sein, Dehio also, der sich vor hundert Jahren anschickte, deutsche Baudenkmäler systematisch zu erfassen, sie prägnant wie wenige, doch nicht ohne Leidenschaft beschrieb, er kam ins Schwärmen und wertete als „Platz von europäischem Rang“ diesen betörenden Ort.
So herangeführt durch die Architekturgeschichte erwartet man, in Eichstätt ein pompöses Schatzhaus des Barock anzutreffen, womöglich ungeheuere Gebäudekomplexe, von denen brachiale Achsen die Landschaft ausstrahlend bändigen. Die schlanke Barockfassade, dem gotischen Domchor vorgestellt, ein erster magischer Point de vue für den Flaneur, sobald er aus dem Bahnhof auf die enge Gasse tritt, lässt daran immerhin noch denken: Monumentale, hoch aufsteigende klassische Zwillingspilaster, über denen das Gebälk wie ein Kronreif schwebt, dazwischen die dünnhäutige, vorschwingende Wandmembrane. Alles aus kernigen Kalksteinblöcken modelliert, kaum zu glauben, ohnehin in diesen Tagen, wenn die Schneeweiße solche Architektur zum schwerelosen Artefakt verwandelt. Gedanken-Gebäude im Frost, das den Blick des Betrachters erst weiterführt, wenn er nähergetreten ist. Er wendet sich nach rechts, dort wird alles anders.
Zwar schließt die ehemalige fürstbischöfliche Residenz nahtlos an die Domfassade an, satt lagernd allerdings statt hochstrebend, eine klar umrissene Kubatur von maßvoller Proportion, ohne Allüren und von eher beiläufigem Schmuck. Ähnlich vis-à-vis das ebenso lang gestreckte Kanzleigebäude. Dort im Erdgeschoss immerhin schmucke, von Säulen getragene Arkaden, ursprünglich nichts weiter als ein Unterstand für die Residenzwache. Weitere Dekoration der Gebäude dient nur dazu: ein harmonisches Beziehungssystem herzustellen, aus dem ein homogener Straßenzug entsteht. Die Straße ist in den architektonischen Ausdruck mit einbezogen und untrennbarer damit verbunden. Wichtiger Auftakt, der sie ist: Nach ein paar Schritten öffnet sich jener betörende Ort, den Dehio meinte.
Eine kleine umhegte Weite empfängt den Flaneur, geräumige Überschaubarkeit, kein Pathos, nicht der große Gout. Linker Hand noch immer die Residenz, jetzt mit ihrer gestreckten Südfassade, rechts schwingt in flacher Bogenlinie eine Zeile von Gebäuden, den Platz kontinuierlich öffnend. Zunächst ein fulminanter Langflügel mit 28 Fensterachsen in ungebrochener Flucht. Staunend studiert man daran, wie achtzig Fenster mit lediglich vier einfachen Giebelvariationen zur kunstvollen Fassade verwoben wurden. Der nützlichen Vierteilung, über die Dehio berichtet, entsprechen schwach vortretende Mittelrisalite, die den Rhythmus der Front horizontal und vertikal in Bewegung bringen. Übereck gestellte figürliche Hermen, die Portalverdachungen tragend, ziehen den Platzraum an die Fassade heran. Anschließend folgen Gebäude mit wechselnden Traufhöhen; alles zusammen suggeriert den gewachsenen Bestand. Doch überspringender Dekor und wiederkehrende Architekturmotive verraten die planmäßige Anlage. Und es blüht verborgene Vielfalt in der Einheitlichkeit: als Prospekt im Hintergrund, doch alles überragend, die Türme des Doms aus satter Romanik mit Helmen einer bedächtigen Gotik. Dem maßvollen Barock der Residenz, unterlegt mit Erinnerungen an den italienischen Palazzo der Renaissance, von Diözesanbaumeister Giacomo Angelini, erwies noch der Nachfolger Gabriel Gabrieli bei der Vollendung des Baus seine Referenz. Erst dem langen Kavalierhof gegenüber verpasste er ein zeitgemäßes frühes Rokoko, doch mit einem Ausdruck ernster Sachlichkeit. Andere Gebäude münden schon in heraufdämmernden Klassizismus, den Maurizio Pedetti, dieser wiederum Nachfolger Gabrielis, auch im aufgepeppten Mittelrisalit der Residenz anklingen ließ. Dabei schwebt über dem Platz leise, doch unüberhörbar ein Wiener Ton in der Luft, Grund genug für Kunsthistoriker, abwertend eine konservative Grundhaltung auszumachen. Tatsächlich steht allerdings der Ausbau Eichstätts zur barocken Residenz im Zusammenhang mit der Reichstreue seiner Bischöfe, die sich dem habsburgischen Kaiserhaus eng verbunden fühlten. Politisches Kalkül, das den Stein mit dünner Lasur überzieht.
Doch das eigentlich Wunderbare dieses Platzes liegt in der verstörenden Selbstverständlichkeit seiner Asymmetrie. Mit der Idee einer imaginären Achse schuf daraus Maurizio Pedetti erst ein fulminantes Gesamtkunstwerk. Diese tritt nur an ihren Enden zu Tage: Der kleine Brunnen an der schmalen Westseite hat ein ausladendes Pendant am andern Platzende, hinterfangen von einem Lindenrondell auf gestuftem Sockel vor dem abschließenden Gebäuderiegel. Aus dem Mittelpunkt dieses Brunnens lenkt eine Mariensäule die Achse noch sechzehn Meter gen Himmel. Ein Obelisk des Katholizismus sozusagen, die Antithese zur lagernden Architektur und zu ihrem Pragmatismus.
Der wunderliche Ort, früher letztlich bloß das Regierungsviertel eines nicht sonderlich bedeutenden Bistums, ist noch immer ein wahrer Stadt-Raum für uralte menschliche Beschäftigungen: Man soll hier flanieren und betrachten, man kann sich austauschen und zur Schau stellen. In diesen Tagen käme vornehmlich der Architekturfreund auf seine Kosten, etwa wenn in klirrend kalter Morgenstunde die aufgehende Sonne den Schatten der Mariensäule auf eine makellose Schneedecke wie auf jungfräuliches Papier würfe und damit Pedettis Idee, für Minuten immerhin, projizierte. Doch es kam anders.
Solch geistige Räume wie dieser Platz (seiner ansichtig beschlich Theodor Heuss ein „Gefühl der verzauberten Zeitlosigkeit“) sind längst zu Spekulationsobjekten merkantilen Gebrauchs und Spielwiesen eines gewalttätigen Marketing geworden, das Stadträume ohnehin nur in Einheiten profitabler Kojen rechnet. Die herrliche Eichstätter Architekturkulisse gibt in diesem Winter erstmals die Staffage für eine Kunsteisbahn her, in diesen eisigen Tagen letztlich ein grotesker Anachronismus. Erstaunlich die kaum kaschierte Schäbigkeit der profitablen Gaudiarena, bemerkenswert ihr unverhohlener Angriff auf die gedämpfte Akustik dieses inwendigen Außenraums mittels des schnarrenden Kühlaggregats und scheppernder Musikbeschallung. Entsetzt sind sogar die Liebhaber der gemütlichen Stadt-Möblierung, eine lokale Sektion des internationalen Vereins für biedermeierliches Behagen im Urbanen. Dabei leisteten sie Pionierarbeit. Nach beharrlich ausgetragenem Gezänk konnten sie die Aufrüstung dieser wunderbar freien Fläche mit Terracottakübeln als Teilerfolg feiern. Der Einzelhandelsverband ließ sich die winterliche Unterhaltung eine schöne Stange Geld kosten in der Hoffnung auf höhere Umsätze und auf weitere, am besten ständige Events. Eine bizarre Vorstellung, leisteten sich doch gerade diese alten Städte noch den Aufeinanderprall der Ideen, das tolerante Zusammenleben radikal getrennter Funktionen ihrer Teile. Hier ist es die geistlich-geistige Stadt, der jenseits der Domkirche die merkantile Bürgerstadt entgegensteht. Die Vermischung solcher historisch gewachsener Schichtungen war schon immer der Anfang vom Ende derart intelligenter Stadtbaukunst. Dabei liegt das Besondere des Eichstätter Residenzplatzes (auch unter anderen grandiosen Platzkompositionen des 18. Jahrhunderts, das man ein Jahrhundert der Plätze nennen könnte) vielleicht gerade darin: Nicht das Besondere zu wollen, sondern das Alltägliche bereichernd zu gestalten.
[1.2002]